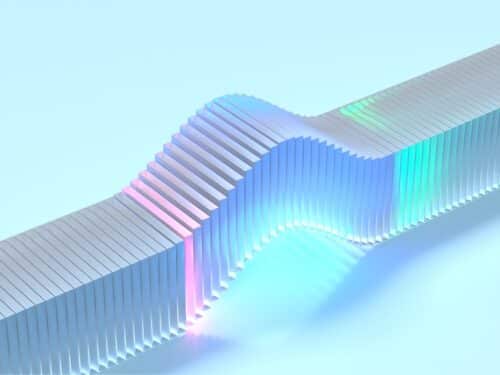Die wenigsten Angestellten können ihre Religion auch am Arbeitsplatz leben. Dagegen tun viele Arbeitgeber inzwischen etwas. Denn immer mehr Mitarbeiter erwarten, dass auch ihre Religion als Teil ihrer Persönlichkeit wahrgenommen wird. Großer Aktionismus ist allerdings nicht gefragt, sondern individuelle Angebote.
Jeden Freitag zur Mittagszeit kommen am Frankfurter Flughafen Piloten, Geschäftsleute, Bauarbeiter, Taxifahrer und Reinigungskräfte zusammen. Sie treffen sich, um gemeinsam zu beten. Am Frankfurter Flughafen gehört das zum Arbeitsalltag. Sieben Gebetsräume stehen Reisenden und Angestellten des Flughafenbetreibers Fraport in beiden Terminals und im Transitbereich zur Verfügung. Christen, Muslime, Orthodoxe Christen und Juden können auf insgesamt mehr als 300 Quadratmetern in jeweils eigenen Räumen beten und sich besinnen. Außerdem gibt es ökumenische Räume. Jede Person soll am Flughafen die Möglichkeit haben, ihre Religion zu leben. Das Angebot kommt gut an. Zum Freitagsgebet, das für Muslime wichtigste Gebet der Woche, kommen regelmäßig 100 Gläubige zusammen. Auch die christlichen Messen und Andachten sind gut besucht.
Bereits in den 1970er Jahren hatte der Flughafen die ersten Gebetsräume eingerichtet. Damals waren es noch schmucklose Zimmer im Abflugbereich des Terminals. Mittlerweile hängen in den christlichen Kapellen Kreuze, im jüdischen Gebetsraum steht ein siebenarmiger Kerzenleuchter und muslimischen Gläubigen stehen Möglichkeiten zur rituellen Waschung und Gebetsteppiche zur Verfügung. Das Angebot kommt nicht von ungefähr: „Von einem internationalen Flughafen wird erwartet, dass man sich zum Beten zurückziehen kann – von Reisenden und von unseren Mitarbeitern“, sagt Christian Meyer, Diversity Manager bei Fraport. „Das Angebot gilt als Zeichen für Toleranz, aber auch unserer Wertschätzung gegenüber unseren Beschäftigten.“
Nur in wenigen Unternehmen spielt das Thema Religion eine solch selbstverständliche Rolle wie bei Fraport. „Firmen kümmern sich um die Eingliederung älterer Mitarbeiter oder stärken die Position der Frauen. Der Glaube gilt allerdings als Privatsache der Mitarbeiter“, sagt Petra Köppel, Inhaberin von Synergy Consult. Sie hilft Unternehmen dabei, die Vielfalt der Belegschaft zu fördern und ein Diversity Management aufzubauen. „Das Thema Religion gilt in der Geschäftsleitung meist nicht als Handlungsfeld“, sagt Köppel. Das sei allerdings zu kurz gedacht: Für viele Menschen gehört der Glaube zu ihrem Leben und zu ihrer Persönlichkeit. „Wer den Mitarbeiter als ganzen Mensch wahrnehmen und unterstützen will, muss auch seine Religion und die damit verbundenen Bedürfnisse ernst nehmen“, sagt Köppel.
In den meisten deutschen Unternehmen herrschen dagegen Hemmungen, mit Angestellten überhaupt über ihren Glauben zu sprechen, vor allem bei muslimischen Mitarbeitern. „Die wenigstens Chefs trauen sich, den Islam zum Thema zu machen. Als Schwierigkeit kommt hinzu, dass kaum jemandem die verschiedenen Ausprägungen des Islams bekannt sind“, sagt Köppel. Das Verhängnis dieser Unsicherheit: Muslime sind ein fester Bestandteil Deutschlands und damit auch der Arbeitswelt. „Unternehmer sollten religiöse Bedürfnisse von Mitarbeitern deshalb nicht ignorieren“, sagt Köppel.
Teil der Unternehmenskultur
So sieht das auch Rüdiger Theobald, Leiter Führungskräfte- und Mitarbeiterentwicklung der IT-Unternehmensberatung BTC in Oldenburg. Er ist überzeugt: „Wer sich jetzt nicht des Themas Religion annimmt, wird spätestens in fünf Jahren Probleme damit haben, gute Mitarbeiter für sein Unternehmen zu gewinnen“, sagt Theobald. „Wenn der Fachkräftemangel zur Realität wird und Firmen um die besten Talente werben, werden die Unternehmen punkten, die jeden einzelnen Mitarbeiter wertschätzen und das Thema Diversity glaubhaft verkörpern“, sagt Theobald. Ein selbstverständlicher Umgang mit gläubigen Mitarbeitern sei ebenso wichtig wie etwa der mit Behinderten. „Das ist Teil einer Unternehmenskultur.“
BTC lebt die Diversität der Mitarbeiter. Die rund 2.000 Angestellten stammen aus knapp 30 Nationen. 20 Prozent der Beschäftigten haben einen Migrationshintergrund. Unter den Jüngeren ist der Anteil sogar noch größer. Für viele ist ihr Glaube Teil ihrer Persönlichkeit. Das nimmt BTC ernst. In den Terminkalendern des Unternehmens sind nicht nur christliche Feiertage eingetragen, sondern auch muslimische und jüdische. Damit zeigt die Unternehmensleitung, dass sie an die Feste aller Gläubigen denkt. Mittlerweile gibt es auch einen Gebetsraum in der Unternehmenszentrale.
Seit etwa zehn Jahren ist das Thema Religion zudem Teil jedes Führungskräftetrainings. „Der Umgang mit gläubigen Mitarbeitern ist zwar kein sehr umfangreicher Teil des Seminars“, sagt Theobald. „Unsere Führungskräfte sollen aber damit vertraut sein, welchen Einfluss der Glaube auf den Arbeitsalltag haben kann.“ BTC fordert von seinen Führungskräften einen sensiblen Umgang, dass sie passende Worte wählen, den Glauben von Mitarbeitern nicht zu prominent ansehen, aber durchaus als wichtigen Bestandteil der Person. Nur dann können sie etwa Rücksicht nehmen auf Angestellte, die während des Ramadans fasten. Essenseinladungen mit Kunden können Chefs etwa bewusst auf Termine nach Sonnenuntergang legen. Oder sie verstehen, dass das Fasten mitunter Einfluss auf die Leistung der Mitarbeiter hat. Für ein besseres Verständnis sorgt auch das Intranet bei BTC. Dort berichten muslimische Mitarbeiter über ihre Erfahrungen während des Ramadans. „So bekommt jeder Kollege einen Einblick in die Bräuche“, erzählt Theobald.
Besseres Kundenverständnis
BTC profitiert von diesem Engagement. „Die Diversität unserer Mitarbeiter hilft uns im Geschäftsalltag“, sagt Theobald. „Je gemischter die Teams, desto besser verstehen wir die Bedürfnisse unserer Kunden – und desto eher vermeiden wir Fettnäpfchen.“ Hinzu kommt: Gut ausgebildete Nachwuchskräfte legen großen Wert auf ein tolerantes, offenes Arbeitsumfeld. „Sie erwarten, dass verschiedene Kulturen und Religionen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit zusammenarbeiten, die man sich erst einmal erarbeiten muss“, sagt Theobald. Er ist sich sicher: „Künftig zählt eine tolerante Wertekultur in Unternehmen zum festen Bestandteil der Arbeitskultur.“
Der Flughafenbetreiber Fraport hat sein Angebot jüngst noch ausgeweitet. Seit drei Jahren können Muslime während des Ramadans am Frankfurter Flughafen nach Sonnenuntergang halal speisen, also nach den Regeln des Korans. Fraport übernimmt die Kosten für das Essen. Eingeladen zum Fastenbrechen sind neben den Mitarbeitern auch Reisende. Ein ähnliches Angebot hatte Diversity-Manager Christian Meyer bei Botschaftsempfängen, im Landtag oder beim österreichischen Bundeskanzler beobachtet.
Offenheit und Dialog
Nicht jedes Unternehmen muss aber viel Geld in die Hand nehmen, um Mitarbeiter in ihrem Glauben zu unterstützen. Es bedarf auch keines umfangreichen, teuren Konzepts. „Unternehmer sollten vor allem den Dialog suchen, in einem Gespräch ganz offen fragen, ob gläubige Muslime, Christen oder Juden sich für ihren Arbeitsplatz überhaupt etwas wünschen“, sagt Diversity-Expertin Petra Köppel von Synergy Consult. Manchmal sind die Wünsche leicht zu erfüllen: ein koscheres Essen in der Kantine, eine Halal-Kennzeichnung bei Gerichten ohne Schweinefleisch oder flexible Arbeitszeiten während des Ramadans. Als Einstieg können Unternehmer einen festen Ansprechpartner für Diversity-Fragen bestimmen, damit Mitarbeiter überhaupt wissen, an wen sie sich mit ihren Wünschen wenden können. „Damit drücken Chefs ihre Wertschätzung gegenüber ihren Angestellten aus“, sagt Köppel. „Und Beschäftigte fühlen sich ernst genommen.“
Diesen Eindruck hat auch Fraport-Diversity-Experte Meyer. „Diejenigen, die unser Angebot nutzen, sind begeistert und bedanken sich für unseren Einsatz“, sagt Meyer. „Alle anderen haben nichts dagegen.“ Sie sehen vielmehr die Wertschätzung, die wir allen Mitarbeitern mit solchen Ideen entgegenbringen. „Diese Wahrnehmung hat eine wichtige Signalwirkung an bestehende und mögliche Mitarbeiter“, sagt Meyer. „Gerade mit Blick auf den demografischen Wandel.“
Die Einstellung zu Religionen hat sich verändert. Eine besondere Entwicklung lässt sich nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 beobachten. In Frankfurt hat man darauf direkt reagiert: Die geistlichen Leiter nahmen die Unsicherheiten der Reisenden und Beschäftigten am Flughafen zum Anlass, eine sogenannte Abrahamische Feier ins Leben zu rufen. Seitdem zelebrieren alle Religionen gemeinsam gegenseitiges Verständnis, Akzeptanz und Toleranz. Rund 150 Beschäftigte und Gäste nehmen jährlich teil. Ein Zeichen dafür, dass das Interesse, zu seiner Religion zu stehen und diese zu leben, wächst.