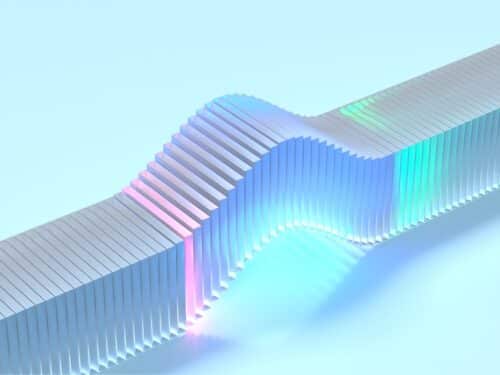Der Begriff „Unternehmenskultur“ ist vom Status einer exotischen Idee längst in den Kanon der Betriebswirtschaft aufgestiegen. Viele Denker haben sich mit Unternehmenskultur befasst. Der einflussreichste heißt Edgar Schein.
Als im Herbst 2015 Stück für Stück der Skandal um manipulierte Abgaswerte beim Autohersteller Volkswagen ans Licht kam, meldeten sich schnell Beobachter, die einen Grund für die Machenschaften gefunden haben wollten: Von „fundamentalen Defiziten in der Unternehmenskultur“ spricht der Automobilexperte Stefan Bratzel laut Branchenmagazin „Automobil Produktion“. „Wachstums- und Kostendruck gepaart mit einer vorherrschenden Kultur der Angst vor dem Scheitern“ sollen nach Meinung Bratzels zu den Manipulationen an der Motorsoftware geführt haben.
Der VW-Fall ist nur der jüngste einer Reihe von Wirtschaftsskandalen, für die Beobachter und Beteiligte die Kultur im jeweiligen Unternehmen verantwortlich machen. Die Deutsche Bank, zuletzt wegen der Finanzkrise und des Skandals um manipulierte Zinssätze unter Druck, hat sich gar eine sogenannte Kulturinitiative verordnet: Der damalige Personalvorstand Stephan Leithner sprach im Jahr 2013 davon, eine „Erneuerung der Werte und Handlungsprinzipien“ vorantreiben zu wollen. Über „Kulturwandel und Unternehmenswerte“ können sich Mitarbeiter und Bewerber heute umfassend auf den Mitarbeiter- und Karriereseiten sowie im Personalbericht der Deutschen Bank informieren.
Unternehmen als Maschinen
Dass die Informationen ausgerechnet im HR-Bereich zu finden sind, ist kein Zufall. „Das Management der Unternehmenskultur ist eine Aufgabe, mit der nicht selten die Personalabteilungen betraut werden“, sagt Georg Schreyögg, Professor für Organisation und Führung an der Freien Universität Berlin. Personalmanager sitzen stets mit am Tisch, wenn es um Kultur oder gar Kulturwandel im Unternehmen geht. Schließlich hat Kultur etwas damit zu tun, wie die Mitarbeiter miteinander umgehen, mit der Öffentlichkeit und mit Kunden. Oder doch nicht? Ein Blick in die Begriffsgeschichte hilft womöglich, Missverständnisse zu vermeiden. Vor hundert Jahren sprach noch kein Ökonom und erst recht kein Unternehmer über Kultur.
Damals verstand man Unternehmen eher als Maschinen, die funktionierten oder eben nicht. Sie waren „Räderwerke“. Ab den 1920er Jahren veränderte sich die Perspektive. Man sah Unternehmen nicht mehr ausschließlich als Maschinen, sondern bemerkte: Dort arbeiten Menschen, und die stehen in vielfältigen Beziehungen zueinander. Sie haben eigene Pläne, die nicht immer nur auf Eigennutzenmaximierung abzielen. Die Human-Relations-Bewegung wertete die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern sowie Führungskräften und Mitarbeitern als ökonomischen Faktor – der „social man“ ergänzte den „homo oeconomicus“. Mitarbeiterführung gehörte nun zum Management-Werkzeugkasten. Begriffe wie Betriebsklima hatten ihre ersten Auftritte auf der Bühne der Managementtheorie.
Vom Betriebsklima zur Unternehmenskultur war es aber noch ein weiter Weg. Großen Anteil an der Karriere des Begriffs hatte der Siegeszug japanischer Unternehmen in den 1970er Jahren. Damals waren westliche Beobachter ratlos: Was machte die Unternehmen aus Japan bloß so erfolgreich?
Bei der Unternehmensberatung McKinsey beschäftigte sich eine Gruppe von Beratern mit dieser Frage. Das in der Managementtheorie berühmt gewordene 7-S-Modell war ein Ergebnis der Untersuchungen: Die McKinsey-Berater identifizierten sieben Kernelemente, die den Unternehmenserfolg, nicht nur den japanischer Konzerne, beeinflussen. Der Großteil dieser Elemente bezog sich auf weiche Faktoren, auf die in einem Unternehmen herrschende Kultur. Richtig bekannt wurde der Begriff 1982 durch „In Search of Excellence“ von den McKinsey-Beratern Tom Peters und Robert H. Waterman. Darin untersuchten sie amerikanische Unternehmen, und gingen der Frage nach, was sie erfolgreich gemacht hat. Die Antwort: Der Mensch ist der Schlüssel zu allem, weiche Faktoren sind wichtig. Weiche Faktoren wie zum Beispiel die Unternehmenskultur.
Eine exotische Idee
Das war die populärwissenschaftliche Initialzündung – seither ging es für den Begriff Unternehmenskultur steil bergauf. Peters und Waterman sorgten dafür, dass Praktiker in Unternehmen sich nicht nur Gedanken über Strategien, Absatzzahlen und Märkte, sondern auf einmal auch über Kultur machten. Sie wiesen auf einen Faktor hin, den man in der Betriebswirtschaftslehre und in der Führungstheorie bis dahin nicht auf dem Schirm hatte. Auch der Ökonom Schreyögg war damals skeptisch, erinnert er sich: „Es war eine völlig exotische Idee. Ich hätte nicht gedacht, dass die Praktiker diesen Begriff so schnell annehmen.“
Exotisch war die Idee, weil man von Kultur bis dahin nur in ethnologischen oder anthropologischen Zusammenhängen gesprochen hatte. Stämme auf fernen Inseln hatten eine bestimmte Kultur. Auch Nationen. Aber Unternehmen?
Doch die Wirtschaftswissenschaft nahm den neuen Begriff schnell an. Neben der Amerikanerin Linda Smircich prägte vor allem der ebenfalls amerikanische Organisationstheoretiker Edgar H. Schein die Diskussionen ab Mitte der 1980er Jahre. Er gilt als einer der Begründer der Organisationspsychologie, vor allem wegen seines Drei-Ebenen-Modells der Unternehmenskultur. Schein hat die Annahmen über Kultur aus der Anthropologie übernommen und auf Organisationen übertragen. Unternehmenskultur ist bei Schein nicht etwa eine Idee, die sich auf mehr oder weniger schwammige Aussagen über Werte, Normen und Regeln stützt. Sie hat eine klare Struktur.
Scheins Modell gliedert sich in drei Ebenen. Ganz oben stehen die sogenannten Artefakte: Symbole, Zeichen, alles was schon auf den ersten Blick sichtbar ist. Damit meint Schein solche profan wirkenden Dinge wie das Unternehmenslogo, die Büromöblierung, die Kleidung der Mitarbeiter, aber auch Riten, Unternehmensfeste und Legenden, die im Unternehmen erzählt werden. Gibt es ein großes Büro für alle, in dem immer Trubel herrscht? Oder arbeitet jeder für sich in einem eigenen Zimmer? Tragen die Mitarbeiter Kapuzenpullis oder Kostüm und Anzug? Ist die jährliche Weihnachtsfeier eine Veranstaltung mit vielen Reden und Büfett oder geht man auch mal zum Kegeln? Gibt es überhaupt eine Weihnachtsfeier? Diese Dinge sind leicht zu beobachten – aber Schein zufolge unglaublich schwer zu interpretieren. Sie allein sagen noch nicht viel über die Unternehmenskultur aus.
Denn die Artefakte basieren auf Normen, Standards und öffentlich propagierten Werten. Das ist die zweite Ebene in Scheins Modell. Hier geht es sowohl um klar ausgesprochene als auch um ungeschriebene Regeln über das Verhalten, um Verbote oder Glaubenssätze. Auf dieser Ebene findet man die Normen, nach denen Mitarbeiter im Unternehmen handeln und arbeiten: „Vertraue deinen Kollegen“ zum Beispiel, „Übe keine Kritik an Vorgesetzten“ oder auch „Sei immer ehrlich – auch gegenüber Vorgesetzten“. Solche impliziten Vorgaben teilt die Mehrheit der Mitarbeiter, ohne dass man darüber sprechen müsste. Sie sind nicht so offensichtlich wie die Artefakte, aber auch nicht so unbewusst wie die dritte Ebene in Scheins Modell: Die Ebene der grundlegenden, unausgesprochenen Annahmen.
Diese Annahmen sind Schein zufolge Basis und Kern einer Unternehmenskultur. Sie beziehen sich auf das Welt- und Menschenbild einer Organisation, ganz ähnlich der aus der Psychoanalyse bekannten Idee des Unbewussten: Es gibt bestimmte Annahmen über die Zeit, die Umwelt, über Wahrheit, über die Natur des Menschen und des menschlichen Handelns sowie über soziale Beziehungen. Wie sehr kann man die Umwelt kontrollieren? Arbeiten Menschen gerne, oder nur weil sie es müssen? Ist gute Arbeit immer anstrengend oder macht sie Spaß? Sind alle Menschen gleich, oder sind manche gleicher als andere?
Man versteht die Kultur eines Unternehmens nicht, wenn man diese grundlegenden Annahmen nicht kennt: „Der wirkliche Motor der Kultur – ihr Wesen – sind die gemeinsamen, unausgesprochenen Annahmen, auf die sich das alltägliche Verhalten stützt“, schreibt Schein in „Organisationskultur“. Problematisch wird die Unternehmenskultur immer dann, wenn die Umwelt sich geändert hat, und die Kultur sich diesem Wandel nicht anpasst.
Sonja Sackmann, die Edgar Schein sehr gut kennt und schon lange und intensiv über Unternehmenskulturen forscht, weist auf ein Manko in Scheins Modell hin: „Schein hat eigentlich etwas gemacht, das Wissenschaftstheoretiker eher kritisch sehen: Er hat die fünf grundlegenden Annahmen, die im Fachbereich der Anthropologie entwickelt wurden, ungeprüft auf einen ganz anderen Wissenschaftsbereich übertragen“, sagt die Organisationspsychologin. Unternehmen und andere Organisationen seien eben keine Stämme auf fernen Inseln, die von den damaligen Anthropologen untersucht wurden, sondern immer nur überlebensfähig, wenn sie gegenüber ihrer relevanten Umwelt offen seien.
Struktur eines diffusen Begriffs
Trotzdem: Scheins Modell ist so erfolgreich, weil es einem sehr vagen, interpretationsbedürftigen Begriff eine Struktur gegeben hat. Es ist ein Schema, mit dem man sich Unternehmenskulturen schrittweise erschließen kann – von oben nach unten, von außen nach innen. Aber das Modell hat es in sich: Unbewusste Grundannahmen sind schwer zu ändern. Es ist möglich, aber langwierig. Personalmanager sollten sich darüber im Klaren sein: „Der erste Schritt zu einer Kulturveränderung ist immer, ohne Ausnahme, die Erfassung des Ist-Zustands“, sagt Experte Schreyögg – und dann braucht es viel Zeit. Werte kann man nicht verordnen, erst recht nicht grundlegende, jedoch unbewusste, Annahmen über die Natur der Dinge.