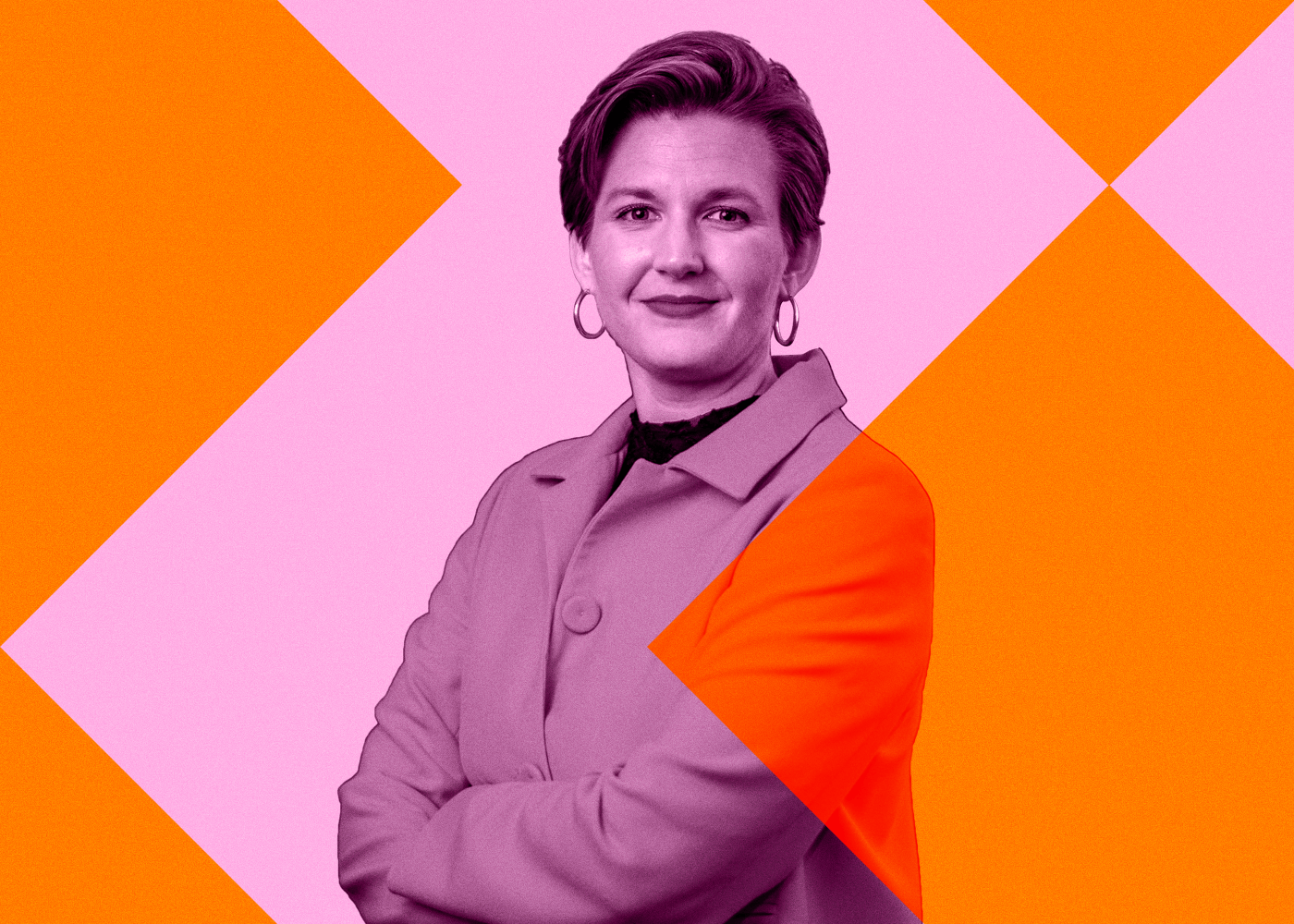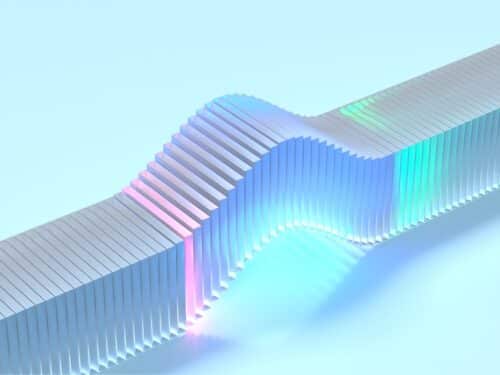Die Grenze zwischen gesund und krank verläuft fließend, vollständige Gesundheit ist eine Utopie. Warum wir den Begriff „Krankheit“ entstigmatisieren müssen.
Ich diskutiere während eines Spaziergangs mit einer Person darüber, wann und ob wir einen Menschen eigentlich als „psychisch krank“ bezeichnen können? Schwierige Frage, denke ich mir. Ich weiß, dass ich als Sprachwissenschaftlerin besonders sensibel für Bezeichnungen (sogenanntes Labelling) bin, aber wie geht es anderen? Wir erschaffen mit Wörtern dahinterliegende Sachverhalte, wir benennen und klären, wir grenzen aber auch aus. Sprache kann heilen – das zeigen diverse Formen von Psychotherapie und Coaching –, aber auch kränken.
Fangen wir groß an: Diversität ist aktuell unglaublich „hip“ bei HR-Verantwortlichen – besonders, wenn es um Aspekte der mentalen Diversität geht. Auch ich habe in meinen Vorträgen schon damit geworben. Teils überlappend finden sich die Bezeichnungen Neurodiversität (Head of Diversity Nina Strassner, SAP) oder Cognitive Diversity. Hiermit meinen wir alle, so behaupte ich, Ähnliches: die Integration von Menschen, die von der „Norm“ der Gesellschaft abweichen (in der Gauss’schen Normalverteilung also rechts und links ansässig sind), wenn es um das Verarbeiten von Informationen, Gedanken und Emotionen geht. Es sind Menschen, die laut ICD-10 („International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems“) mit Depressionen, Angst-, Sucht- oder bipolaren Störungen diagnostiziert wurden, aber auch solche, die (noch) nicht behandelt werden (wollen). Ich denke an Menschen, die hyperaktiv sind oder sich mit dem Lesen und Schreiben/Rechnen schwertun (Dyslexie, Dyskalkulie), indes auch solche, die besonders empfindsam sind (Hochsensibilität) oder solche, die mit cholerischen, neurotischen oder autistischen Persönlichkeits-Nuancen ausgestattet. Sind diese Menschen nun alle „krank“?
Nehmen wir das Beispiel des SPD-Politikers Bijan Kaffenberger. Der Spiegel, das ZDF, der Hessische Rundfunk – alle titeln ähnlich: Politiker mit Tourette-Syndrom: Bijan Kaffenberger macht Karriere. Die sprachliche Zubereitung der Berichterstattung lässt eindeutig auf zugrundeliegende Normen schließen: Indem Tourette-Syndrom und Karriere explizit nebeneinanderstehen, wird impliziert, dass es nicht selbstverständlich ist, mit Tourette beruflich so erfolgreich zu sein.
Auch wenn dieser Zusammenhang in der Realität in vielen Fällen zutreffen mag, zeigt das Beispiel ein grundlegendes Weltbild: Demzufolge „labeln“ wir Zustände von außen („Tourette-Syndrom“), etikettieren diese als „Krankheit“ (bis hin zur Behinderung) und schließen Menschen kognitiv und real aus dem Arbeitsleben aus. Zahlreiche Menschen empfinden den Begriff „Tourette“ dabei übrigens als stigmatisierend und sprechen selbst lieber von ihren „Tics“.
Hinter dieser Weltsicht steht ein biomedizinisches Verständnis von Gesundheit, in dem es genau zwei Zustände gibt: Als „gesund“ gilt nur, wer nicht „krank“ ist. Dieses Verständnis von Krankheit als objektivierbarer Störung eines Organismus entwickelte sich in den westlichen Naturwissenschaften des 19. Jahrhunderts. Mit dem Ziel, ein positives Gesundheitsverständnis zu etablieren, definierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 1946 „Gesundheit“ als einen „Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens.“ Daran hat sich bis heute nichts geändert. Mal ehrlich: Kann das irgendjemand vollständig in jeder Situation von sich behaupten? Ab wann ist eine trauernde Person dann depressiv oder ein sich um das Kind sorgende Elternteil neurotisch? Gesundheit ist demnach eine Utopie, ein Ideal, das streng genommen nur etwa 4 Prozent der Menschen in Deutschland erreichen.
Die Problematik der Gesund-Krank-Dichotomie
In der semantischen Tiefenstruktur der Begriffe „Gesundheit“ und „Krankheit“ spielt sich zudem noch eine spannende Verknüpfung ab, nämlich die Gleichsetzung von gesund mit „gut/normal“ und krank mit „schlecht/unnormal“. Auf der Satzoberfläche ist diese Verknüpfung im Büroalltag mal schnell eben dahergesagt: „Der Chef ist doch krank“ oder „das ist doch nicht normal“. Aber was passiert kognitiv mit uns, wenn wir solche Sätze sagen? Unsere Kolleginnen und Mitarbeiter werden Teil der „Kranken“ oder „Unnormalen“ und bekommen ein Stigma. Aufgrund dessen werden sie als Teilgruppe „anders“ gesehen – eine Andersbehandlung/Stigmatisierung, gegen die sich Menschen mit Behinderung seit Jahren wehren. Aber hier kommt die nächste Frage auf: Wann und wo beginnt „Behinderung“? Eine Opposition zwischen Normalen und „anderen“wird konstruiert, woraus kommunikativ immer ein Machtgefälle entsteht. Das ist fatal für Führungskräfte, Teams und ganze Organisationen, da sie in ihren Reihen Machtgefälle und -gräben erschaffen, wo keine sind.
Die Grenze zwischen „gesund“ und „krank“ zu definieren, ist seit jeher ein individuelles als auch historisches Konstrukt. Bis in die späten 1950er galten die Wechseljahre als „Krankheit“. Wörter wie Irrenanstaltundgeisteskrank,die wir heute als diskriminierend (ableistisch) empfinden, schrieb der Soziologe Erving Goffman in den 1690er noch in seinen Fachbüchern. Während wir derzeit viele Zustände (Angst-Störung, bipolare Störung, Tourette-Syndrom) durch Störung oder Syndrom noch klar als „Krankheit“ konnotieren, verschwimmen die Grenzen beim Thema Autismus bereits: Aus der Autismus-Spektrum-Störung ist vielerorts nur Autismus-Spektrum geworden. Menschen werden damit selbstverständlicher ins Arbeitsleben integriert (Beispiel: IT-, Sicherheitsbranche, Landschaftspflege), ohne sie als „krank“ zu laben – ihre Fähigkeiten zur Suche nach Ordnungen werden als positiv wahrgenommen. Auch die Depression ist mit ihrem Euphemismus Burn-out in manchen Unternehmensberatungen schon eine gern gesehene Trophäe geworden. Steven Pinker bezeichnet dieses Phänomen jedoch als Euphemismus-Tretmühle:Jeder Euphemismuswird irgendwann die negative Konnotation seinesVorgängerausdrucks annehmen, solange sich dieexternen Verhältnisse nicht ändern. Das könnte auch dem Wort Burn-out passieren – wenn sich unser Leistungs-Mindset und die Arbeitsbedingungen nicht ändern, werden wir den Ausdruck Burn-out früher oder später negativer wahrnehmen als aktuell – und einen neuen neutralen Ausdruck finden, um das Phänomen zu bezeichnen.
Gesundheit als Kontinuum
Es geht also um zwei Aspekte: Erstens, die Dichotomie gesund – krank aufbrechen und den Raum für weitere Zustände öffnen; zweitens, den Begriff der Krankheit zu entstigmatisieren. Wir müssen endlich akzeptieren, dass „Krankheit“ nicht das Gegenteil von „Gesundheit“ ist. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) bedeutet vielerorts, „Gesundheit“ mit „Normalität“ und damit Leistungsfähigkeit gleichzusetzen. „Kranke“ Menschen werden in diesem mechanistischen Weltbild zu einer Störung, die es zu beheben gilt. Menschen selbst schweigen, um nicht als „krank“ zu gelten (oder täuschen einen Urlaub vor, wenn sie eine psychosomatische Klinik aufsuchen). Um das zu ändern, braucht es mehr Offenheit, psychologische Sicherheit und konsequente Reflexion in Unternehmen. Wir können mit und nicht trotz einer überwundenen Lungenembolie und einer generalisierten Angst (das weiß ich aus eigener Erfahrung) ein erfolgreiches Berufsleben führen und uns gut fühlen. Anstatt der strengen Krank-Gesund-Dichotomie wurde vom Medizinsoziologe Aaron Antonovsky bereits in den 1980er-Jahren das Konzept der Salutogenese eingeführt (Gesundheit als ein Kontinuum). Besser wäre es zudem, die Belastungen und Barrieren zu fokussieren, die Menschen ausschließen und „krank“ machen.
Als ich diesen Appell im Oktober 2021 auf einem Podium vorstellte, meldete sich eine Zuhörerin mit einem Einwand. Sie wollte weiter auf ihrem Label „krank“ bestehen. Nur dieses ermöglichte ihr in einer depressiven Episode die offizielle Krankschreibung und Lohnfortzahlung sowie Zugang zu medikamentöser Behandlung. Ich gebe zu: Sprache ist hier doppelbödig. Indem wir eine Person als krank bezeichnen, legen wir ihr bereits (unabsichtlich) ein Stigma auf. Allerdings brauchen wir Sprache, um überhaupt etwas (juristisch) benennen zu können. Auch in der Umgangssprache sind wir sicher (auch ich!) alle einmal „krank daheim“ geblieben (warum auch immer). Es gibt also in diesem Diskurs noch einiges zu tun.
P.S. Ohne Sprache könnte ich diesen Artikel nicht schreiben. Regelmäßiges Schreiben senkt übrigens den Blutdruck und lässt das Herz langsamer schlagen :).
Auch aus dieser Kolumne:Meltdown am Main