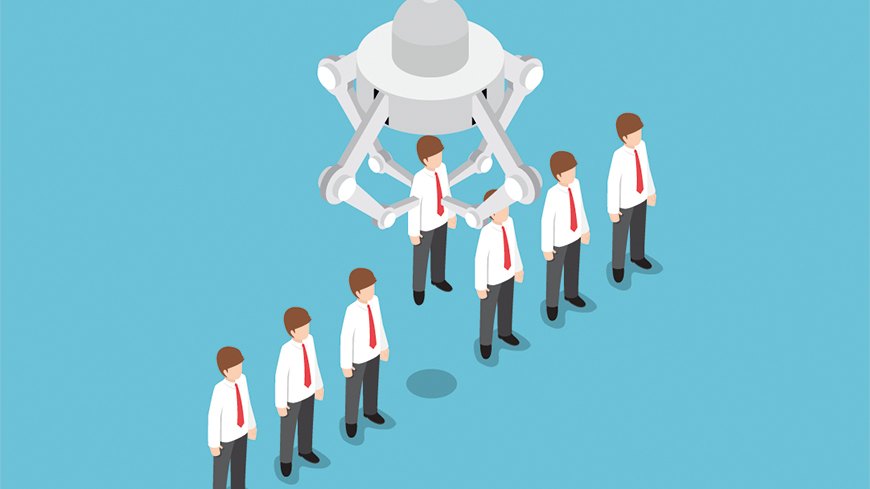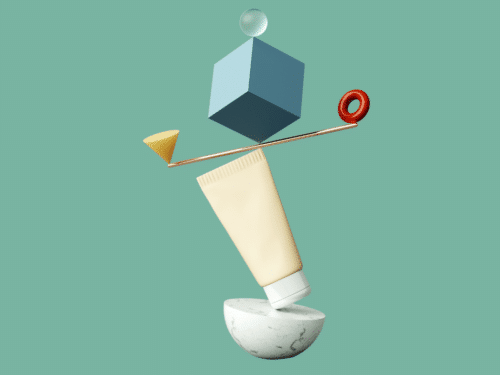Sind intelligente Roboter und selbstlernende Computerprogrammedie besseren Personaler? Studien zeigen, dass Bewerber im Recruiting Prozess den neuenTechnologien gegenüber aufgeschlossen sind. Unternehmen hoffen, mit ihnen Zeit und Geld zu sparen. Doch die automatischen Systeme haben ihre Tücken.
Sie heißen Matilda, Sophie oder Erika – und arbeiten ihre Fragenlisten ohne jede menschliche Regung ab. Ihre Gesprächspartner agieren dafür umso emotionaler. Schließlich kommt es nicht alle Tage vor, dass man als Bewerber einem Roboter Rede und Antwort stehen muss.
Noch arbeiten die batteriegetriebenen HR-Mitarbeiterinnen nur in wissenschaftlichen Laboren in Australien und Japan. Geht es nach den Entwicklern, könnten „emotional intelligente“ Maschinen jedoch schon bald die HR revolutionieren. Weltweit untersuchen Forscher Möglichkeiten für den Einsatz von menschenähnlichen Robotern im Recruiting.
Studien belegen, dass die Idee weniger abwegig ist, als sie auf den ersten Blick erscheint. „Erkenntnisse aus der Psychotherapie zeigen, dass wir Robotern gegenüber ehrlicher sind“, weiß Sven Laumer, Diplom-Wirtschaftsinformatiker an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und Spezialist für IT-Anwendungen im Personalwesen. Anders als Menschen verraten Maschinen nicht über ihre Mimik oder Gestik, was sie persönlich von ihrem Gegenüber halten. „Roboter nehmen Informationen einfach auf und bieten Lösungen an“, so Laumer. Dadurch könnten sie das Vertrauen ihres Gegenübers erwerben.
Andere sehen die Zukunft der Maschinen skeptischer. „Ich glaube, niemand möchte ein Job-Interview mit einem Roboter führen“, sagt Sven Semet, der beim US-Konzern IBM für das Thema „Digitalisierung von HR“ zuständig ist. Die Auswahlstufen bis hin zum entscheidenden Interview jedoch, so Semet, könnten durchaus von Avataren oder anderen intelligenten Applikationen übernommen werden. Sie könnten vorab Lebensläufe prüfen, Fachkenntnisse abfragen und Bewerberfragen beantworten.
KI im Graubereich
Tatsächlich ist die Digitalisierung der HR in vollem Gange. So bieten einige Firmen schon heute sogenannte Career-Bots an. Das sind digitale Karriereberater, die Bewerber über offene Stellen, Karrieremöglichkeiten oder allgemein über ein Unternehmen informieren können.
Deutlich mehr Firmen nutzen bereits automatische Empfehlungssysteme, die potenziellen Kandidaten offene Stellen melden. Und Online-Bewerbungssysteme, die eine automatische Vorauswahl von Kandidaten treffen, sind längst gang und gäbe. „Vor allem Banken und Versicherer dürften Robot-Recruiting nutzen“, vermutet der Schweizer Autor und Berater Joël Luc Cachelin. Tatsächlich sei die Entwicklung automatisierter Auswahlprozesse bereits weiter, als es den Anschein habe.
Cachelin unterstützt Unternehmen im digitalen Transformationsprozess und sieht sich bei seiner Arbeit häufig mit aktuellen HR-Themen konfrontiert. „Vieles geschieht im Verborgenen“, ist er überzeugt. Zum einen wollten die Firmen nicht riskieren, dass Wettbewerber ihre Algorithmen kopierten. Zum anderen bewegten sie sich unter Umständen datenschutzrechtlich in einem Graubereich. Cachelin hält die neuen Formen des Recruiting dennoch für unverzichtbar: „Unternehmen werden sich in Zukunft anders strukturieren als heute.“ Dazu gehörten andere Hierarchien, eine abteilungsübergreifende Vernetzung und die Arbeit in Projektteams, die sich immer schneller für immer kürzere Zeit zusammensetzen.
„Der HR-Prozess wird sich vom Recruitment zum Staffing entwickeln“, sagt Cachelin. Um die nötigen Mitarbeiter für diese Aufgaben zu finden, müssten sich Personaler neue Kompetenzen aneignen und automatisierte Systeme nutzen.
Präzise, schnell und diskriminierend?
Die Vorteile der HR-Systeme liegen auf der Hand: Sie sparen Zeit, haben eine hohe Trefferquote und sind diskriminierungsfrei – so die Theorie. „Zeit ist ein wichtiger Faktor im Recruiting geworden“, unterstreicht Laumer von der Universität in Bamberg: Einerseits helfe die Digitalisierung den Personalern, sich stärker auf relevante und spannende Kandidaten konzentrieren zu können. Andererseits erhalten Bewerber schneller eine Zu- oder Absage, was für die Entscheidung zwischen zwei potenziellen Arbeitgebern den Ausschlag geben könne.
„Die Treffergenauigkeit ist sehr gut“, weiß Laumer. Bereits vor mehr als zehn Jahren habe ein in Bamberg entwickelter Algorithmus in neun von zehn Fällen exakt die gleichen Kandidaten herausgefiltert wie der Personaler aus Fleisch und Blut. Seither sind die Systeme weiter verbessert worden. Studiengang, Berufserfahrung, Abschlussnote – solche Schlüsselelemente lassen sich sehr leicht in Programme übertragen. Und anders als einem Menschen beim flüchtigen Durchschauen entgeht dem Computer in der Regel keine Information.
Besonders große Hoffnungen ruhen auf einer weiteren Eigenart der Maschinen: Geschlecht, Ethnizität oder soziale Herkunft interessieren Algorithmen nicht. Im Idealfall ließe sich damit das oft formulierte Ziel von mehr Diversität im Unternehmen endgültig umsetzen. „Wenn das System richtig eingestellt ist, ist es diskriminierungsfrei“, sagt Laumer. Doch gerade an diesem Punkt sehen Kritiker erheblichen Nachbesserungsbedarf, denn die Programme basieren auf Daten, die ihnen von Menschen eingegeben werden. Im schlimmsten Fall werden bestehende Vorurteile in den Programmen zementiert oder noch verstärkt.
„Algorithmen schaffen keine Objektivität“, ist die Wissenschaftlerin und IT-Spezialistin Zeynep Tufekci überzeugt. Die US-Wissenschaftlerin beschäftigt sich mit den Auswirkungen neuer Technologien auf die Gesellschaft und untersucht unter anderem Risiken sogenannter selbstlernender Programme. Diese durchforsten selbstständig riesige Daten-Pools und entwickeln auf dieser Grundlage Auswahlvorschläge – ähnlich wie Googles Trefferliste.
„Es gibt Programme, die Daten von Angestellten eines Unternehmens untersuchen und auf dieser Basis Empfehlungen für Neueinstellungen geben“, so Tufekci. Ziel sei es, High Performer unter den Bewerbern zu identifizieren und für das Unternehmen zu gewinnen.
Doch der Schuss kann nach hinten losgehen: „Es ist möglich, dass ein System bevorzugt Kandidaten mit einem hohen Aggressionspotenzial auswählt, weil das der Unternehmenskultur entspricht“, warnte Tufekci 2016 auf einer Konferenz. Ein Ergebnis, das die Entwicklung der Firma negativ beeinflussen könnte.
Der gläserne Mitarbeiter
Nicht unproblematisch ist auch die Analyse der bestehenden Belegschaft. So geben Daten aus dem Firmen-Intranet, Anwesenheitszeiten oder Notizen von Vorgesetzten nicht nur Aufschluss über die Wechselbereitschaft jedes einzelnen Mitarbeiters, sondern auch über dessen ganz private Sorgen und Nöte.
„Durch die vielen digitalen Krümelchen, die jeder von uns im Netz hinterlässt, können Computersysteme alle möglichen Informationen ableiten“, weiß Tufekci. Dazu zählen die sexuelle Orientierung, Charaktereigenschaften oder politische Vorstellungen. Zudem sei es möglich, bestimmte Erkrankungen wie Depression oder eine bevorstehende Schwangerschaft vorauszusagen. Das wirft ethische und rechtliche Fragen auf. „Solche Systeme mögen finanziell sinnvoll und in mancherlei Hinsicht weniger voreingenommen sein als menschliche Entscheider“, sagt Tufekci. „Aber sie können auch zu einem Ausschluss bestimmter Menschen vom Arbeitsmarkt führen.“
Das größte Problem, so Tufekci, liege in der Intransparenz der selbstlernenden Algorithmen. Anders als regelbasierte Systeme, bei denen alle Auswahlkriterien vom Programmierer vorgegeben sind, seien die Ergebnisse selbstlernender Programme nicht nachvollziehbar. „Diese Systeme trainieren auf Grundlage unserer menschlichen Aktionen, und sie können unsere Vorurteile reflektieren und verstärken.“ Das wiederum führe möglicherweise zu unbeabsichtigten Folgen für das einzelne Unternehmen, aber auch für die ganze Gesellschaft. „Es handelt sich um eine Blackbox“, ist Tufekci überzeugt.
„Den Begriff Blackbox würde ich ablehnen“, widerspricht Semet von IBM. Zwar seien die Unternehmen selbst vielleicht nicht in der Lage, die Ergebnisse selbstlernender Algorithmen zu analysieren. Die Hersteller solcher Recruiting-Programme jedoch hätten die nötige Kompetenz. Allerdings, räumt Semet ein, seien manche Themen, wie etwa die Analyse von Gesundheitsdaten für den Einstellungsprozess, neu und selbst in Expertenkreisen noch nicht ausreichend diskutiert worden.
Von Maschinen und Menschen
Der Bamberger Wissenschaftler Laumer hegt grundsätzliche Zweifel am Einsatz autonom lernender Programme für HR-Aufgaben: „Die Frage ist, ob wir überhaupt genügend Daten haben, um treffende Bewertungen machen zu können.“ Andererseits sieht Laumer große Chancen in der Digitalisierung für das gesamte Recruiting. Viele Job-Suchenden verlangten heutzutage nach modernen Personalmanagementsystemen. „Der Markt ist da, man muss sich darauf einlassen“, fordert er.
Laumer erwartet, dass die Zahl der Bewerbungen in Zukunft insgesamt steigen wird. Dank der Digitalisierung entfalle der Aufwand für fehlerfreie Anschreiben oder ansprechende Layouts. In den USA könnten Job-Suchende sich schon jetzt per Wischbewegung auf dem Smartphone bei Unternehmen bewerben. Die damit verbundene Bewerbungsflut lasse sich nur noch mit viel Aufwand manuell stemmen, glaubt der Wissenschaftler. Doch um die Systeme optimal zu nutzen, benötigen die Personaler neue Kompetenzen, sagt Berater Cachelin. Besonders in kleinen Firmen mangele es daran noch.
Von den Schwächen der neuen Systeme sollte man sich nicht abschrecken lassen, ist Cachelin überzeugt. Für viele davon gebe es eine Lösung. Wo Kritiker des Robot-Recruiting anführen, dass Computerprogramme besonders innovative Talente aussortieren, weil ihr Lebenslauf nicht ihrem Suchschema entspricht, bleibt Cachelin optimistisch: „Man wird versuchen, den Zufall auch in die Algorithmen einzuprogrammieren.“ Er rät HR-Mitarbeitern dazu, die durch digitale Systeme gewonnene Zeit zu nutzen, um selbst im Netz, bei Konferenzen, an Universitäten oder in Co-Working-Offices nach Talenten zu suchen, die Computerprogrammen verborgen bleiben würden.
„Mensch und Maschine ergänzen sich, aber es ist wichtig, deren spezifische Vorteile zu reflektieren“, sagt Cachelin. Man müsse genau überlegen, welche Prozesse im Recruiting der Maschine überlassen werden sollen und welche den Menschen. Dieser Meinung ist auch IT-Spezialistin Tufekci. Zwar sollten Personaler Computerprogramme nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen. „Aber wir benötigen ein gesundes Misstrauen, eine regelmäßige Überprüfung der Algorithmen und eine große Transparenz dieser Systeme“, fordert sie. „Letztendlich dürfen wir nicht unsere menschlichen Werte und menschliche Ethik an eine Maschine abgeben.“