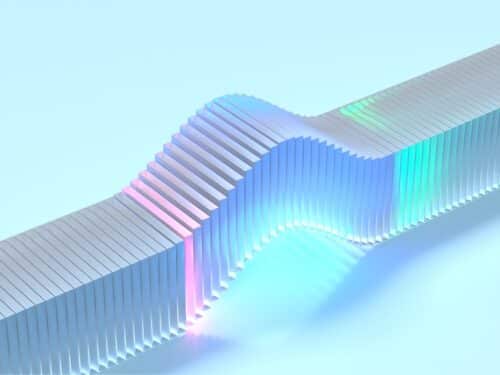Microjob-Dienste wie Streetspotr und AppJobber vermitteln Unternehmen Arbeitskräfte für Minuten-Aufträge. Gezahlt wird der Gegenwert eines Schokoriegels. Das Geschäft boomt, auch weil für die Nutzer bislang noch der Spaß im Vordergrund steht.
Vor zweieinhalb Jahren gab Christian Salle im Schauspiel Frankfurt nicht nur den Polizisten Blocher in Dürrenmatts Physiker, sondern er übernahm im gleichen Stück noch zwei weitere Rollen. Ziemlich anstrengend. Und so kam diese simple Ablenkung damals ganz gelegen: Speisekarten abfotografieren, für einsfünfzig Lohn pro Foto. Erfolgsgeschichten beginnen anders, und als solche will Salle das auch nicht verstanden wissen. Ja, er mag diese Microjob-Sache wirklich sehr, aber sicher nicht nur wegen des Geldes. „Es ist ein Hobby mit dem Nebeneffekt eines relevanten Taschengeldes“, sagt er. Christian Salle ist haupt- und freiberuflicher Theaterschauspieler, mit Engagements in Berlin, Hannover und Frankfurt. Und nebenher ist er einer von 280.000 Nutzern der App Streetspotr, auf der Unternehmen „Microjobs“ vergeben. Salle ist nicht irgendwer im Streetspotr-Kosmos: Sondern zweiter in der User-Rangliste.
Junge technikaffine Nutzer
Die Nürnberger Streetspotr GmbH ist Marktführer unter den App-Anbietern für Microjobs, der zweite große Name in Deutschland ist AppJobber. Seit April 2012 – Christian Salle ist also von Anfang an dabei – gibt es solche Angebote in Deutschland. Sie vereinen technische Mobilität meist junger Menschen mit deren Wunsch, bei Gelegenheit einen kleinen, wirklich kleinen, Geldbetrag zu verdienen. Unternehmen schreiben ihre Microjobs aus, Nutzer können diese per App ansteuern und abarbeiten. Ein Beispiel: Als diese Zeilen geschrieben wurden, waren gerade 1,50 Euro abzusahnen. In der Cafeteria der TU Berlin sollte geschaut werden, ob „dort spezielle Coffee-to-go-Becher stehen und diese auch ausgeteilt werden“. Ein Angebot, das man ablehnen kann – ein Student der TU, der sowieso gerade einen Kaffee zum Mitnehmen holen will, sieht das aber vielleicht anders. Damit ist schon viel erklärt, weiteres sagt eine Streetspotr-Umfrage von 2012. 72 Prozent der Nutzer seien zwischen 18 und 29 Jahre alt, weitere 17 Prozent zumindest unter 39 (siehe Kasten Seite 43).
Man kann außerdem von technikaffinen Nutzern ausgehen. Technisch unbedarfte Smartphone-Nutzer können auch durchaus eine Stunde damit zubringen, die Streetspotr-App überhaupt zum Laufen zu bringen, die Zeit wurde persönlich gestoppt. Soll heißen: Streetspotr müssen tatsächlich Lust haben zu tun, was sie da tun. „Es ist wie eine Schnitzeljagd, eine sehr kurzweilige Art, sich was dazuzuverdienen und seine Stadt neu kennenzulernen“, sagt Christian Salle.
Die Frage, ob Streetspotr und Co. nicht doch der Wegbereiter für einen neuen Niedrigstlohnsektor sind, muss trotzdem gestellt werden, und einschlägige Experten finden darauf durchaus wenig euphorische Antworten. Zunächst aber ein Blick auf Dorothea Utzt, die dank Streetspotr sehr viel Geld verdient. Ihr gehört nämlich das Unternehmen. 33 Jahre alt ist Dorothea Utzt, studiert hat sie Germanistik auf Lehramt, in diesem Beruf aber nicht gearbeitet. Nach einem kurzem Ausflug in den Journalismus gründete sie 2007 zusammen mit zwei Bekannten eine Firma, die sich auf App-Programmierungen spezialisierte. Apps kamen damals gerade erst auf den Markt, Dorothea Utzt und ihre Kollegen waren unter den Pionieren. Sie kümmerte sich, bis heute, um das Marketing ihres Unternehmens. Die Idee zu Streetspotr entstand aufgrund eines Auftrags von BMW. Der Autobauer wollte sämtliche Tiefgaragen in Deutschland „mappen“ lassen, Öffnungszeiten, Parkebenen, Preise – Utzts Firma sollte sagen, wie man das am besten umsetzen könnte. „So entstand die Idee, das mit der Crowd zu machen“, also mit Hunderten von Smartphone-Nutzern. Es wurde 2011 dann nicht nur eine App entworfen, sondern auch das gleichnamige Unternehmen gegründet.
Für manche Aufgaben gibt es kein Geld
Das Prinzip ist heute das gleiche wie damals beim BMW-Auftrag, nur gibt es jetzt wesentlich mehr Auftraggeber. Rund 250 derzeit, darunter Red Bull und Sony, auf einen Anbieter kommen damit 1.000 Nutzer. Für jeden Job kriegt Streetspotr 50 Prozent Provision vom Auftraggeber. Das Unternehmen wächst. „Wir wollen expandieren“, sagt Dorothea Utzt, im kompletten deutschsprachigen Raum und in Großbritannien ist man schon vertreten, gerade kam Polen dazu. Im Frühjahr dieses Jahres stiegen die KfW-Bank und ein Investor mit einer „hohen sechsstelligen Summe“ in das Unternehmen ein. 14 Mitarbeiter werden derzeit beschäftigt, dazu ein paar Studenten.
Dass Dorothea Utzt Lohndumping unterstütze, glaubt sie nicht. „Der Spaß steht absolut im Vordergrund“, sagt sie. „Wem es nur ums Geld geht, der wird sich nicht bei uns anmelden.“ Im Schnitt zehn Euro monatlich verdiene ein Nutzer, maximal seien pro Jahr 1.500 Euro drin. Und ein exzessives Nachfrage-Angebot-System sei sowieso ausgeschlossen. Jeder eingestellte Job werde überprüft, darauf, ob er rechtlich und moralisch vertretbar ist und ob eine Mindestsumme gezahlt wird. „Wir schaffen einfach nur Zugang zu einem Markt, den es ohne unsere Technik gar nicht geben würde“, sagt Utzt. Sprich: BMW würde nicht auf die Idee kommen, eigene Mitarbeiter loszuschicken, um die Tiefgaragen der Republik zu beschauen. Christian Salle gehört zu den Intensivnutzern von Streetspotr. Für jeden erfolgreich ausgeführten Job bekommt man nämlich bei Streetspotr Punkte. Je mehr Punkte, desto höher der Rang. Manche Jobs, bis zu zehn Euro bringen die, kann man auch nur mit einer bestimmten Punktzahl annehmen. Und es gibt auch Aufgaben, für die es Punkte, aber kein Geld gibt. Zum Beispiel einen Park oder einen Dom zu fotografieren. Das ist die Sightseeing-Funktion von Streetspotr, Christian Salle schätzt die sehr. Kürzlich lernte er so ihm unbekannte Ecken Hamburgs kennen. Auch die Chatfunktion lobt Salle. Sie ermöglichte es ihm, als er 2012 noch in Frankfurt lebte, dort viele neue Leute kennenzulernen.
Man kann Salle abnehmen, dass Streetspotr für ihn keine Notlösung ist, und genauso gilt das wahrscheinlich für die Polizisten, die Ex-Unternehmensberater und Bahn-Angestellten, die Geschäftsführerin Dorothea Utzt als Intensivnutzer beispielhaft nennt. Doch sie weiß auch um das Streetspotr-Gegenstück aus den USA, die App Gigwalk. 650.000 Nutzer hat diese, bedient werden 6.500 Städte in ganz Nordamerika. Das Geldverdienen steht hier deutlich im Vordergrund, und für viele Nutzer ist es der Zweit- oder eben auch Drittjob. Dort ist zu beobachten, was Kritiker von Microjobbing als dessen Gefahren anführen: Zergliederung von Arbeit und damit verbunden die Auslagerung der einfachsten Tätigkeiten an Billiglöhner.
„Das alles folgt dem klassischen Prinzip der Arbeitsteilung in immer kleinere Einheiten“, sagt Franz Kühmayer, der Microjobbing „nicht für ein zukunftsfähiges Modell hält“. Der Informatiker und Physiker ist Strategieberater in Wien und Mitglied des Think-Tanks Zukunftsinstitut. Da beschäftigt er sich mit der Zukunft der Arbeit. Beim Microjobbing stehe immer die Frage im Vordergrund, wie Produktivität gesteigert werden könne bei gleichzeitiger Senkung der Lohnkosten, sagt er. Über kurz oder lang laufe dies, wenn irgendwie möglich, immer auf Automatisierung hinaus – oder Auslagerung von Tätigkeiten in Billiglohnländer. Beispiele seien Power-Point-Dienstleister in Indien oder Programme, die aus Rohdaten schon heute journalistische Texte herstellen können. „Auf lange Sicht haben solche Microjobs in Europa deshalb keine Chance zu bestehen.“ Örtlich gebundene Tätigkeiten freilich lassen sich schlecht nach Indien auslagern. „Angebote wie Streetspotr können als Nischenprodukt bestehen, aber nicht als gesamtwirtschaftlicher Trendsetter“, schätzt Kühmayer.
Das Marktprinzip zählt
Allerdings sollten Microjob-Dienste nicht völlig als irrelevant beiseite geschoben werden, ergänzt er. Es lohnt ein Blick auf andere Dienstleister, die nicht auf dem Smartphone, aber doch örtlich flexibel wahrgenommen werden können. Neu ist hier, dass zunehmend auch Tätigkeiten verschleudert werden, für die trotzdem eine akademische Ausbildung nötig ist. Manch ein Journalist zum Beispiel sieht sich zunehmend bedroht durch Angebote wie Textbroker, bei denen Schreibaufträge vergeben werden. Profis würden für einen Text, der die Länge des vorliegenden hat, knapp 50 Euro brutto bekommen. Anfänger in etwa 10. Das sind völlig neue Maßstäbe des Dumpings, mit denen auch Übersetzer und andere Geisteswissenschaftler konfrontiert werden, und künftig potenziell jede andere Berufsgruppe, in der es ein Arbeitskräfte-Überangebot gibt. Streetspotr passt da durchaus ins Bild: Auch hier ist der Zugang für mobile und technikaffine Menschen privilegiert, zum Lohn eines Taschengeldes.
„Das marktwirtschaftliche Prinzip steht bei solchen Angeboten im Vordergrund“, meint Werner Eichhorst, stellvertretende Direktor des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit in Bonn. Was natürlich auch heiße, dass gute Qualität wohl auch weiter einen guten Preis erlösen wird. „Bei unspezifischen Arbeiten kann durch Microjobbing aber durchaus Lohndumping befördert werden.“ Eichhorst glaubt genauso wenig wie Kühmayer, dass es sich „dabei um ein großes Phänomen“ handle. Zumal die kleinteilige Organisation von Arbeit „immer auch einen Koordinierungs- und Kontrollaufwand bedeutet, für den wieder Personal eingestellt werden müsste“. Microjobbing käme damit schlicht nur für sehr überschaubare Teile der Wirtschaft in Frage.
Christian Salle, der Schauspieler, kann wohl sicher sein, dass sein Berufsstand so schnell nicht durch Microjobber ersetzt wird, und er wird deswegen mit Vergnügen weiterhin „die fünf Euro einsammeln, die auf der Straße liegen“. Seinen Ehrgeiz stachelt derzeit aber die Nummer eins in der Streetspotr-Rangliste an. Er kennt den Mann – „leibhaftig“. Und er will ihn von der Spitze verdrängen. Die Konkurrenz schläft nicht, schon gar nicht unter Microjobbern.