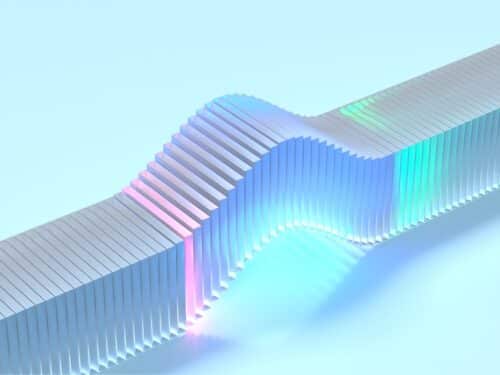Ein eklatanter Widerspruch prägt das, was man über die Generation Y, die „Millennials“ liest, hört und teilweise erlebt. Auf der einen Seite argumentieren Optimisten des gesellschaftlichen Wandels, dass mit dieser Generation ein neues Denken Einzug in die Unternehmen hält. Für sie stellt die „Generation why?“ die Sinnfrage im Unternehmen, lehnt Hierarchie ab, verlangt nach „Purpose“, will sich identifizieren und selbst verwirklichen. Demgegenüber nehmen viele Arbeitgeber diese Alterskohorte deutlich anders wahr, und die Kritik fällt stellenweise harsch aus. Millennials haben, so hört man mitunter, „nichts wirklich Nützliches gelernt“ und wollten dies auch gar nicht, da sie sich „für Arbeitsthemen nicht interessierten“. Sie seien zudem nicht kritikfähig und schnell demotiviert oder gar beleidigt. Nehmen wir für einen Moment an, beide Perspektiven träfen zu. Wo landeten wir dann?
Wer hat denn nun recht?
Millennials scheinen eine Erwartung nach dem Motto „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“ zu haben. Sie projizieren idealistische Motive auf den Arbeitgeber und erhoffen sich eine sinnstiftende Orientierungsfunktion ganz nach ihren persönlichen Vorstellungen. Zugleich wollen sie aber keine besondere Energie darauf verwenden, nach anderen als ihren Regeln dazu beizutragen. Den Widerspruch erkennen sie mangels Lebenserfahrung aber nicht. Sie kommen mit falschen Erwartungen, an denen sie natürlich scheitern müssen und schließlich unerfüllt oder sogar unglücklich im Job werden.
Demgegenüber treffen sie auf Arbeitgeber, die nicht nur fachliche Erwartungen haben, sondern sich auch Interesse an der Firma, Engagement und Commitment wünschen. Im Wettbewerb um Talente bemüht man sich dann durchaus mit allerlei Maßnahmen und Incentives, das erwartete „Wohlfühl-Klima“ zu erzeugen. Und verfällt dadurch auch in einen Widerspruch, nämlich die Millennials für Erwartungen zu kritisieren, die man selbst noch unterstützt. Das Millennium-Paradoxon, das man – Achtung, Spoiler – auflösen kann. Aber zuerst müssen wir uns von der Vorstellung lösen, dass Generationenmodelle uns in der Praxis weiterhelfen.
Generationenmodelle helfen der Praxis nicht
Auf die methodischen Unzulänglichkeiten von Generationenmodellen hat beispielsweise Anna-Leena Haarkamp hier auf HRM bereits hingewiesen. Und in einem sehr anschaulichen Video erklärt auch Prof. Uwe Kanning von der Hochschule Osnabrück, wo diese Modelle in der Praxis an ihre Grenzen stoßen. Der Kern der Kritik liegt darin begründet, dass wir eine Momentaufnahme von jungen Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt haben. Die haben zwar da gerade bestimmte Vorstellungen vom Leben – aber sind diese tatsächlich auch als Bewerber-Präferenzmuster nutzbar? Zwingend müssen wir deshalb eine Erkenntnis gegenüberstellen, die wir im Personalmanagement auch haben. Wir wissen: Mit 25 haben wir andere Bedürfnisse als mit 35 oder 45 Jahren. Kurz gesagt:
Lebensphase schlägt Generationenmodell.
Am besten sieht man das an jungen Menschen, die Eltern werden. In ihren Präferenzmustern als Mitarbeiter:innen unterscheiden sich Generation X und Y dann nämlich nicht mehr: Sie sind erst einmal Eltern mit einer ganz konkreten Lebenssituation, die es zu managen gilt. Gehen wir noch einen Schritt weiter und schauen uns die Generation Y an. Hier kommen die letzten Vertreter der Kohorte gerade erst auf den Arbeitsmarkt, während die ersten bereits in die Führungsetagen einziehen. Das Millennial-Paradoxon wird auf die Spitze getrieben, wenn die 40-jährige Führungskraft der Generation Y die 25-jährigen Absolventen der eigenen Kohorte dafür kritisiert, dass „die Punkt fünf den Rechner runterfahren und einfach abhauen“.
Was spricht gegen Idealismus?
Machen wir hier einen harten Schnitt. Ist Idealismus nicht schon immer ein Kennzeichen, wenn nicht das Kennzeichen der Jugend? Ex-Telekom-Vorstand Thomas Sattelberger, der heute für die FDP im Bundestag sitzt, war in seiner Jugend Funktionär einer kommunistischen Splittergruppe. Wenn man jung ist, hat man Power, will die Welt verändern. That’s life. Junge Leute kommen heute, bis an die Zähne bewaffnet mit Zeugnissen, Zertifikaten, Praktika und dem – wie sie glauben – „neuen und richtigen Wissen“ in die Unternehmen. Man kann darin Konfliktpotenzial und sogar Generationen-Sprengstoff sehen, man kann aber auch ganz praktisch überlegen, wie man damit umgehen sollte. Dazu muss man sich aber mit einem Thema fachlich auseinandersetzen, das in der Generationen-Diskussion nie wirklich thematisiert wird, aber die zentrale Größe ist: Identität.
Identität als Brücke
Wenn wir die Erwartungen beider Seiten nochmals als Begriffspaar direkt gegenüberstellen, dann wird der Graben plötzlich überbrückbar. Die einen rufen „Gib mir ein Identifikationsangebot“, die anderen verlangen „Gib mir Dein Engagement“. Natürlich, Engagement führt zu Identifikation. Ich arbeite gemeinsam mit anderen an einer Aufgabe, einer Herausforderung. Wir meistern sie und wachsen als Gruppe zusammen. Dann identifizieren wir uns. Arbeitgeber sollten aber dieses Engagement nicht zur Vorbedingung machen, denn das Ergebnis ist für junge Menschen in dieser Form nicht vorstellbar, und der Ansatz wird schlicht nicht akzeptiert.
Die Mechanik funktioniert aber umgekehrt: Identifikation führt zum Engagement und dann zum gemeinsamen Erfolg. Hier kommt der „Purpose“ ins Spiel. Er ist Bestandteil einer Identität, die junge Menschen suchen. Die Identität am Arbeitsplatz wird praktisch zum Konsumfaktor der Selbstverwirklichung. Non-Profit-Organisationen funktionieren übrigens schon immer so. Dort ist man Teil eines größeren Zwecks und bringt sich mit einem Engagement ein, von dem Unternehmen oft träumen. „Wir sind aber kein Non-Profit-Unternehmen“, denken Sie jetzt vielleicht. Müssen Sie auch gar nicht sein. „Purpose“ ist nur ein Teil der Identität, die sie anbieten. Eine Menge anderer Attribute und Komponenten zahlen darauf ein. Aber „Purpose“ ist eindeutiger Faktor der Arbeitgebermarkenbildung.
Fazit
Die Fokussierung auf die vermeintlichen Eigenschaften von Millennials in Generationsmodellen hilft nicht weiter. Analog zur Lebensphase besteht ein Bedürfnis nach Identifikation, das Unternehmen bedienen müssen. Eine unverwechselbare Identität herauszuarbeiten, ist ein Prozess, der aus Analyse der Unternehmenskultur heraus beginnt und dazu einen „Purpose“ erfordert. Diese Identität zielt darauf ab, ein starkes Zugehörigkeitsmotiv zu etablieren. Anders gesagt: Sie müssen selbst wollen, dass Menschen zu Ihnen gehören wollen.