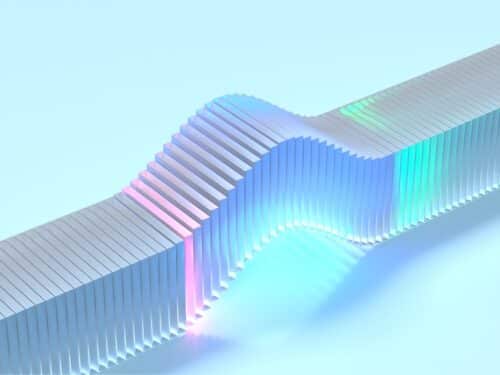Für den Lernerfolg ist die eigene Motivation ein entscheidendes Kriterium. Warum das so ist, wie die Sportpsychologie dabei helfen kann und warum er reine E-Learnings ablehnt, erklärt der Neurobiologe Martin Korte im Interview.
Es sind nicht mehr nur die Pädagogen oder Psychologen, die die Diskussion darüber, wie der Mensch am besten lernt, bestimmen. Besonders die Erkenntnisse der Hirnforschung finden zunehmend mehr Anklang. Martin Korte ist einer dieser Forscher. Der Neurobiologe der TU Braunschweig befasst sich unter anderem mit den zellulären Grundlagen von Lernen, Gedächtnis und Vergessen.

Lernen ist die Abspeicherung von Information, die zu Veränderungen des Denkens und Handelns führt und die von einem Individuum erfahren wird. Es geht also nicht aus Sicht eines Biologen darum, dass eine Art über Mutation etwas am genetischen Code verändert, sondern ein Individuum verändert sein Verhalten aufgrund einer Erfahrung, die es gemacht hat.
Welche Bedingungen sind dafür förderlich?
Beim menschlichen Lernen kommt es vor allem darauf an, ob das, was man lernt, gespeichert wird und ob es erinnert werden kann. Dafür sind Motivation und Konzentration entscheidende Faktoren, die etwas damit zu tun haben, welche Erwartungshaltung wir an eine Lernsituation haben. Wenn wir eine positive Lernerwartung haben, werden Botenstoffe freigesetzt, die die Abspeicherung der Information erleichtern und die es auch erwarten lassen, in einem zukünftigen vergleichbaren Kontext wiederum Informationen erfolgreich abzuspeichern. Das ist im positiven Sinne eine sich selbst verstärkende Spirale, die aber auch in die entgegengesetzte Richtung wirken kann.
Motivation ist also einer der entscheidenden Faktoren für den Lernprozess?
Man kann nicht sagen, dass man nur motiviert lernen kann – schließlich schafft man es auch, durch häufiges Wiederholen noch das Stumpfsinnigste irgendwann abzuspeichern – aber es fällt einem doch deutlicher leichter. Daher gilt: Wer versucht, die Motivationslage von Lernenden, egal ob Schüler oder Mitarbeiter, zu ignorieren, nimmt in Kauf, dass das Lernen zum Teil gegen die Gehirnmechanismen durchgeführt wird.
Was ist mit dem zweiten Punkt, der Konzentration?
In jeder Sekunde unseres Lebens strömen 400.000 Sinnesinformationen auf unser Gehirn ein, unabhängig vom Bildschirm, Tafelbild oder Buch. Das heißt, dass das Gehirn zu jedem Moment des Lernens genau wissen muss, worauf es ankommt, um eben die wesentlichen Eckpunkte eines Lernvorgangs besonders aufmerksam zu betrachten.
Wie erreicht man das?
Als Lerner muss man sich selber klarmachen, was der Kontext und das Ziel des Lernens ist. Das hat man aus der Sportphysiologie gelernt: Wenn man den Aufschlag richtig machen möchte, muss man sich immer den Endpunkt visualisieren und nicht jeden einzelnen Schritt. Und als Lehrender gilt es, die Inhalte in mehreren verschiedenen Formulierungen anzubieten und den Leuten zu zeigen, warum es wichtig ist, diese zu lernen. Es hat sich außerdem gezeigt, dass Wissen leichter vermittelt wird, wenn es an Bestehendes angebunden wird. Auch wenn das zunächst vielleicht mehr Zeit kostet. Und manchmal hilft es auch, den Kontext zu wechseln. Neues bewirkt Neugierde und Neugierde ist ein Zustand hoher Motivation.
Wie lassen sich da die neuen, vor allem digitalen, Lernmethoden einbinden?
Ich glaube, dass zum Beispiel E-Learning alleine nicht gut funktioniert. Menschen sind es gewohnt und evolutiv darauf ausgerichtet, in sozialen Gruppen zu lernen. Da spielt nicht nur der Lehrer als Person eine Rolle, sondern vor allem auch die Peers. Deshalb empfehle ich beim E-Learning immer, dass man personenzentrierte Lernereignisse hat, die durch E-Learning-Programme intensiv begleitet und nachhaltig verlängert werden. Diese haben nämlich wiederum den Vorteil, dass sie ganz individuell auf die unterschiedlichen Lernniveaus eingehen können. Aber ich warne davor, zu meinen, dass die Leute große Lernfortschritte dadurch machen, dass sie an ihrem Arbeitsplatz für 20 Minuten irgendein Lernprogramm durcharbeiten.
Aufgrund Ihrer Erfahrung, wie würden Sie berufliche Weiterbildungen konzipieren?
Ich würde den Leuten eine Fortbildung an einem anderen Ort empfehlen und schauen, dass diese eingebettet ist in spannende autobiografische Erlebnisse. Die Teilnehmer sollten auch außerhalb der Lernelemente etwas erleben. Denn das Gehirn speichert immer den Gesamtkontext einer Situation, nicht nur die einzelne Unterrichtseinheit. Das heißt, wenn Lernen zu einem Erlebnis wird, ist es viel einfacher, das Erinnerte anzuwenden. Und bezogen auf die Nachhaltigkeit würde ich darauf achten, dass das Gelernte immer wieder abgefragt und geübt wird. Öfter genutztes Wissen bekommt im Gehirn einen höheren Stellenwert.
Wenn Sie auf das Bildungswesen hierzulande schauen, haben Sie dann das Gefühl, dass die Erkenntnisse der Forschung ausreichend berücksichtigt werden?
Das ist ganz unterschiedlich. Erst einmal muss man sich klarmachen, dass es sich beim Schulstoff und bei Weiterbildungsangeboten meist um Dinge handelt, die der Mensch nicht von selber lernt. Man müsste da eigentlich bergauf arbeiten, sonst hätte man die Schule auch nicht erfinden müssen. Wenn man diese Randbedingung nimmt, würde ich sagen, dass die Rahmenbedingungen in der Schule schon grob erfüllt sind. Sie ist besser als ihr Ruf, bei Pisa liegen wir mittlerweile im oberen Mittelfeld, es ist also ein positiver Trend sichtbar. Auch wenn es noch Luft nach oben gibt.
Gibt es denn etwas, was man vom oft genannten PISA-Musterbeispiel Finnland diesbezüglich lernen kann?
Ich glaube, dass man am meisten aus Finnland lernen kann, dass es eine große Akzeptanz und Achtung dem Schulsystem und dem Lehrer gegenüber gibt. Daher wollen dort die Jahrgangsbesten Lehrer werden. Das ist in Deutschland anders. Daraus kann man auch etwas lernen für die Firmenkultur. Nämlich dass die Akzeptanz gegenüber Fortbildung vom Vorstand und von den Führungsebenen her gelebt werden muss. Wenn diese Wertschätzung da ist, ist auch die Aufnahmebereitschaft der Lernenden größer. Denn unser Gehirn kalibriert seine Leistungsfähigkeit immer dahingehend, was von ihm erwartet wird. Das kann man nutzen oder eben dagegen anarbeiten.
Wie ist da Ihre Einschätzung, wie sieht es in deutschen Unternehmen aus?
Mein Eindruck ist, dass sich die Firmen sehr stark darauf verlassen, dass Vorgesetzte als Mentoren fungieren, die offensichtlich gut in ihrer Arbeit sind und Erfahrungswissen weitergeben können, aber die relativ wenig darüber wissen, wie man Wissen so aufbereitet, dass es didaktisch gut weitergegeben wird. Da sehe ich noch mehr Bedarf, sich damit zu beschäftigen, wie der Mensch eigentlich lernt. Häufig habe ich eher den Eindruck, dass Kosten-Einsparungs-Analysen gemacht werden. Dabei wird dann festgestellt, dass E-Learnings preiswerte Programme für alle Mitarbeiter und alle Zeiten sind. Das macht sie aber nicht besser.
Heutzutage trägt vieles den Zusatz „Neuro-“. Sehen Sie da einen Hype, auch Ihr Fachgebiet betreffend?
Die Neurowissenschaften haben durchaus einen hohen Reiz. Und die Einbettung des Präfix Neuro- in verschiedene Kontexte wird schon etwas inflationär benutzt, zum Beispiel bei Neuroökonomie oder Neuroleadership. Da muss man immer nach dem Mehrwert fragen. Die Neurowissenschaften an sich haben bisher keinen Erklärungswert, den andere Disziplinen nicht haben. Was ich Ihnen zum Beispiel erzählt habe, hatte auch Elemente aus der Psychologie und der Pädagogik. Wenn man das so zusammendenkt, ist das kein Problem. Wenn aber ein Neurowissenschaftler meint, aufgrund seiner Disziplin andere Wissenschaftler belehren zu können und sich anmaßt, Experte auf einem Gebiet zu sein, dann stößt das oft ins Leere. Gerade fürs Lernen wird durch das Zusammenspiel ein Schuh draus.
Fünf Tipps, um Lernen effektiver zu gestalten
1. Ablenkung vermeiden. Das bedeutet zum Beispiel, alle elektronischen Geräte auszuschalten, weil das Gehirn sonst immer wieder den Lernfokus verliert.
2. Herausfinden, wann man am besten lernen kann. Denn jeder Mensch hat einen unterschiedlichen Tagesrhythmus, auch wenn erwiesen ist, dass die meisten Menschen zwischen acht und zwölf sowie zwischen 14 und 16 Uhr am effektivsten sind.
3. Lernpensum in mehrere kleinere Einheiten aufteilen.
4. Ausreichend schlafen. Denn all das, was man tagsüber lernt, wird nachts nochmal im Langzeitgedächtnis abgespeichert.
5. Lernen einbetten. Denn man lernt nicht nur Dinge, die Spaß machen und bei denen man hochmotiviert ist. Wenn man dies mit Tätigkeiten verknüpft, die man gerne macht, hilft das, das neu zu Lernende leichter zu verarbeiten.