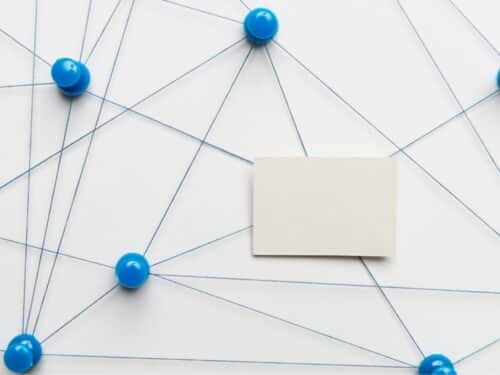Mittlerweile wird fast jede dritte Stelle über persönliche Kontakte besetzt. Unternehmen nutzen immer öfter digitale Empfehlungsprogramme für Neueinstellungen. Wird das Recruiting bald überflüssig?
Aus unserer Gesellschaft ist eine Empfehlungsgesellschaft geworden: Bevor wir etwas erwerben, schielen wir in einschlägigen Online-Portalen auf den Grad der Empfehlung, prüfen die vergebene Sternchenzahl und das Ranking. Es werden Bewertungen studiert, Erfahrungsberichte analysiert und nicht zuletzt der Freundeskreis kontaktiert. Aus dem Schlagwort Empfehlungsmarketing hat sich gleich ein ganzer Wirtschaftszweig entwickelt.
Das Urteil eines Freundes wiegt meist schwerer als eine anonyme Sternchen-Vergabe. Ihm vertrauen wir mehr als anonymen Rankings und Beurteilungen. Das nutzen Personaler: In Deutschland wird mittlerweile fast jede dritte Stelle über persönliche Kontakte, also Empfehlungen, besetzt. 30 Prozent der Neueinstellungen gehen damit auf das Konto des Empfehlungs-Prinzips.
Nur 14 Prozent der Einstellungen laufen über den traditionellen Weg der Stellenausschreibung in Printmedien. Zu diesen Ergebnissen kommt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). In Zeiten des Fachkräftemangels könnten damit Programme, die Empfehlungen digitalisieren, vereinfachen und beschleunigen, ein probates Hilfsmittel sein, um das personelle Defizit auszugleichen. „Jedes Unternehmen, das auch nur einen Anflug von Fachkräftemangel spürt, muss Mitarbeiterempfehlungsprogramme nutzen“, sagt Armin Trost, Professor für Human Resource Management an der Hochschule Furtwangen. „Das ist die wohl beste, mächtigste und erfolgreichste Recruiting-Maßnahme.“ Trost ist überzeugt, dass Anreize in Form von Geld- oder Sachprämien die Voraussetzung dafür sind, dass Mitarbeiter ihr Unternehmen weiterempfehlen oder sich eigens auf Kandidatensuche begeben. Wenn der Mitarbeiter zum Headhunter wird, wolle der schließlich für seinen Empfehlungsaufwand belohnt werden. Der Hochschulprofessor kenne kein einziges Unternehmen, das ein solches Programm erfolgreich nutze ohne gewisse Boni in Aussicht zu stellen.
Eigeninitiativ Umwerben
Auf dem Markt gibt es verschiedene Anbieter, die die digitale Hardware für solche Mitarbeiterempfehlungsprogramme liefern. Das Münchener Unternehmen Talentry ist eines von ihnen. Carl Hoffmann, einer der drei Geschäftsführer der digitalen Empfehlungsplattform, habe am Anfang noch viel Aufklärungsarbeit leisten müssen, als sie mit dem Programm 2013 an den Start gingen. „Heute ist es in Unternehmen viel gängiger geworden, aktiv und selbstständig Kandidaten anzusprechen“, sagt Hoffmann.
Der Markt habe sich stärker in Richtung Active Sourcing entwickelt. Unternehmen könnten nicht mehr einfach nur darauf hoffen, dass sich ein geeigneter Kandidat auf eine Ausschreibung bewirbt. Demografischer Wandel, generationale Unterschiede und der War for Talents zwingen Unternehmen, eigeninitiativ zur Tat zu schreiten.
Als einer der heutigen Gründer von Talentry in seinem alten Job bemerkte, wie schnell und einfach sich neue Mitarbeiter über Empfehlungen gewinnen lassen, wollte er wissen, ob das bei größeren Unternehmen auch funktioniert. Das Problem bestand darin, dass die Mitarbeiter oft gar nicht wissen, welche Stellen ausgeschrieben sind. „Sie bekamen von den analogen Mitarbeiterempfehlungsprogrammen nichts mit“, erzählt Hoffmann. So entstand die Idee zu einer Software, die jeder Mitarbeiter mobil nutzen kann und mit deren Hilfe eine Empfehlung digital über soziale Medien ermöglicht wird.
Die Kosten für die Talentry-Software variierten, abhängig von der Mitarbeiterzahl, zwischen 500 Euro monatlich bis hin zu mehreren tausend Euro bei großen global-agierenden Unternehmen. „Für jedes Unternehmen setzen wir eine individuelle Lösung auf: Es gibt eine Art eigene Webseite mit dem Firmenlogo, im Sinne der Corporate Identity gebrandet“, sagt Talentry-Gründer Hoffmann. Mitarbeiter registrieren sich auf der Seite, geben an, welche Stellen sie interessieren und erhalten einen Newsletter mit den entsprechenden Angeboten. Eine Ausschreibung kann dann als persönliche Nachricht verschickt oder in sozialen Netzwerken gepostet werden.
Dabei könnten die Unternehmen selbst entscheiden, welche Art der Belohnung sie für eine Weiterempfehlung ausloben: Sach- oder Geldprämie? Auch den Zeitpunkt der Honorierung legen die Firmen fest: direkt nach der Einstellung oder nach Abschluss der Probezeit?
Der Handelskonzern Otto nutzt die Empfehlungsplattform seit zwei Jahren. Zuvor wurde mit dem hauseigenen, analogen Programm „Finderlohn“ gearbeitet. Allerdings brauchte man schon bald ein Programm, das bereichsübergreifend im gesamten Unternehmen funktioniert und alle ausgeschriebenen Stellen erfasst. „Talentry liefert die externe Datenbank, auf die wir zurückgreifen. Dort sind alle Stellen verfügbar“, sagt Bennet Schlotfeldt, Referent im Talent & Performance Management des Handelskonzerns. Auch bei Otto wird mit Prämien als Anreiz gearbeitet: „Für Festanstellungen, die sich aus einer Empfehlung ergeben, gibt es als Grundprämie einen Warengutschein im Wert von 500 Euro. Für die Einstellung eines Kandidaten mit einem sehr speziellen, ‚spitzen‘ Profil gibt es Bruttoprämien bis zu 5.000 Euro.“ Selbst für die Besetzung einer Praktikantenstelle zahle der Konzern eine 250-Euro-Bruttoprämie.
Ratten und Rattenfänger
Doch wäre es nicht besser, wenn Mitarbeiter einer inneren Motivation folgend ein Unternehmen weiterempfehlen? Die Diplom-Psychologin und Karriereberaterin Madeleine Leitner, jahrelang selbst als Recruiterin tätig, sieht Prämien-Systeme äußerst kritisch: „Alles, was mit Anreizprogrammen zu tun hat, ist doch Rattenpsychologie. Die Leute erhoffen sich einen Vorteil, wenn sie an Prämienprogrammen teilnehmen. Ein Mitarbeiter sollte im eigenen und im Interesse des potentiellen neuen Kollegen eine Stelle und damit ja auch das Unternehmen empfehlen.“ Aus psychologischer Sicht seien diese Versuche zumindest anrüchig.
„Die meisten Firmen sind einfach schrecklich. Die Statistiken zeigen, dass nur wenige von sich aus gern zur Arbeit gehen und kaum jemand würde eine Empfehlung aussprechen, wenn es nicht diese Prämien-Programme gäbe“, sagt Leitner.
Selbst Arnim Wahls, Geschäftsführer von Firstbird, einem weiteren Anbieter digitaler Empfehlungsprogramme, sieht Prämien bis zu einem gewissen Grad kritisch. Wahls hat festgestellt, dass die Vergabe von Prämien stark von der jeweiligen Unternehmenskultur abhängt: „In einer Anwaltskanzlei erwarten Mitarbeiter eher, dass es hohe Geldprämien gibt, sonst macht da keiner mit. In einer NGO oder Kindernothilfe wiederum werden Geldprämien als unangebracht empfunden.“
Wichtig sei auch, dass der zeitliche Abstand zwischen Empfehlung und Belohnung derselben nicht zu groß werde. Warte ein Unternehmen, bis die Probezeit des auf Empfehlung vermittelten Kandidaten vorüber ist, könne kaum noch ein Zusammenhang zwischen Empfehlung und Prämie hergestellt werden. Das wiederum mindere den Anreiz, erneut eine Empfehlung auszusprechen. Zumal: „Geldprämien laufen üblicherweise über die Gehaltsabrechnung und unterliegen den entsprechenden steuerlichen Abgaben. Daher gibt es meist große Unterschiede zwischen der ausgeschriebenen Bruttoprämie und der Nettoprämie, die ein Empfehlender tatsächlich erhält“, sagt Wahls. Und in diesem Fall büße auch das Empfehlungsprogramm an Sichtbarkeit innerhalb des Unternehmens ein.
Pecunia non olet
Wirtschaftsprofessor Armin Trost rät Unternehmen ohnehin, eher Sachprämien zu vergeben, weil diese stärker im Bewusstsein blieben. Er glaubt allerdings auch, Mitarbeiter würden stets die Geldprämie einer Sachprämie vorziehen.
Trost eröffnet noch eine ganz andere Sicht auf monetäre Belohnungen: Ihm zufolge entschärfe eine solche Prämie im positiven Sinne das Gefühl der Verantwortung, das entstehe, wenn ein Mitarbeiter einen Kandidaten empfiehlt. „Man kann dem Ganzen mittels Geldprämien bewusst einen extrinsischen Charakter geben und dadurch zum Weiterempfehlen animieren“, sagt der Professor. Jeder hätte gerne die Prämie, und die Hemmschwelle zur Weiterempfehlung sinke mit der Aussicht auf das Geld. „Dann sage ich mir vielleicht: Gut, die Empfehlung war vielleicht nicht die beste, aber die 2.000 Euro waren es wert.“
Ausverkauf im Level-Modus
Doch leidet darunter nicht die Qualität einer Empfehlung? Nicht ohne Grund geistert bereits ein Raunen über den vermeintlichen „Ausverkauf der Empfehlungsprogramme“ durch die HR-Blogger-Szene. Befeuert wird die Kritik dadurch, dass manche Unternehmen selbst das reine Posten, also das Hochladen einer Stellenanzeige in den sozialen Netzwerken, honoriert.
Wahls Firma Firstbird bietet dementsprechend neben dem klassischen Sach- oder Geldprämienmodell auch ein Bonussystem an, basierend auf spielerischen Anreizstrukturen. „Für jede Aktion, wie das Teilen eines Jobs auf Facebook, bekommt man Punkte, die dann zu bestimmten Levels führen. Als Unternehmen könnte ich also sagen: Jeder, der Level zehn erreicht hat, bekommt eine Flasche Wein.“
Wahls glaubt, auf diese Weise die Motivation der Empfehlenden zu steigern, schließlich habe nicht jeder Mitarbeiter sofort den perfekten Kandidaten für einen Job. Aber jeder habe die Möglichkeit, eine Stelle in seinem sozialen Netzwerk zu teilen. „Das sollte man auch honorieren und wenn einer zwanzig Jobs auf Linkedin teilt und fünf tolle Kandidaten an den Interviewtisch bringt, dann hat er seine Leistung erbracht“, sagt Wahls.
„Der Mensch ist nur ganz Mensch, wo er spielt“, wusste der Dichter Friedrich Schiller. Gemäß diesen Mottos sieht Arnim Wahls in der Gamification, der Einbettung spielerischer Elemente, hier im Kontext der Personalbeschaffung, die Quelle der Motivation: „Bereits die Punkte sind Zeichen einer Wertschätzung des Empfehlenden.“ Er glaubt, der wichtigste Motivator sei neben der intrinsischen Motivation die Wertschätzung der Empfehlung und deren Kommunikation.
Wahls Konkurrent Carl Hoffmann lehnt ein solches Punktesystem ab. Er wolle den Fokus auf der Bewerberqualität legen: „Es wäre ein falscher Anreiz, schon die Reichweite eines Posts zu belohnen. Die Leute machen sich dann weniger Gedanken, welcher Kandidat wirklich gut passt.“ Der Begriff Empfehlung werde durch die Jagd nach Punkten verfälscht.
Auch Professor Trost ist kein Fan des Gamification-Ansatzes. Er glaubt, dass die Differenzierung eines Systems wie hier in Punkte und Level immer zu Unstimmigkeiten innerhalb von Gruppen führt. „Dann wird endlos diskutiert, weil sich immer jemand benachteiligt fühlt. Dann sagen die Einen: Das ist unfair, dass ich für das Posten auf Facebook nur drei Punkte erhalte und bei Xing vier Punkte. Müssen wir das nicht von den Likes abhängig machen? Je mehr Likes, desto mehr Punkte? Und wie viel zählt denn ein Like? Und dann diskutiert man sich zu Tode.“ Das sei mit Anreiz-Systemen schon immer so gewesen: Je gerechter, differenzierter und ausgeklügelter sie sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine ungerechte Behandlung vermutet und beklagt wird.
Adrian Podschus von Mitarbeiterwerben.de, ebenfalls einem Anbieter einer Empfehlungsplattform, hat die Erfahrung gemacht, dass viele Personaler auch gar nicht wollen, dass öffentlich wird, wie viel ein Mitarbeiter auf Facebook postet. Er räumt außerdem ein: „Wir erstellen auch aus Datenschutzgründen kein Ranking von Empfehlungen.“
Punkte sammeln mit Big Data
Das Thema Datenschutz ist im Zusammenhang von Mitarbeiterempfehlungsprogrammen nicht nebensächlich, schließlich wird jegliches Handeln, ob nun ein Post auf Facebook oder das Versenden einer Mail, mit dem Stelleninhalt gespeichert, neudeutsch: getrackt: „Immer, wenn jemand eine Stelle weiterempfiehlt, wird ein persönlicher Link generiert, über den sich dann nachvollziehen lässt, über welche Empfehlung jemand gekommen ist“, erklärt Talentry-Chef Hoffman.
Arnim Wahls von Firstbird, sieht in dieser Kontrolle einen Vorteil: „Erst durch diese Nachvollziehbarkeit, dadurch, dass ich sehe, wenn ein Mitarbeiter einen Job auf Facebook teilt, kann ich das auch honorieren“, so der Geschäftsführer.
Auch im Otto-Konzern nutzt man diese Möglichkeit des Datensammelns. Wenn Mitarbeiter eine Stellenausschreibung via E-Mail, Whatsapp, Xing, Facebook oder Facebook-Messenger verschicken, landen die Daten im Programm. „Wir können prüfen, welche Stellen Mitarbeiter über welche Kanäle posten. Das ist für uns wichtig, um herauszufinden wie wir später die Zielgruppen ansprechen können“, sagt Referent Schlotfeldt.
Nepotismus light?
Doch sollten sich Unternehmen und Nutzer vielleicht nicht nur mit der Frage, was alles gespeichert wird, beschäftigen. Es sollte auch eine Auseinandersetzung darüber stattfinden, wem all diese Informationen zugetragen werden und wem vielleicht gerade nicht. Schließlich ist es ein Unterschied, ob ein Bewerber über eine Empfehlung Eingang in den Vorstellungsprozess findet oder ob eine noch völlig unbekannte Person im Auswahlgespräch sitzt.
„Jemand, der empfohlen wird, hat ganz klar einen Vertrauensvorschuss“, sagt die Psychologin Madeleine Leitner, die selbst über 2.000 Kandidaten im Assessment-Center eines Unternehmens erlebt hat. Ein guter Personaler sei sich über seine unbewussten Vorannahmen im Klaren und sollte von einer Empfehlung besser erst einmal nichts wissen. „Bei ordentlichen Medikamententests weiß die Person, die das Medikament verabreicht, auch nicht, ob es sich um einen Placebo handelt. Das ist auch notwendig, weil diese Person sonst unbewusst etwas weitergibt.“ Leitner zählt drei Gründe auf, die oft hinter der Einstellung eines neuen Mitarbeiters stehen: „Jemand stellt eine Person ein nach dem Motto ‚eine Hand wäscht die andere‘. Das ist das, was man heute Netzwerken nennt.“ Dann gebe es noch die Möglichkeit, dass jemand eine Leiche im Keller hat und über den Gefallen einer Einstellung versuche Stillschweigen zu wahren. Und die dritte Möglichkeit ist: „Jemand empfiehlt jemanden aus Sympathie, das ist die beste Option“, sagt die Psychologin.
Bei der ersten von Leitner genannten Möglichkeit, über ein „Old-Boys-Network“ Eingang in eine Firma zu finden, geht es um das Thema Vetternwirtschaft. Ein System, in dem nicht Leistungen, sondern Beziehungen die Karriere befördern. „Vetternwirtschaft gab es schon immer. Firmen, die sich danach ausrichten, arbeiten auf Dauer nicht wirtschaftlich“, meint Leitner.
Professor Armin Trost sieht den Vorwurf der Vetternwirtschaft vor dem Hintergrund der Mitarbeiterempfehlungsprogramme gelassener. „Wenn ein Unternehmen unter Fachkräftemangel leidet, sage ich dann, wenn mir jemand empfohlen wird: Oh, das ist aber Vetternwirtschaft? Oder sage ich: Na, Gott sei Dank! Das Argument der Vetternwirtschaft verliert sofort an Gewicht, wenn sie nicht mehr ausreichend Bewerber kriegen.“
Doch entsteht einem Kandidaten ohne großes Netzwerk nicht ein Nachteil gegenüber einem womöglich extrovertierteren Mitbewerber, der es über seine Netzwerkkontakte ins Vorstellungsgespräch geschafft hat? „Zurückgezogene, latent autistische Personen, die Kontakte scheuen, finden selten Zugang zu einem Unternehmen über ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm. Das mag unfair sein. Es drängt sich aber auch die Frage auf: Wen will ich im Unternehmen haben? Menschen mit oder ohne Netzwerke?“, sagt Trost.
Wenngleich im Otto-Konzern der jeweilige Bereich, in dem eine Stelle vakant ist, nicht darüber informiert wird, ob der vom Personaler vorgeschlagene Kandidat empfohlen wurde oder nicht, kommt diesem Kandidaten aber doch eine gewisse Bevorteilung zu: „Er genießt den Status einer VIP-Bewerbung“, sagt Otto-Mitarbeiter Schlotfeldt. „Er durchläuft zwar alle Schritte im Bewerbungsprozess wie jeder andere, allerdings so, dass er den Prozess möglichst zügig beendet. Der Empfohlene hat den Luxus, dass er Personen des Unternehmens vorher schon kennt. Er hat schon Antworten auf Fragen, die man nicht unbedingt dem Recruiter stellen möchte, die aber doch interessant sind.“
Ähnlich divers
Dass der über eine Empfehlung eingeladene Kandidat bereits jemanden im Unternehmen kennt, mag auch aus einem anderen Grund einen faden Beigeschmack haben: Schließlich neigen Menschen dazu, jene Personen in ihrem Umfeld zu präferieren, die ihnen ähnlich sind. „Die Diversität ist immer in Gefahr“, sagt die Psychologin Leitner. „Führungskräfte finden diejenigen gut, die so sind, wie sie selbst. Sie reproduzieren sich gerne, wenn nicht jemand gegensteuert.“
Professor Armin Trost findet die Kritik an einer möglichen Monokultur der Belegschaft zwar berechtigt. Dennoch ist er überzeugt, dass sich automatisch eine ganz natürliche Diversität einstelle: „Ich glaube sogar, dass sich über eine Empfehlung die Diversität erhöhen lässt, weil Mitarbeiter breitere Zugänge zu Netzwerken haben. So viele unterschiedliche Menschen kann eine Stellenausschreibung kaum erreichen.“
Zumal: Eine Empfehlung kann auch Personen den Weg ins Bewerbungsgespräch ebnen, die vielleicht nicht den perfekten Lebenslauf oder das beste Zeugnis vorweisen können, aber durch eine andere, womöglich für die jeweilige Stelle wichtigere Expertise oder Persönlichkeit, genau die oder der Richtige für die Aufgabe wären.
Hat es ein empfohlener Bewerber erst einmal ins Unternehmen geschafft, überwiegen meist die Vorteile, sagt Carl Hoffmann von Talentry: „Studien zeigen: Leute, die über eine Empfehlung kommen, bestehen viel häufiger die Probezeit und sind meist besser als die Kandidaten, die sich auf herkömmlichen Wegen bewerben. Auch das Ankommen im Unternehmen, der Onboarding-Prozess, funktioniert reibungsloser.“ Hoffmann ist sich sicher, dass das Fehlbesetzungsrisiko wesentlich geringer ausfällt.
Firstbird-Gründer Arnim Wahls bestätigt diesen Eindruck: So seien empfohlene Kandidaten um 25 Prozent produktiver, hätten eine 15 Prozent geringere Wahrscheinlichkeit zu kündigen beziehungsweise gekündigt zu werden und sie blieben um 25 Prozent länger im Unternehmen.
„Mitarbeiterempfehlungen sind schon ein sehr guter kultureller Filter“, so Wahls. Und nebenbei sei die Methode günstiger für die Unternehmen: „Von statistisch gesehenen 3,75 Empfehlungen wird eine Person eingestellt. Das ist für den Recruiter im stressigen Alltag sinnvoll: Er bekommt wenige Bewerbungen, die alle sehr gut passen.“
Die Zukunft des Personalers
Er glaubt, dass die traditionellen Wege des Recruitings über Personalberater und Jobbörsen nicht mehr funktionierten. Doch was bedeutet eine solche Zunahme der Nutzung digitaler Mitarbeiterempfehlungsprogramme für Personaler? Wird das Recruiting überflüssig?
„Ich sehe HR ganz stark als Community Manager. Die Personaler müssen es schaffen, eine Community, aus der auch Kandidaten geschöpft werden, aufzubauen, zu managen und aktiv zu halten.“ Neben dem Aufbau eines Empfehlernetzwerks sieht Wahls die Zukunft der HR im Qualitätsmanagement: Der Personaler müsse schließlich weiterhin die endgültige Entscheidung über die Einstellung eines Kandidaten treffen.
Genau an diesem Punkt setzt die Psychologin und Beraterin Madeleine Leitner mit ihrer Kritik an: Unternehmen verfügten über immer weniger mutige Personaler, die ihr Handwerk verstehen. Früher hätten in einer Firma wie Siemens noch 30 Personaler und Psychologen gearbeitet. „Heute haben sie nur noch Quereinsteiger und Leute, die von Psychologie keine Ahnung haben. Ein Betriebswirtschaftler ist noch lange nicht versiert in der Personalauswahl“, resümiert Leitner.Sie glaubt, dass in Zeiten von Big Data ein Computer vielleicht sogar kompetenter sei als der heutige Personaler. Ohne psychologische Grundkenntnisse könnten Personaler vielleicht irgendwann gänzlich durch Automaten ersetzt werden, vermutet sie.
Für den Durchblick in der Mitarbeiterauswahl müssen HRler methodische Kompetenzen erwerben und Instrumente erlernen, um Wahrnehmungsfehler gegebenenfalls zu erkennen und gegenzusteuern. Gerade dann, wenn der Reiz eine Empfehlung auszusprechen, vielleicht eher in der Prämie begründet liegt als darin das eigene Unternehmen zu unterstützen und sein Arbeitsumfeld mitzugestalten.