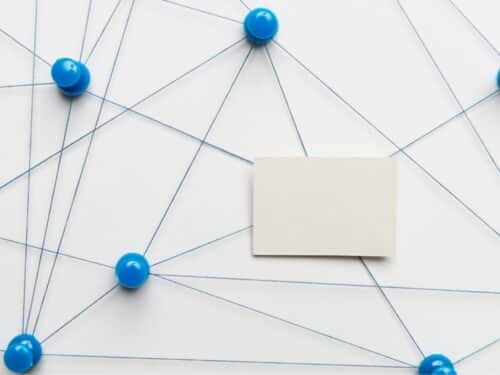Die Meinungen über anonymisierte Bewerbungsverfahren gehen auseinander. Dabei sind die meisten der Ansicht, dass allein die Qualifikation zählen sollte und sonst nichts. Das spricht eher für eine anonyme Bewerbung, doch es gibt einige Argumente, warum die Bewerbung ohne persönliche Attribute nicht die Lösung sein kann.
Das Problem beginnt bereits beim stark erhöhten administrativen Aufwand für anonymisierte Bewerbungen. Selbst Zeugnisse und Arbeitsnachweise müssten vollkommen anonymisiert werden. Entweder müssten sich tatsächlich alle Bewerber an das Schema halten und füllen dafür einen vorgefertigten Personalbogen aus oder es müsste eine Kontaktstelle zwischengeschaltet werden, die die Anonymisierung übernimmt.
Einfluss anonymer Bewerbungsverfahren
Ob sich dieser Aufwand im Hinblick auf die zu erwartenden Ergebnisse lohnt, ist stark zweifelhaft, wie verschiedene Untersuchungen zeigen. In Schweden hat man beispielsweise bereits 2007 geprüft, ob sich durch anonymisierte Bewerbungen ein anderes Einstellungsverhalten ergibt. Das Ergebnis war mit Ausnahme einer geringfügig gestiegenen Frauenquote ernüchternd. Auch in Deutschland gab es eine Pilotstudie in Zusammenarbeit mit dem Institut zur Zukunft der Arbeit. Hier beteiligten sich aber nur acht große Unternehmen wie die Deutsche Telekom oder Procter & Gamble, die nach eigenen Angaben ohnehin schon auf eine große Diversität bei der Einstellung achten. Alle Studien haben gemeinsam, dass selbst wenn mehr Frauen oder Bewerber mit Migrationshintergrund zu Vorstellungsgesprächen eingeladen wurden, sich die letztendliche Einstellungsquote nicht oder nur kaum änderte.
Anonymität im World Wide Web?
Fragt man die Bewerber, wie bei unserem unicensus kompakt unter gut 1.000 Studenten, sprechen sich dennoch 43 Prozent für ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren aus.
Dieser Punkt ist insbesondere interessant, weil die an der Umfrage Beteiligten größtenteils zur Generation Y gehören. Viele dieser Digital Natives pflegen ganz selbstverständlich Profile auf sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter. Laut einer aktuellen Studie von Deloitte, Fraunhofer und dem Hasso Plattner Institut geht die Generation Y freigiebig mit Daten um. So heißt es in den Ergebnissen: „Die Generation Y lebt die ,Share Economy‘, auch hinsichtlich ihrer persönlichen Daten und vor allem wenn ihnen ein monetärer oder persönlicher Nutzen in Aussicht gestellt wird. Die älteren Generationen dagegen lassen sich ungern auf solche Deals ein – sie teilen nur, wenn transparent ist, was mit ihren Daten passiert.“ Betrachtet man dies, überrascht die Zustimmung fast der Hälfte der Bewerber zu einer stärker anonymisierten Vorgehensweise. Bei vielen mag es daran liegen, dass sie noch zu wenige Erfahrungen mit der Berufswelt gesammelt haben und daher nicht direkt die Brücke zwischen dem sozialen Netzwerk und einer zukünftigen Anstellung schlagen.
Dieser Sachverhalt ist bei Netzwerken wie Xing bereits anders. Hierbei ist der Fokus ganz klar auf berufliches Netzwerken ausgelegt. Das zeigt sich auch an der Altersverteilung der Nutzer: Über 71 Prozent der Xing-Nutzer sind mindestens 35 Jahre alt und damit bereits zumeist im Beruf angekommen, selbst mit Studium. Für jüngere Menschen ist dieses Karrierenetzwerk noch nicht so interessant, ihre beruflichen Ambitionen müssen sich erst noch entwickeln. Einige Studenten schätzen allerdings die gute Sichtbarkeit ihrer Qualifikationen und Leistungen für Unternehmen und damit potenziellen Arbeitgebern im Web, denn etwa 21 Prozent der Xing-Nutzer sind zwischen 25 und 35 Jahre alt und acht Prozent sogar zwischen 15 und 24 Jahre. Es macht nicht die Mehrheit aus, zeigt aber, dass auch bei den jüngeren bereits Interesse an der Veröffentlichung ihrer Daten für berufliche Zwecke erwacht ist. Auch ergab der unicensus kompakt, dass ein Drittel der Studenten ein anonymes Bewerbungsverfahren strikt ablehnt. Die Studenten möchten, dass ihre persönlichen Daten übermittelt werden und erhoffen sich keine Vorteile von einer Anonymisierung, vermuten sogar eher Nachteile dadurch.
Ein bisschen anonym reicht auch
Unklar bleibt in diesem Zusammenhang allerdings, wie genau das Verfahren in der Praxis aussehen könnte. Sollte sich eine Forderung nach anonymisierten Bewerbungsverfahren durchsetzen, wie von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewünscht, wäre eine weniger extreme Form der Anonymisierung eine praktikable Lösung. Anstelle von allen personenbezogenen Daten, würde es schon genügen, kleine Änderungen im Verfahren herbeizuführen. Ein Foto leistet beispielsweise keinen Beitrag dazu, einen Kandidaten einzustufen und sorgt nur dafür, dass möglicherweise unterbewusste Vorurteile zum Tragen kommen, die eine objektive Bewertung des Bewerbers verfälschen. Bekommen Personaler heute aber eine Bewerbung ohne Foto, fragen sie sich, ob gewollt oder nicht, warum dieser Bewerber das Foto weggelassen hat. Um das Foto generell aus Bewerbungen zu entfernen und damit eine zu starke unterbewusste Vorauswal zu fördern, könnte eine flächendeckende Vorschrift eine Art „Fotoverbot bei Bewerbungen“ durchsetzen.
Ebenso wäre es sinnvoll, während der Bewerbungsphase Online-Tests anzubieten, die die erforderlichen Qualifikationen abklopfen. Auf diesem Weg hat jeder, unabhängig von Geschlecht oder Herkunft, die Chance, seine Qualifikationen unter Beweis zu stellen. Denn wenn die Testergebnisse allein entscheiden, ob man zu einem persönlichen Gespräch eingeladen wird oder nicht, ist eine anonyme Bewerbung auch nicht mehr notwendig.