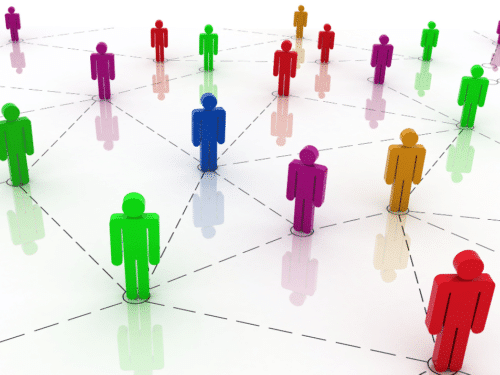Im Personalmanagement wird Big Data in doppelter Hinsicht unterschätzt: Einerseits sind die Analysemöglichkeiten bereits mit heutigen Technologien wesentlich mächtiger als landläufig gedacht, andererseits die daran ansetzenden Probleme deutlich größer, als es die aktuelle Diskussion vermuten lässt.
Joe Kaeser erklärt bei der Vorstellung seiner neuen Geschäftsstrategie: „Jede große Siemens-Turbine enthält 1.500 Sensoren – und jede hat etwas zu sagen.“ Das klingt interessant. Ebenso könnten wir die Datenpunkte ermitteln, die ein Mensch im Laufe seines Lebens generiert und diese dann für das betriebliche Personalmanagement nutzen.
Und genau das passiert gegenwärtig: Technikverliebte Informatiker auf der Suche nach algorithmischen Perspektiven und technikunkundige Personalmanager auf der Suche nach einfachen Antworten auf schwere Fragen übertreffen einander zurzeit in Lobpreisungen auf Big Data. Es geht scheinbar nur noch um das „Wie“. Personalwirtschaftliche Skeptiker werden dabei in die Schublade „Digital Naive“ abgelegt, die nicht in der Lage sind, die Zeichen der Zeit zu verstehen und stattdessen irgendwelche Zeichen an der Wand als Warnung zu erkennen glauben.
Was passiert, wenn Joe Kaeser Big Data nutzt, um genau die 10.000 Mitarbeiter zu lokalisieren, die er vielleicht gerade freisetzen will? Oder seine Vision von einem „neuen Google“ auch für Mitarbeiter und Kunden – also generell für Menschen – umsetzt? Vielleicht findet man dann sogar Querbeziehungen von der Medizintechnik zur Personalberatung?
Big Data als Allzweckwaffe
Gerade im Personalmanagement gibt es Entscheidungen mit großer Tragweite, für die entsprechende Methoden nicht unbedingt fehlen, die wohl aber ein umständlich hohes Maß an personalwirtschaftlichem Wissen voraussetzen: Und je weniger professionelle Personaler in den Personalabteilungen übrig bleiben, umso mehr steigt der Wunsch nach der Allzweckwaffe Big Data aus der Informatik und es wird klar, warum viele in der HR-Community Big Data begrüßen, ohne es zu verstehen.
Genau dieses „Verstehen“ ist aber wichtig, denn Big Data hat zwei durchaus diskutierbare Bestandteile:
Zum einen bezieht sich Big Data auf die Datenbasis. Da geht es um die Nutzung von allen Daten, die erreichbar sind: Bestellungen in der Kantine, über Amazon gekaufte Bücher, Daten der Krankenkasse, Kreditkartenabrechnungen, Reisedaten im Navigationssystem, Dokumente auf Servern und in der Cloud, persönliche E-Mails, Flickr- oder Snapchat-Fotos, Facebook-Einträge, WhatsApp- und Twitter-Nachrichten, und vieles mehr, was man sich lieber nicht vorstellen möchte.
Zum anderen bezieht sich Big Data auf Algorithmen. Sie können alle Arten von Daten verarbeiten, oder wie es ein Anbieter ausdrückt: „Dabei spielt es keine Rolle, ob diese strukturiert, unternehmensspezifisch oder öffentlich sind. Der Service analysiert Text, Audio und Video ebenso wie Social Media, Satelliten- und Wetterdaten.“ Dementsprechend resümiert die New York Times diese Logik wie folgt: „Wir sammeln einfach mal und werden schon irgendetwas in den Daten finden.“
Auf diesen beiden Beinen steht jetzt Big Data als der Big Brother, der beispielsweise bei der Personalbeschaffung hilft:
Er hilft beim Soll-Profil, wenn er Charakteristika erfolgreicher Mitarbeiter vergleicht. Hier können Wohnort, Kinderzahl, Heimatuniversität und bevorzugte Sportarten ebenso beitragen wie Ernährungsgewohnheiten, Arbeitszeitverhalten und abonnierte Zeitschriften. Aber auch komplexere Analysebereiche (wie zum Beispiel der Schreibstil) liefern Anhaltspunkte zum optimalen Mitarbeiter.
Hilfe beim Recruiting
Dann hilft er bei der Kandidatensuche. In der weiten Welt der sozialen Medien gibt es diverse Datenspuren von verborgenen Rohdiamanten: Wer hat sich zu einem bestimmten Thema geäußert? Wer taucht auf welchen Teilnehmerlisten auf? Wer ist auf welchen Fotos „markiert“?
Und schließlich hilft er bei der Kandidatenbewertung, also bei der Ermittlung von Stärken und Schwächen potenzieller Kandidaten. Hierzu lassen sich aus den Daten der Kandidaten ihre Bewegungsprofile quer durch die sozialen Netze erstellen, woraus man dann auf Persönlichkeitsstrukturen schließt.
Durch Big Data lässt sich also die Beschaffungsqualität verbessern. Denn natürlich ist es interessant, wenn man per Zufall auf einen Zusammenhang zwischen Pendelzeiten und Arbeitszufriedenheit stößt. Oder wenn man merken würde, dass Frauen mit einer Vorliebe für Rosamunde Pilcher viel mehr Elternzeit beanspruchen als solche, die Filme vom Typ „Erin Brockovich“ bevorzugen. Deshalb mehren sich die Protagonisten, die den flächendeckenden Einsatz von Big Data im Personalmanagement fordern. Dies beginnt beim Durchleuchten des Bewerbers und reicht über Karriereentscheidungen bis zu Themen wie Low-Performer.
Big Data ist für informatiknahe Forscher ein faszinierendes Feld: So hat der Autor dieses Meinungsbeitrags bereits vor über 30 Jahren mit mustererkennenden Computer-Algorithmen zur Unterstützung der Personalarbeit experimentiert. Vielleicht erklärt das eine gewisse Sensibilität für dieses Thema vor allem beim Einsatz dessen im Personalmanagement.
Ethische Fragen
Zum einen wirft die grenzenlose Datenbasis Probleme auf. Ist es okay, wenn man einen Kandidaten googelt oder auf Facebook sucht? Oder ihn in der Social-Media-Welt ausforschen lässt und einen „Background-Check“ in Auftrag gibt? Oder will man sogar eine DNA-Analyse? Bereits nach Datenschutz- und Mitbestimmungsgesetz scheidet vieles aus, was zurzeit propagiert und auch praktiziert wird. Hinzu kommt die ethische Frage. Denn es gibt informationelle Selbstbestimmung, einen Persönlichkeitsschutz und ein Postulat nach Aufklärung („Informed Consent“).
Zum anderen geht es um die Verarbeitungsverfahren, also um die ansetzenden Analysen und die daraus zu ziehenden Schlüsse. Denn was bedeutet es, wenn man einfach mal auf Verdacht und gut Glück bestimmte Themen erforscht? Gerade die (induktiv) lokalisierten Zusammenhänge zwischen scheinbaren Ursachen und scheinbaren Wirkungen sind problematisch. Zudem ist die von Einzelaktionen auf die Grundgesamtheit schließende Analyse („Predictive Analytics“) aus ethischer Sicht problematisch.
Außerdem ist es ein weit verbreiteter Irrglaube, dass inflationäres Anwachsen von Datenmüll die Personalarbeit verbessert. Empirisches Arbeiten bedeutet nicht, möglichst viele Daten zu erheben: Einige wenige gute Daten, reliabel erhoben und valide genutzt, sind der bessere Weg.
Gute Personalarbeit funktioniert nicht nach dem Prinzip „Google“, bei dem man statt „Wissen“ und „Denken“ auf „Durchsuchen“ und „Interpretieren“ setzt. Die Grundprinzipien professioneller Personalarbeit gelten auch für HR-Analysen. Dazu gehört die konsequente Nutzung von wissenschaftlich untermauerten Erkenntnissen als Startpunkt für Untersuchungen.
Deshalb brauchen wir im Personalmanagement statt unreflektierten Jubelorgien mit paradoxen „Erfolgsgeschichten“ dringend einen ethischen Diskurs über unaufweichbare Anwendungsgrenzen und einen methodischen über zulässige Analyseverfahren: Das sind wir der Relevanz personalwirtschaftlicher Fragestellungen und dem besonderen Charakter der „Human Resources“ schuldig.
Denn Mitarbeiter sind etwas anders als die Maschinen von Joe Kaeser, bei denen man beliebig Daten sammelt und auswertet: Eine an dieser Erkenntnis ansetzende Personalarbeit ist zwar schwierig, dafür aber ethisch korrekter und betriebswirtschaftlich erfolgreicher.