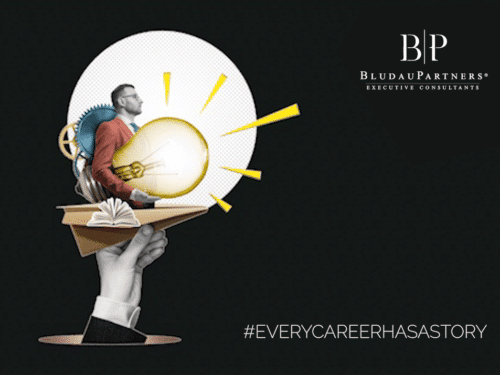Der Silicon-Valley-Experte Christoph Keese macht in seiner Keynote auf dem Personalmanagementkongress klar, was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt.
Fast schien Christoph Keese ein wenig entsetzt, als er das Publikum fragte, wer beruflich schon mal im Silicon Valley gewesen sei, und weniger als fünf Prozent sich meldeten. „Das zeigt, wie ernst die Situation ist“, schließlich dominierten die dortigen Firmen seit 30 Jahren das Internet, sagte der Executive Vice President von Axel Springer in der Eröffnungskeynote auf dem diesjährigen Personalmanagementkongress. Die Digitalunternehmen aus Kalifornien haben gezeigt, dass sie ganze Geschäftsfelder zerstören und Branchen auf den Kopf stellen können. Und sie tun das im Vergleich beispielsweise zu deutschen Unternehmen mit relativ geringen Kapitalinvestitionen. Uber besitzt keine Autos und bedroht die Taxibranche. Airbnb besitzt keine Hotels und bietet weltweit die meisten Übernachtungsmöglichkeiten an. Und Facebook ist mittlerweile die größte Medienfirma der Welt ohne selbst Inhalte zu produzieren. Das tut dem gelernten Journalist Christoph Keese besonders weh, wie er sagte. Aber Keese ist kein Freund des Jammerns. 2013 wollte er herausfinden, was da aus „dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt“ und reiste mit anderen Axel-Springer-Managern für mehrere Monate ins Silicon Valley. Über seine Erfahrungen schrieb er anschließend das Buch „Silicon Valley“, was zum Bestseller wurde.
Keese warb eindringlich dafür, sich mit der Digitalökonomie auseinanderzusetzen. Die zehn wertvollsten Unternehmen der Welt seien amerikanisch und fünf davon Digitalunternehmen. Das wertvollste deutsche Unternehmen, nämlich Bayer, folgt erst auf Platz 66. Deutschland habe in Bezug auf die Digitalisierung einen Fehlstart hingelegt, so Keese.
Zwei Grundgesetze bestimmen die Digitalökonomie: Disruption und Plattformen. So seien beispielsweise CDs eine erhaltende Innovation gewesen, keine disruptive, weil Produktion und Vertrieb ähnlich sind wie bei Schallplatten. Hingegen sind Streaming-Dienste wie Spotify eine disruptive Innovation, weil sie den Handel unnötig macht und der Kunde für lächerlich wenig Geld beinahe die ganze Musik der Welt hören kann. „Disruptoren schauen auf Ineffizienzen im System, sagte er. Keese plädierte dafür, sich das Genervtsein nicht abzugewöhnen, weil es die notwendige Bedingung ist, diese Ineffizienzen abzustellen und etwas völlig Neues zu entwerfen. Die Disruptoren machen genau das: Sie fragen, was nervt und, was nervt den Kunden an dem und dem Geschäftsmodell und wie können wir es besser machen?
Der Buchautor machte aber auch deutlich, dass es für etablierte Unternehmen schwierig sei, sich selbst disruptiv anzugreifen, weil sie die Konstrukteure der eigenen Ineffizienzen sind. In der Regel werden rationale Entscheidungen getroffen, die inkrementelle Innovationen und mehr Umsatz im Fokus haben – und so irgendwann die Firma ins Aus schicken. „Steve Jobs hat nie Marktforschung betrieben“, so Keese. Doch er hat die Ineffizienzen in bestehenden Systemen erkannt – und er hat groß gedacht. So wie es auch die Gründer an der amerikanischen Westküste tun.
Für den Journalisten ist völlig klar, dass in dem gegenwärtigen Wirtschaftsumfeld, das enorm komplex geworden ist, hierarchische strukturierte Unternehmen an ihre Grenzen stoßen. In Zeiten, in denen Entwicklungen exponentiell passieren, wisse auch ein CEO nicht mehr, wo es langgeht, sagte Keese. Netzwerke seien deshalb die bessere Organisationsform. Und Chefs haben die Aufgabe, die Prozesse zu organisieren, um mögliche Antworten auf die Komplexität zu finden.