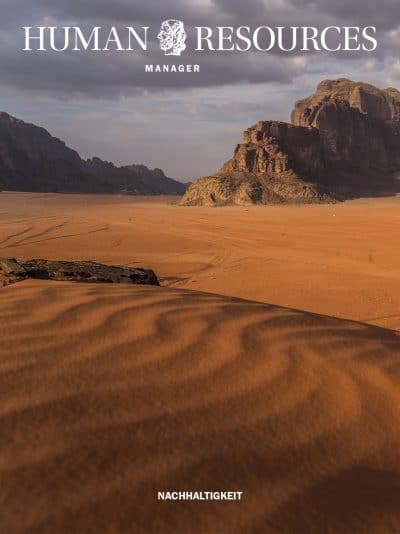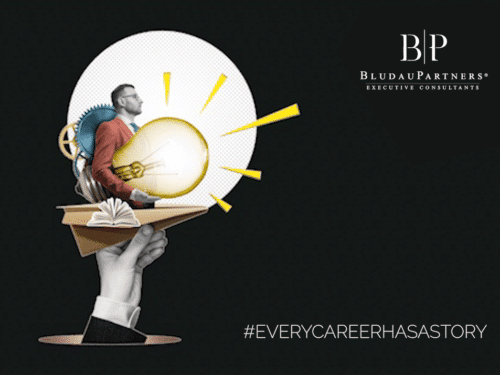Hossein Khavari bemüht sich, freundlich zu sein. Bei der Begrüßung beugt er sich lächelnd leicht nach vorne, so als sei er seinem Gegenüber zu tiefem Dank verpflichtet. Nur in unbeobachteten Momenten sieht der 24-Jährige nachdenklich aus. Seine Gedanken scheinen abzuschweifen. Doch spricht man ihn an, ist sofort das freundliche Gesicht wieder da und er beginnt in schnellem, etwas holprigem Deutsch seine Geschichte zu erzählen.
„Ich bin in Afghanistan geboren und habe 19 Jahre im Iran gelebt“, sagt Khavari. Seit 2016 sei er in Deutschland. Weshalb er sich Richtung Europa aufgemacht hat, erklärt er nicht. „Ich war monatelang unterwegs“, sagt er. Zu Fuß, mit dem Auto, mit dem Bus, mit dem Schiff – durch die Türkei, Griechenland, Schweden. Schließlich ist er in Deutschland angekommen. Hier gefalle es ihm sehr gut. Er sei im Iran sechs Jahre zur Schule gegangen. Seine ersten Joberfahrungen habe er aber erst in Deutschland gemacht. „Ich habe zuerst ein Praktikum in der Pflege gemacht und dann in einem Möbelladen gearbeitet“, sagt er. Doch wegen mangelnder Deutschkenntnisse reichte es in beiden Fällen nicht für eine Festanstellung. Erst 2018 fand er bei der Gegenbauer Unternehmensgruppe etwas Längerfristiges. Hier macht er seitdem eine Ausbildung zum Gebäudereiniger. Das sei sein Traumjob. „Ich liebe Sauberkeit.“
Größtes Problem: Sprachkenntnisse
Hossein Khavari ist einer von vielen Menschen, die seit 2015 in die Bundesrepublik kamen. Ende 2018 lebten 1,1 Millionen anerkannte geflohene Männer und Frauen in Deutschland. Die Mehrzahl von ihnen kommt aus Syrien, gefolgt von Irak und Afghanistan. Die meisten Asylanträge werden laut Arbeitsagentur von jungen Männern gestellt, die jünger als 35 Jahre alt sind.
Eigentlich ein gutes Alter, denn vor ihnen liegen noch viele Arbeitsjahre. Zumal etliche deutsche Unternehmen dringend Nachwuchskräfte suchen. Doch die Beschäftigungsquote bei Geflüchteten liegt laut Arbeitsagentur gerade einmal bei 25 Prozent. Für ausschließlich deutsche Arbeitnehmer gilt indes eine Beschäftigungsquote von 70 Prozent. Der Grund für die niedrigere Quote bei Geflüchteten: Meistens führt ihre Jobsuche ins Leere, weil es an Deutschkenntnissen mangelt oder die nötigen Berufsabschlüsse fehlen. Manchmal ist beides der Fall. So steht es zumindest in einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Die Sprache sei tatsächlich oft ein großes Problem, bestätigt Claus Kohls, Personaldirektor der Gegenbauer Unternehmensgruppe. „Wir beschäftigen uns schon seit 60 Jahren mit dem Thema Integration“, sagt er. Dass Menschen aus dem Ausland nach Deutschland kommen und hier Arbeit suchten, sei kein Phänomen, das erst seit 2015 Einzug gehalten habe. Als in den Sechzigerjahren Vollbeschäftigung herrschte und Gastarbeiter aus Südeuropa angeworben wurden, waren fehlende Sprachkenntnisse auch schon ein Thema: „Damals hat Gegenbauer Simultanübersetzer um Hilfe gebeten. Bei Behördengängen war immer jemand vom Unternehmen dabei und die Arbeiter lebten in firmeneigenen Wohnheimen“, sagt Kohls.
Doch was als Unterstützung gedacht war, wurde zum Problem. Denn Deutsch lernten die Angestellten auf diese Weise kaum. Sie blieben unter sich. Ein Fehler, wie Kohls heute weiß. Wenn Menschen aus anderen Ländern die deutsche Sprache nicht sprechen, bleiben sie isoliert. Heute gehört das Erlernen der Sprache deswegen zu den obersten Prioritäten der Unternehmensgruppe. Wenngleich an dem Lernkonzept immer noch gefeilt werde: So wurden zuerst Sprachkurse angeboten. Doch die Integrationsbeauftragte des Unternehmens, Heike Streubel, erklärt, dass durch die unterschiedlichen Arbeitszeiten nicht jeder an den Kursen teilnehmen konnte. Also wurde noch einmal überlegt. Seit 2017 arbeitet das Unternehmen nun mit einer Sprachlern-App, damit die Mitarbeiter zeitunabhängig die deutsche Sprache erlernen können.
Die Kraft der Naivität
Geflohene Männer und Frauen mit offenen Armen zu empfangen und ihnen eine Jobchance zu bieten, hat Marlene Thiele in den vergangenen Jahren oft in Unternehmen beobachten können. Sie ist Projektleiterin des Netzwerks „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“, eine seit 2016 bestehende Initiative des deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), die vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird.
Damals seien viele Firmen zunächst naiv an das Thema Integration herangegangen, erinnert sich Thiele. Viele wollten einfach erst einmal helfen, ohne zu wissen, worauf sie sich eigentlich einlassen. „Aber darin lag auch eine große schöpferische Kraft“, erinnert sich die Projektleiterin. Dank dieses Pioniergeistes könnten mittlerweile etliche Unternehmen auf Erfahrungen mit der erfolgreichen Integration zurückgreifen. Und dieses Wissen komme wiederum dem Netzwerk zugute, denn hier könnten sich die Unternehmen bei Veranstaltungen austauschen.
Dem Netzwerk gehören mittlerweile vor allem kleinere und mittlere Firmen an. Viele von ihnen hätten insbesondere juristische Fragen, die sie intern mangels Rechtsabteilung nicht klären können, sagt Thiele. „Wir erklären ihnen dann zum Beispiel, welche Unterlagen für eine Einstellung eines Geflüchteten wichtig sind, was der Asylstatus eines Bewerbers bedeutet, wie sein Schulabschluss zu bewerten ist oder welches Dokument vorgezeigt werden muss, wenn der Zoll vorbeikommt.“
Verständnis über den Tellerrand hinaus
Doch auch andere – meist kulturelle – Themen, die für Unstimmigkeiten sorgen, treiben Unternehmer um und sie bitten deswegen um Rat. Thiele nennt ein Beispiel: „In Deutschland ist Eigeninitiative bei der Arbeit sehr wichtig und wird gerne gesehen. In anderen Ländern hingegen untergräbt man mit Eigeninitiative die Autorität des Vorgesetzten. Dort gebietet die Höflichkeit, auf Anweisungen zu warten.“ Ein Detail, das beide Seiten für eine gute Zusammenarbeit kennen und verstehen müssen.
Auch bei Gegenbauer hat man schon Erfahrungen mit solchen Missverständnissen gesammelt. So führen beispielsweise Krankmeldungen immer wieder zu Problemen. Denn in anderen Ländern gibt es sie schlichtweg nicht. Fragen wie: Wann muss man sich wo krankmelden? Welches Dokument braucht man dafür und wie bekommt man es?, stellen die neuen Mitarbeiter also gar nicht erst. Um Irrtümern von vornherein vorzubeugen, nutzt Gegenbauer deswegen mittlerweile einen Comic, mit dessen Hilfe Neuangestellte, die noch nicht so gut Deutsch verstehen, das Prozedere einer Krankmeldung anschaulich erklärt bekommen.
Für Geflüchtete ist dieser bürokratische Aufwand tatsächlich schwer nachzuvollziehen. Das bestätigt auch Violetta Essa Farhat. „In Deutschland gibt es immer so viel Papier“, sagt die zierliche Frau mit leiser Stimme. „Und so viele Regeln.“ Sie ist seit drei Jahren hier und entschuldigt sich für ihr gebrochenes Deutsch. Die 31-Jährige stammt aus Syrien und braucht Zeit zum Formulieren ihrer Sätze. Mit vielen Sprachpausen erzählt sie ihre Geschichte: Wie sie alleine mit ihren drei Kindern in die Bundesrepublik kam. Welche Länder sie dabei passierte, wisse sie schon gar nicht mehr, aber ihre Reise habe ziemlich genau ein Jahr gedauert, sagt sie. Nun sei sie erleichtert, angekommen zu sein. Denn Deutschland biete viele Möglichkeiten: „In Syrien habe ich in einem kleinen Dorf gelebt. Dort konnte ich die Schule nicht beenden und habe dann neun Jahre als Friseurin gearbeitet.“ Nun macht sie seit dem vergangenen Jahr bei Gegenbauer eine kaufmännische Ausbildung im Bereich Büromanagement. Und neigt seitdem zur Überarbeitung. „Wir üben jetzt mit ihr, auch mal ‚Nein‘ zu sagen und nicht immer alles machen zu wollen“, sagt die Integrationsbeauftragte Heike Streubel.
Durchhaltevermögen
Sicherlich bedeute es einen größeren Aufwand, wenn man Geflüchtete einstelle, sagt Personaldirektor Kohls. Durch seine jahrelange Erfahrung wisse er aber auch: „Wenn man diesen Menschen eine Chance gibt und sich engagiert, sind sie meistens sehr dankbar und geben einem so viel zurück.“ Hinzu käme, dass diese Menschen während der Flucht aus ihrer Heimat schon viel auf sich genommen hätten. „Sie haben Kraft und Durchhaltevermögen bewiesen und diese Eigenschaften werden sie auch im Job einsetzen“, ist sich Kohls sicher.
Auch Hossein Khavari gehört zu den Mitarbeitern, die Kohls wegen ihrer großen Motivation schätzt. Doch ist noch ungewiss, ob der junge Mann dauerhaft in Deutschland bleiben kann: Seine Duldung läuft in sechs Monaten aus. Heike Streubel hilft ihm nun mit Unterstützung eines Anwalts durch den Behördendschungel und den Antragswust. „Wir wollen ihn nicht verlieren“, erklärt Streubel. Khavari arbeite sehr vorbildlich und zuverlässig. Sein begrenzter Aufenthaltsstatus belastet den jungen Mann. „Ich verstehe die deutschen Gesetze einfach nicht“, sagt er und blickt zu Boden. Sein größter Traum wäre es, endlich dauerhaft in Deutschland bleiben zu dürfen, sagt er mit ernstem Gesicht. In diesem Moment ist sein Lächeln verschwunden.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Nachhaltigkeit. Das Heft können Sie hier bestellen.