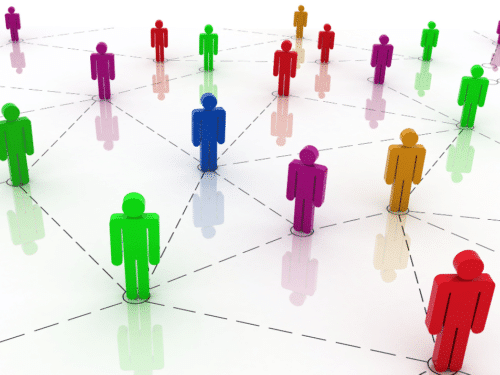Arbeitsplatznah, effizient und in Zeiten von New Work höchst relevant: Die Rede ist von der kollegialen Beratung. Wann gelingt sie und wie läuft der strukturierte Austausch ab?
Joachim Zender ist vor Kurzem zum Vertriebsleiter eines Maschinenbauunternehmens befördert worden. In einer Gesprächsrunde stellt er seinen drei Kollegen aus dem Vertrieb, der Produktentwicklung und dem Kundendienst sein Anliegen vor: Einem Großkunden hat er eine komplexe maßgeschneiderte Lösung für eine Verpackungsanlage verkauft. Im Nachhinein beschwerte sich der Kunde über zu lange Reaktionszeiten seitens des Unternehmens. Die drei Kollegen haben zugehört, Fragen gestellt und schließlich ihre Ideen für einen konstruktiven Umgang mit dem kritischen Kunden eingebracht. Der erfahrene Kollege aus dem Vertrieb rät ihm, einen Mitarbeiter aus dem Kundendienst frühzeitig mit zum Kunden zu nehmen; der Kollege aus dem Kundendienst regt an, dass das Vertriebsteam das nächste Mal an den Kundendienst-Schulungen teilnehmen könnte, und der Konstrukteur überlegt, ob er zukünftig bei gleichen Kosten ein hochwertigeres Teil bei einem anderen Lieferanten finden kann. Der Vertriebsleiter Joachim Zender ist zufrieden: Er hat Anregungen und Lösungsvorschläge erhalten, auf die er ohne den Austausch nicht gekommen wäre.
Gruppendynamische Intelligenz
Was auf den ersten Blick wie ein Rollenspiel in einem Training anmutet, ist in Wirklichkeit ein strukturierter Kollegen-Austausch – eine sogenannte kollegiale Beratung –, auch zu verstehen als Reflecting Group, bei der es darum geht, das Expertenwissen von Kollegen zu nutzen, die Ratschläge aus ihrem Blickwinkel geben. Das Konzept dahinter: Der Ratsuchende (Fallgeber) entwickelt für sein konkretes berufliches Problem Lösungen. Und die Kollegen als interne Berater lernen aktiv zuzuhören und wirkungsvolle Fragen zu stellen, die beim Fallgeber eine Reflexion auslösen. Die Reflecting Group, die auf Führungskräfte- oder Mitarbeiterebene meist in einer Gruppe von fünf bis zehn Personen stattfindet, folgt einer klar strukturierten Systematik mit festgelegten Prozessschritten.
Ein steigendes Interesse an dem Format zeigt sich bei kleinen, mittleren und Großunternehmen gleichermaßen, die einen kulturellen Wandel weg vom Einzelkämpferprinzip hin zum „Wir“ planen. Im Zuge zunehmender Projektarbeit in wechselnden Teams und komplexer Arbeitsprozesse wird die Teilung und Streuung des Wissens über Hierarchie- und Abteilungsebenen hinweg wichtiger – zusätzlich befeuert durch die Digitalisierung, die kooperatives Arbeiten fordert und fördert. „In einer digitalisierten Arbeitswelt hat das Erfahrungswissen einen großen Wert. Der Austausch von Wissen kann nicht von oben verordnet werden. Notwendig ist ein Format, das es Mitarbeitern ermöglicht, sich in ihrer sozialen Umgebung vertrauensvoll zu unterstützen und Lösungswege selbstständig zu erarbeiten“, sagt Peter Dehnbostel, Professor für Weiterbildung und Betriebliches Bildungsmanagement an der Deutschen Universität für Weiterbildung in Berlin.
Wirkungsvoll im Change
Start-ups, die ohnehin auf Austausch und Partizipation setzen, kommt das interaktive Lernen entgegen; insbesondere in der Phase des Wachstums: Wenn sich die kleine „Zehnmann-Bude“ in kurzer Zeit zu einem 200-Mann-Unternehmen mit Abteilungen entwickelt, befürchten Gründer und Mitarbeiter den Verlust von Anfängergeist und Nähe. Auch die eigene Wirksamkeit geht zumindest gefühlt verloren, weil Aufgaben an andere delegiert werden müssen. Damit dieser Übergang gelingt, ist die Methode der kollegialen Beratung ideal: Herausforderungen können gemeinsam in einer heterogen zusammengesetzten Gruppe reflektiert und Fragen erörtert werden, die eine schnelle Antwort erfordern, wie zum Beispiel: Warum fällt es mir schwer, „mein“ Produkt „loszulassen“ und meinem Mitarbeiter zu vertrauen? Und: Wie muss ich in meiner Rolle als Führungskraft Ziele vereinbaren und Aufgaben so beschreiben, dass Mitarbeiter sie gut lösen können? Nicht nur zur Reflexion der eigenen Führungsrolle und bei Verhaltensunsicherheiten ist dieses Personalentwicklungsinstrument geeignet. Es kann gerade dann ein probates Mittel sein, wenn Wissensarbeiter ad hoc eine Antwort auf ein individuelles komplexes Problem brauchen, auf die sie nicht bis zum nächsten Seminar warten können, das womöglich erst in drei Monaten stattfindet. Weniger angebracht ist die Reflecting Group dagegen bei persönlichen Themen, die eher in die Hände eines professionellen Coachs gehören.
Ungeeignet für Einzelkämpfer
Trotz vieler Vorteile ist das soziale Lernformat kein Selbstläufer. Damit es gelingt, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: Neben dem Commitment der Unternehmensleitung zu heterogenen, abteilungsübergreifenden Teams – sprich Querverbindungen – müssen ein fester Raum geschaffen und auch Zeitpläne von Mitarbeitern und Führungskräften respektiert werden. Wenn der eingangs vorgestellte Vertriebsleiter Joachim Zender nicht beim Kunden, sondern in der kollegialen Beratung sitzt, ist das für die Geschäftsleitung oftmals „nur schwer auszuhalten“. Liegt der Fokus des Unternehmens auf der Umsatzgenerierung und steht die Geschäftsleitung unter enormem Druck, sollte man diese Entwicklungsmethode besser nicht einführen. Generell kann in Unternehmenskulturen, die sehr stark auf Einzelkämpfertum und Wettbewerb ausgerichtet sind, die Reflecting Group nur schwer gedeihen. In einem solchen Umfeld haben Mitarbeiter oftmals die Haltung , dass sie vom Austausch profitieren müssen. Diese Haltung, verbunden mit dem Ziel, dass zwingend ein Ergebnis herauskommen muss, ist kontraproduktiv. Sie steht damit einer der wichtigsten Zutaten zum Gelingen im Weg: dem Vertrauen, offen und wertschätzend miteinander zu sprechen.
Sinnvoll ist es, in der Experimentierphase beziehungsweise zu Beginn des Prozesses einen externen Berater als Moderator hinzuzuziehen, der Prozess und Rollen beschreibt. Wurde der Selbstlernprozess, auch mithilfe von HR erfolgreich initiiert, sollte die Gruppe selbst einen Modus für weitere, möglichst regelmäßige Beratungsrunden festlegen, wobei ein Teilnehmer jeweils die Rolle des Moderators übernimmt. Denn der Charme dieses Personalentwicklungsinstrumentes liegt in der Freiwilligkeit, dem selbstgesteuerten Lernen und der Unabhängigkeit von externer Unterstützung.
Strukturierter Prozess in fünf Phasen
Phase 1: Das Anliegen schildern. Der Moderator – das kann zum Beispiel ein HR-Mitarbeiter oder ein externer Berater sein – erläutert die Gesprächsregeln. Der Fallgeber schildert sein Anliegen und die Kollegen als interne Berater hören zu.
Phase 2: Befragung und Wertschätzung. Die Beratergruppe stellt Verständnisfragen. Jeder Berater drückt in einem Satz aus, was dem Fallgeber seiner Meinung nach bisher gut gelungen ist.
Phase 3: Das Anliegen verstehen. Die Berater analysieren den Fall ohne den Fallgeber, der in dieser Phase „nur“ zuhört. Der Fallgeber lässt die Überlegungen der Berater zunächst auf sich wirken und schildert, was diese bei ihm ausgelöst haben.
Phase 4: Lösungsvorschläge und Feedback. Der Moderator hält die Vorschläge schriftlich fest. Der Fallgeber teilt mit, welche der genannten Ideen er testweise anwenden möchte. Die Berater hören ausschließlich zu und bewerten seine Entscheidung nicht.
Phase 5: Austausch und Dank. Der Fallgeber und die internen Berater tauschen sich darüber aus, was im gesamten Prozess methodisch und inhaltlich gut gelaufen ist und was sie vertiefen wollen. Der Fallgeber bedankt sich abschließend.