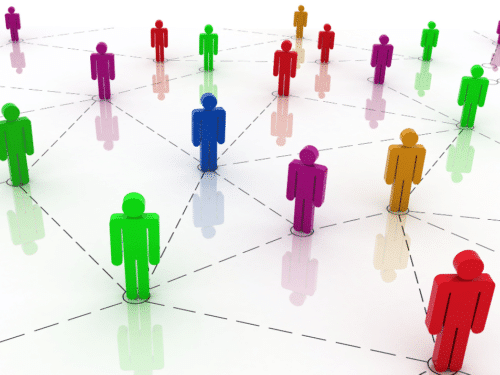Die Digitalisierung ebnet neue Wege ins Arbeitsleben. Computerspiele und Eignungstests können die Bewerberauswahl fairer und leistungsgerechter gestalten – oder die Anstrengungen einer langjährigen Ausbildung in 20 Minuten zunichtemachen.
Abschlussnoten sind wertlos bei der Personalauswahl. Wir haben festgestellt, dass sie rein gar nichts vorhersagen.“ Das Zitat stammt nicht von frustrierten Bewerbern mit schlechten Uni-Zeugnissen, sondern von Laszlo Bock, dem Personalchef von Google. Bocks Aussage steht für einen beginnenden Paradigmenwechsel: Titel eines Bewerbers und das Renommee seiner Hochschule verlieren an Bedeutung, tatsächliche Kompetenzen gewinnen. Eine Entwicklung unterstützt dieses neue Denken maßgeblich: Die Digitalisierung bietet immer bessere Hilfsmittel, um den passendsten Bewerber für eine Stelle zu finden – unabhängig von Noten und Zeugnissen.
Ineffiziente Bewerbungsverfahren
Aus 161.000 Bewerbungen, so eine Umfrage unter deutschen Unternehmen, entstehen nur 3.500 Einstellungen. Damit sind fast 98 Prozent der Bewerbungen erfolglos. Obwohl das Jobangebot groß ist und deutsche Unternehmen über Fachkräftemangel klagen, brauchen junge Akademiker nach Abschluss ihres Studiums im Schnitt fast ein halbes Jahr, bis sie eine Beschäftigung aufnehmen. Oft passen dann Anforderungen und Fähigkeiten nicht zusammen: 15 Prozent der Berufstätigen sind in ihrem Job über- und 22 Prozent unterqualifiziert. Diese fehlende Passung setzt Fliehkräfte frei: Bei jüngeren Angestellten liegt die durchschnittliche Beschäftigungsdauer unter zwei Jahren. Trotz dieser ernüchternden Zahlen ist der Glaube an Titel, Abschlüsse und einen lückenlosen Lebenslauf in Deutschland ungebrochen.
Investitionen in Bildung zahlen sich zwar aus und eine entsprechende Zertifizierung ist sinnvoll. Doch ein summa cum laude an einer bekannten Hochschule ist nicht automatisch mit einer erfolgreichen Karriere gleichzusetzen. Genau an diesem Punkt kommt Big Data ins Spiel. Was wäre, wenn sich mit wenig Aufwand die Persönlichkeit eines Menschen so erfassen ließe, dass beruflicher Erfolg planbarer wäre?
Computerspiele statt Elite-Uni
Einige findige Startups versuchen genau das. Knack, ein Unternehmen aus dem Silicon Valley, hat sich darauf spezialisiert, mithilfe von Algorithmen und Computerspielen zu ermitteln, welcher Kandidat der passendste für einen Job ist. Das Spiel „Wasabi Waiter“ soll beispielsweise Ausdauer, Kreativität und Entscheidungsfähigkeit einer Person testen. Der Spieler muss dafür als virtueller Kellner in einem Sushi-Restaurant jedem das passende Gericht servieren. Dabei soll er die Emotionen seiner Gäste berücksichtigen. Die Schwierigkeit: Die Zahl der Gäste wächst ebenso wie die Menge der unterschiedlichen Emotionen. Das Spiel sammelt Daten und stellt fest, wie sich der Bewerber in Entscheidungssituationen verhält. Lernt er aus Fehlern? Wo setzt er Prioritäten?
Wenige Minuten als virtueller Sushi-Kellner sollen also mehr über einen Menschen aussagen als seine hart erarbeiteten Abschlüsse und Zeugnisse? Hans Haringa hat es ausprobiert und dem Magazin Atlantic von seinen Erfahrungen berichtet. Haringa ist Leiter der sogenannten „Game-Changer-Unit“ bei Shell. Er und seine Kollegen sollen innovative Geschäftsideen von Shell-Mitarbeitern prüfen und unterstützen. Seine Abteilung existiert seit mehr als zwanzig Jahren, rund 1.400 Shell-Mitarbeiter haben sich bisher mit ihren Ideen beworben. Sämtliche Informationen über sie und den Projektverlauf sind erfasst.
Haringa wollte wissen, ob die Knack-Software wirklich die erfolgversprechendsten Ideengeber herausfiltern kann. Dazu lud er alle Bewerber aus den vergangenen zwei Jahrzehnten zum virtuellen Kellnern ein. Vorab teilte er sie in zwei Gruppen. Von der ersten Gruppe erfuhren die Knack-Leute, ob die Projekte erfolgreich waren oder nicht. Ihre Spielergebnisse wurden mit den Projektaufzeichnungen verknüpft. So ließen sich Handlungsmuster und Eigenschaften eines bei Shell erfolgreichen Mitarbeiters sichtbar machen.
Von den Mitgliedern der zweiten Gruppe war Knack nicht bekannt, was aus ihren Ideen geworden war. Sie verglichen stattdessen deren Spielergebnisse mit den Erfolgsmustern der ersten Gruppe. Ohne etwas über die Projekte zu wissen, ohne die Menschen dahinter je gesprochen zu haben, ohne ihren Bildungsstand oder sozialen Hintergrund zu kennen, konnte die Software die Besten identifizieren: Diejenigen zehn Prozent, die das Computerprogramm als erfolgversprechendste Kandidaten ausmachte, waren identisch mit den zehn Prozent, die es bei Shell am weitesten gebracht hatten.
Angriff auf das Bildungsbürgertum
Wenn Computerprogramme aus Hunderten Bewerbern die zehn aussichtsreichsten herausfiltern, könnte das Stochern im Bewerbernebel für Unternehmen ein Ende haben. Mit digitalen Hilfsprogrammen lassen sich ohne großen Aufwand potenzielle Jobanwärter identifizieren, die von den konventionellen Methoden der Personalrekrutierung nicht erfasst werden. So eröffnen sich auch Möglichkeiten für diejenigen, die bislang ausgeschlossen blieben. Wem die finanziellen Mittel fehlten, um eine renommierte Universität zu besuchen oder die nötigen Kontakte, der kann jetzt Zugang zu bisher verschlossenen Zirkeln erhalten.
Für das Bildungsbürgertum aber wirft die Digitalisierung alte Gewissheiten über den Haufen: Eine halbe Stunde Computer spielen wird für die Karriere plötzlich entscheidender als die bisherige Lebensleistung; wichtiger als all die Jahre in der Ausbildung oder an der Universität; wichtiger als unzählige geschriebene Klausuren und hart erarbeitete Abschlüsse. Und was ist mit den Unmengen an Daten, die erfasst und ausgewertet werden, die Menschen zu Objekten von Algorithmen und Wahrscheinlichkeiten machen können?
Natürlich werden bisherige Türöffner wie Abschlüsse von Elite-Unis oder Kontakte in die Chefetage nicht über Nacht verschwinden. Aber die Erfahrungen von Bock und Haringa zeigen, dass Digitalisierung hilft, für eine bessere Passung zwischen den Kompetenzen der Mitarbeiter und den Anforderungen der Jobs zu sorgen. Dem sollten wir uns auch in Deutschland nicht verschließen.