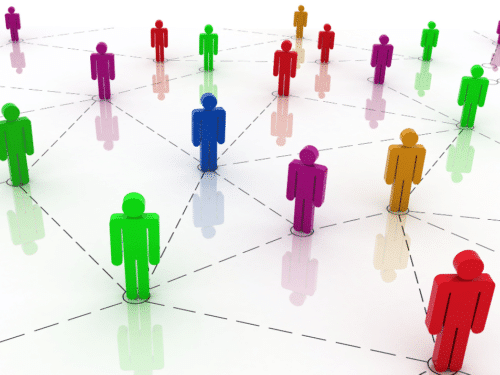Vernetztes Arbeiten wird für Unternehmen immer wichtiger, Collaboration Tools geben Mitarbeitern das nötige technische Rüstzeug. Ein Überblick über die wichtigsten Kategorien der digitalen Werkzeuge – und Tipps, wann Mitarbeiter die Tools auch wirklich nutzen sollten.
Einzelkampf ist out. Die Zusammenarbeit zwischen Kollegen und das gemeinsame Bearbeiten komplexer Aufgaben werden für den Unternehmenserfolg immer wichtiger. „Wissensarbeit nimmt zu, ebenso das Arbeiten in Teams und der Austausch mit Kollegen über Abteilungsgrenzen hinweg“, sagt Andreas Stiehler, Analyst bei der auf digitale Strategien spezialisierten Unternehmensberatung PAC.
„Gleichzeitig wandelt sich das Umfeld, in dem Menschen zusammenarbeiten. Immer mehr Beschäftigte arbeiten mobil, an verschiedenen Standorten, im Homeoffice und in wechselnden Ländern. Die entsprechenden technischen Tools für die Zusammenarbeit in virtuellen Teams werden deshalb immer wichtiger“, sagt Stiehler.
Begriffe wie Digital Workspace, Smart Work und Social Collaboration grassieren in vielen Unternehmen, gemeint ist vor allem eines: Kommunikation und digital gestützte Zusammenarbeit. „Es geht darum, flexible virtuelle Räume zu schaffen“, sagt Stiehler. Wie diese Räume aussehen und welche von Mitarbeitern angenommen werden, kann sich je nach Unternehmen unterscheiden. „Die Mitarbeiter nutzen, was Nutzen stiftet“, sagt Siegfried Lautenbacher, Geschäftsführer der auf Collaboration spezialisierten IT-Beratung Beck in München. „In einem Unternehmen gibt es in der Regel rund fünf bis zehn Prozent technikaffine Mitarbeiter, die Tools aus Spaß anwenden. Der weitaus größte Teil der Belegschaft benutzt die Tools nur dann, wenn er davon einen konkreten Nutzen hat.“
Viele Unternehmen haben ähnliche Erfahrungen bereits mit ihren Social-Enterprise-Systemen gemacht, die das ganze Unternehmen im umfassenden Sinne digital abbilden. Sie werden durch zusätzliche Collaboration Tools nicht hinfällig, auch wenn sich die Anwendungsfelder teilweise überschneiden. „Social-Enterprise-Programme haben nach wie vor ihre Berechtigung“, sagt IT-Berater Lautenbacher.
Die IT-Abteilungen der Unternehmen müssten sich allerdings an den Gedanken gewöhnen, dass Mitarbeiter neben diesem digitalen Hauptraum weitere Anwendungen und Kanäle nutzen. „Wenn die IT das akzeptiert und eine Vielfalt von Programmen zulässt, kann sie auch diese Nebenkanäle mitgestalten und einen Wildwuchs verhindern“, sagt Lautenbacher. Ob im großen oder kleinen Rahmen: Wer erfolgreich digitale Helfer einführen will, muss schnell konkrete Anwendungsfälle im Arbeitsalltag schaffen. Und seine Mitarbeiter an eine Kultur des Austauschs und der offenen Kommunikation gewöhnen. „Wenn die Abteilungen eines Unternehmens ein traditionelles Silo-Denken pflegen und diese Kultur lediglich digitalisieren, entsteht dadurch kaum ein Mehrwert“, sagt Lydia Zillmann, Geschäftsführerin der auf vernetztes Arbeiten spezialisierten Unternehmensberatung Avilox aus Leipzig. „Je nachdem wie ein Unternehmen tickt, braucht es neben technischen Tools auch einen mehr oder weniger großen kulturellen und organisatorischen Wandel.“ Die wichtigsten Kategorien von Tools für vernetztes Arbeiten im Überblick:
Instant Messenger
Basis für jede Zusammenarbeit ist die Kommunikation der Kollegen untereinander. Traditionelle technische Hilfsmittel wie Telefon und E-Mail sind häufig schlicht zu umständlich, um sie niedrigschwellig mal eben zwischendurch zu benutzen, wenn man eine kurze Frage hat oder dem Kollegen durchgeben will, dass eine Aufgabe erledigt ist.
Instant Messenger sind die Lösung, die immer mehr Unternehmen nutzen. Die größten Vorteile: Mitarbeiter können beliebig viele Gruppen eröffnen, um sich innerhalb eines Teams oder einer Abteilung oder zu einem konkreten Projekt auszutauschen. Und man sieht jederzeit, ob ein Nutzer gerade online ist und direkt antworten kann. „Über einen Messenger können Mitarbeiter schnell und unkompliziert miteinander in Kontakt kommen“, sagt Avilox-Geschäftsführerin Lydia Zillmann. „Wichtig ist, dass ein Messenger neben Gruppenräumen auch den direkten Eins-zu-eins-Kontakt ermöglicht, in dem zwei Mitarbeiter in einem geschützten, nicht öffentlichen Raum miteinander kommunizieren können.“ Zudem sollte ein Messenger sowohl auf dem Desktop-Rechner als auch auf dem Smartphone funktionieren, damit Kollegen die Software auch unterwegs nutzen können. Genauso wichtig wie die Technik ist die Kompetenz, transparent führen und digital kommunizieren zu können.
Derzeit sind viele in Firmen genutzten Messenger in andere Anwendungen integriert. Das kann Vorteile haben, die Bedienung aber auch verkomplizieren. Reine Messenger haben deshalb ihre Berechtigung. Der Branchenführer bei privaten Anwendern ist WhatsApp. Der Instant-Messenger -Dienst buhlt längst gezielt um Firmenkunden.
Nachteil: WhatsApp steht immer wieder wegen zu laxem Datenschutz in der Kritik, Konkurrenten wie Threema und Signal versprechen einen seriöseren Umgang mit Daten. Einen weiteren Nachteil können auch die Wettbewerber nicht ausbügeln: Sobald Mitarbeiter mehr wollen als kommunizieren – etwa Dateien austauschen –, wird es kompliziert.
Conversational Platform
Wenn Mitarbeiter mehr als nur kommunizieren wollen, schaffen sogenannte Conversational Platforms Abhilfe, die neben einem Chat weitere Funktionen bieten. Diverse Tüftler haben sich daran versucht, auf einer Plattform verschiedene Tools einfach und alltagstauglich zu kombinieren. Einer hat es geschafft: Slack-Entwickler Stewart Butterfield aus San Francisco, der zuvor schon die Fotocommunity Flickr mitgegründet hat.
Slack ist als Tool noch vergleichsweise jung, hat aber in den vergangenen zwei bis drei Jahren einen regelrechten Hype ausgelöst. Unternehmen werben mittlerweile in Stellenanzeigen damit, dass ihre Mitarbeiter Slack nutzen dürfen. Das Start-up aus San Francisco hat geschafft, woran viele scheitern: Es funktioniert so einfach, dass Mitarbeiter es freiwillig nutzen wollen.
Rückgrat des Programms ist die Chatfunktion. Mitarbeiter können verschiedene Chatkanäle einrichten wie bei einem Messenger und obendrein mit einer gut funktionierenden Suche nach alten Einträgen forschen, etwa um getroffene Absprachen leicht wiederzufinden. Zudem können Nutzer im Chat Dateien hochladen und kommentieren und andere Tools einbinden.
Der Unterschied zu vielen anderen Anbietern: Slack baut die übrigen Tools nicht selber, sondern ermöglicht es, Programme anderer Anbieter einzubinden. Heißt konkret: Wenn zwei Mitarbeiter per Slack chatten und der Name eines Kunden fällt, ruft das CRM automatisch die jüngsten Infos etwa zu Rechnungen oder zum Stand eines Auftrags ab und blendet die Informationen ein. „Dahinter steht die Erkenntnis, dass es nicht einen Anbieter für alle Tools geben wird. Die Mitarbeiter nutzen am Ende die Tools, die sie vielleicht auch schon privat nutzen und die am besten funktionieren“, sagt IT-Berater Lautenbacher.
Filesharing
Das Verschicken großer Dateien wie Präsentationen und Dokumente per E-Mail scheitert häufig an limitierenden Servern, zudem ist das Verschicken von Mails schlicht unpraktisch, wenn man eigentlich nur Dateien austauschen möchte. Abhilfe schaffen Dienste, mit deren Hilfe Mitarbeiter Dateien unabhängig von ihrer Größe besonders einfach austauschen und gemeinsam bearbeiten können.
Der wohl bekannteste Filesharing-Dienst ist derzeit Dropbox. Vorteil des Dienstes ist zum einen die einfache Handhabung. Einmal installiert, können Mitarbeiter auf den Speicher wie auf ein weiteres Laufwerk zugreifen und dort Dateien ablegen. Innerhalb des Dropbox-Ordners kann ein Mitarbeiter zudem unterteilen, welche Dokumente er zur Bearbeitung durch Kollegen freigibt und welche nicht.
Weiterer Vorteil: Der Online-Speicher ist neben dem Computer des Mitarbeiters auch auf anderen Medien wie etwa dem Smartphone verfügbar, wenn die Dropbox-Software dort installiert ist. Größter Nachteil: Die Sicherheit der Daten ist für Nutzer nur begrenzt nachvollziehbar.
Was für private Nutzer in Ordnung sein mag, ist für die meisten Unternehmen nicht akzeptabel, vor allem nicht bei sensiblen Daten. „Ich würde Unternehmen immer raten, die IT selbst aufzusetzen oder bei einem spezialisierten Dienstleister mit klar geregelter Datensicherheit einzukaufen“, sagt Avilox-Beraterin Zillmann. Der Online-Speicher sollte allerdings nicht nur sicher, sondern auch komfortabel nutzbar sein – ansonsten nutzen die Mitarbeiter heimlich doch wieder Dropbox oder ähnliche Dienste.
Collaborative Writing
Collaborative-Writing-Tools gehen einen Schritt weiter als reine File-Sharing-Programme. Dort können Nutzer dezidiert festlegen, wer welche Rechte hat, wer etwa Dokumente nur einsehen, kommentieren oder auch bearbeiten darf. Zudem können die Programme dokumentieren, wer welche Änderungen vorgenommen hat, einzelne Zwischenversionen speichern, Bearbeitungen bei Bedarf auch rückgängig machen und frühere Versionen wiederherstellen.
Zu den Platzhirschen zählt Google Docs, dessen Benutzeroberfläche Microsoft-Word-Nutzer wegen der großen Ähnlichkeit vor keine Probleme stellt und mit dem man neben reinen Text-Dokumenten auch Tabellen und Präsentationen erstellen kann. Das Programm ist web-basiert, um es zu nutzen, genügt eine Internet-Verbindung. Arbeiten mehrere Mitarbeiter gleichzeitig an einem Dokument, sortiert Google Docs die Eingaben in Echtzeit, sodass alle Beteiligten die Eingaben nachvollziehen können. Zudem gibt es ein Chat-Fenster, in dem sich die Nutzer direkt ansprechen können, wenn sie gleichzeitig an einem Dokument arbeiten.
Firmen-Wiki
Wikipedia hat die Idee perfektioniert, dass viele Nutzer gegenseitig ihr Wissen verfügbar machen. Das gleiche Prinzip wenden immer mehr Firmen für ihr eigenes internes Wiki an. Das Konzept: Mitarbeiter schreiben Artikel zu bestimmten Themen und machen sie für alle anderen Kollegen oder einen definierten Personenkreis verfügbar. Informationen zu Arbeitsabläufen, Kunden und Lieferanten sind so jederzeit verfügbar. Übergaben vor der Urlaubszeit oder bei Krankheit eines Mitarbeiters entfallen oder werden zumindest deutlich einfacher.
Die Krux dabei: Ein Wiki anzulegen ist erst einmal Arbeit. Unternehmen müssen deshalb Anreize schaffen und ihre Mitarbeiter motivieren, Einträge zu erstellen. „Firmen profitieren von einem eigenen Wiki umso stärker, je offener die Firmenkultur ist“, sagt Beraterin Zillmann. Experten raten, die Nutzung erst einmal im kleinen Kreis zu testen, um mögliche Probleme und Hürden frühzeitig aus dem Weg räumen zu können. „Das gilt generell für sämtliche Tools, die unternehmensweit genutzt werden sollen“, sagt Zillmann.
Firmen-Facebook
Im privaten Umfeld ist der Siegeszug der Mutter aller sozialen Netzwerke nicht aufzuhalten. Neuerdings nutzen auch Unternehmen vermehrt Anwendungen, die im Prinzip wie Facebook funktionieren, aber nur für den geschlossenen Nutzerkreis der Mitarbeiter zugänglich sind.
Kern einer solchen Software ist eine Pinnwand, auf der Mitarbeiter Einträge posten, die die Kollegen dann kommentieren können. Zudem können die Mitarbeiter Dateien wie Dokumente und Videos anhängen und weitere Team-Funktionen nutzen, etwa über den Termin für eine Veranstaltung abstimmen lassen. Neben der eigentlichen Pinnwand, auf dem der Hauptstrom der Beiträge läuft, können Mitarbeiter Projektgruppen zu bestimmten Themen gründen, die dann nur für die jeweiligen Kollegen sichtbar sind.
Wichtigster Effekt: Mitarbeiter können ihre Kollegen einfach an ihrer Arbeit teilhaben lassen, Fragen in die Runde stellen und Aufgaben besprechen, die Zahl der Rundmails sinkt dadurch. Hinzu kommen in der Regel weitere Funktionen wie Chat, Firmen-Kalender und Aufgabenverwaltung, die das Zusammenarbeiten vereinfachen.
Facebook selbst hat mit „Workplace by Facebook“ Ende vergangenen Jahres einen Ableger für die firmeninterne Anwendung gestartet.