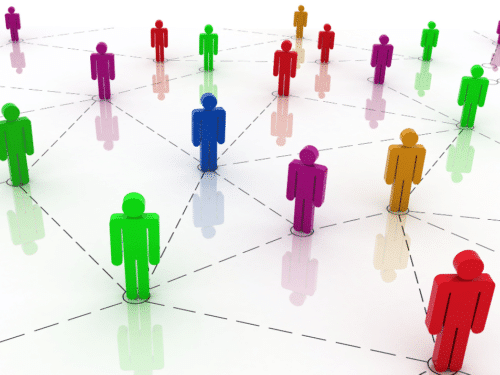Die Festschrift zu seinem 70. Geburtstag hieß schlicht nur: Kompetenz. John Erpenbeck ist der Grandseigneur und eine Autorität beim Thema Kompetenzmessung und -entwicklung. Gespräch mit einem neugierigen Quer- und Vordenker.
Er ist nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Literat. Das hat Tradition in seiner Familie, schließlich ist John Erpenbeck der Sohn von Fritz Erpenbeck, ehemals Chefdramaturg der Berliner Volksbühne, und der Schriftstellerin Hedda Zinner. Auch die Tochter schreibt. Das aktuelle Buch von Jenny Erpenbeck handelt von Geflüchteten in Berlin und stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. John Erpenbeck spricht langsam und wirkt, als ruhe er in sich. Manchmal antwortet er nicht direkt auf die Frage, sondern holt etwas aus. Er ist eben ein Gelehrter. Er wohnt in Berlin-Pankow – im Fritz-Erpenbeck-Ring.
Herr Erpenbeck, der Begriff der Kompetenzen wird oft sehr unterschiedlich benutzt. Was verstehen Sie darunter?
Es gibt in der Tat verschiedene Grundanschauungen in Bezug auf Kompetenzen. Der Kompetenzbegriff, den meine Kollegen und ich vertreten – und der auch immer mehr um sich greift –, meint die Fähigkeit in dynamischen, komplexen und offenen Situationen selbstorganisiert und kreativ zu handeln. Und weil Dynamik und Komplexität zugenommen haben, ist auch für die Unternehmen der Kompetenzbegriff in den Mittelpunkt gerückt. Bloßes, angelerntes Wissen ist hingegen weniger wichtig. Das fragt kein Unternehmen ab, sondern es will wissen: Was können die Mitarbeiter oder die Bewerber?
Wie hängen persönliche Eigenschaften und Kompetenzen zusammen?
Persönlichkeitseigenschaften sind in der Regel langfristig stabil. Sie sind wichtig für die Handlungsfähigkeit und man kann sie auch sehr gut messen. Man kann jedoch nicht von der Persönlichkeitseigenschaft auf die Handlungsfähigkeit schließen. Jemand der extrovertiert ist, muss nicht unbedingt ein guter Verkäufer sein. Und jemand der introvertiert ist, kann unter Umständen eine
große Akquisitionsstärke entwickeln, wird aber vielleicht aufgrund seiner Verschlossenheit bei der Personalauswahl für den Vertrieb übergangen.
Kann man Kompetenzen trainieren?
Kompetenzen kann man im Gegensatz zu Persönlichkeitseigenschaften natürlich trainieren. Besonders gut und schnell können Menschen sie in für sie interessanten und zum Teil stressigen Situationen entwickeln.
Sie selbst haben eine unglaublich vielseitige und umfangreiche Biografie. Sie sind promovierter Physiker mit Spezialisierung Biophysik und haben in der DDR als Experimentalphysiker gearbeitet. Später haben Sie sich unter anderem mit philosophischen Fragen der Wissenschaftsentwicklung beschäftigt. Habilitiert haben Sie zu kognitiven Prozessen. Heute sind Sie Wissenschaftler in den Bereichen Kompetenzdiagnostik und -entwicklung. Auf welche Kompetenzen lässt eine solche Vielseitigkeit schließen?
Wenn man diese Entwicklung auf Kompetenzen zurückführen will, dann würde ich sagen Neugierde und Spieltrieb.
Ist Neugierde nicht eher eine persönliche Eigenschaft?
Nicht unbedingt. Ich sehe sie als wichtige im Leben erworbene Kompetenz, die bestimmte Handlungen hervorruft. Also Neugier würde ich für mich in Anspruch nehmen. Auf die Frage, was ich werden will, habe ich als 14-Jähriger geantwortet: Physiker und Schriftsteller. Mein Interesse war es, von der Welt viel zu erkennen und zu verstehen. Deswegen habe ich dann noch einen Teil Biologie dazu genommen. Und Romane habe ich auch geschrieben.
Ab dem Jahr 1993 sind Sie in die Welt der Personalentwicklung eingetaucht. Wie kam es schließlich zu diesem Schwenk in Ihrer Vita von der Physik über die Philosophie und Psychologie zur Personalentwicklung?
Der Schwenk war fast eine bruchlose Entwicklung. Ab 1973 war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentralinstitut für Philosophie der Akademie der Wissenschaften der DDR und habe mich dort unter anderem mit der Psychophysik kognitiver Prozesse beschäftigt. Damals ist mir aufgefallen, dass für die kognitive Psychologie Motivation zu großen Teilen keine große Rolle spielte. Daraufhin habe ich mich auf das Thema Motivation gestürzt. 1986 ist mein Buch Motivation – ihre Psychologie und Philosophie erschienen. Das war sozusagen der geistige Schwenk. Dann stellte ich fest, dass die Motivationspsychologie eine Leerstelle bei den Willensprozessen hatte. Die wurden in Westdeutschland zu der Zeit von der Forschung gerade erst wiederentdeckt. Und der Wille hat thematisch eine deutliche Nähe zu Kompetenzen.
Warum haben Menschen bestimmte Kompetenzen, die andere nicht haben? Ist es eine Frage des Willens, der Erfahrung oder spielen auch genetische Voraussetzungen eine Rolle?
Genetisch sind lediglich die persönlichen Voraussetzungen, die besser oder schlechter sein können. Aber es gibt auch Menschen, die hervorragende Kompetenzen auf einem Gebiet haben, obwohl sie lernschwach sind. Wissen ist dabei nicht so wichtig. Handlungsfähigkeit speist sich aus verschiedenen Quellen, von denen lediglich eine Wissen ist.
Nehmen wir schriftliche Ausdrucksfähigkeit als Kompetenz – liegt es am Training, wenn einer besser als der andere schreiben kann?
Zu großem Teil ist es Training. Ich kann jeden Menschen dahin trainieren, dass er seine Gedanken lebendig ausdrücken kann. Aber es spielen unterschiedliche Einflussfaktoren eine Rolle: die Lektüre, die man hatte oder die äußeren Umstände, unter denen man schreibt.
Betreiben die meisten Unternehmen ein echtes Kompetenzmanagement?
Zumindest die großen Unternehmen und Organisationen haben meiner Beobachtung nach fast alle ein erklärtes und fixiertes Kompetenzmodell. Als ich zusammen mit den anderen Herausgebern Modelle für unser Buch Kompetenzmodelle von Unternehmen untersuchte, fand ich vor allem interessant, dass die Modelle sehr ähnlich gebaut sind. Zuerst hat man in den Unternehmen überlegt, welche strategischen Aufgaben für die nächsten ein bis zwei Jahre bestehen. Dann wurde daraus abgeleitet, welche Kompetenzen die Mitarbeiter haben müssen. Festgehalten werden sie in einer Art Katalog differenziert nach Job-Familien, zum Beispiel 14, 16 oder 18 Kompetenzen. Sie müssen allerdings – und das ist vielleicht das Wichtigste – unterfüttert werden mit Handlungsankern.
John Erpenbeck in seinem Lese- und Arbeitszimmer, Foto: Laurin Schmid / laurin-schmid.com
Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Nehmen wir mal die Kompetenz Kommunikationsfähigkeit in einer Eventagentur. Dann steht da beispielsweise als Handlungsanker: „In einer komplizierten Kommunikationssituation behält der Mitarbeiter seinen Humor und setzt seine Ansichten mit Witz und Argumenten durch.“ Oder: „In Bezug auf Kollegen und Kunden ist er stets offen und bereit, gegebenenfalls seine Ansichten zu ändern.“ Oder nehmen wir eine Kompetenz aus dem Aktivitäts- und Handlungsbereich: Belastbarkeit. Also die Fähigkeit, unter äußeren und inneren Belastungen selbstorganisiert und kreativ zu handeln. Das ist abstrakt. Es muss durch unternehmensspezifische Handlungsanker untersetzt werden. Etwa bei dem Mitarbeiter einer Spielbank: „Er weicht Konfliktsituationen nicht aus, sondern steht sie freundlich, aber unnachgiebig durch“. Oder: „Vermeidet übergroße Nähe wie auch zu große Distanz Kunden gegenüber“. Die Handlungsanker müssen konkret sein, die auf ihnen basierende Einschätzung eines Mitarbeiters ist dann nicht mehr aufwändig. Denn Handlungsanker kann ich wahrnehmen und messen beziehungsweise beurteilen, zum Beispiel anhand einer vorgegebenen Skala.
Es gibt aber immer wieder auch Kritik an Kompetenzmodellen in Unternehmen: zu abstrakt, zu aufwändig und zu sehr an Defiziten der Mitarbeiter orientiert, lauten einige Punkte. Sind Kompetenzmodelle in der Praxis dann doch eher Papiertiger?
Abstrakt ist ein Kompetenzmodell zum einen immer dann, wenn es mit allgemeinen Kompetenzbegriffen arbeitet, diese aber nicht mit unternehmensspezifischen und für die Mitarbeiter sofort einsichtigen Handlungsankern untersetzt, von denen ich gerade gesprochen habe. Zum anderen ist ein gutes Kompetenzmanagement nie an Defiziten orientiert. Es interessiert nur: Welche Kompetenzen sind schon da, welche lassen sich weiterentwickeln beziehungsweise trainieren? Und die Feststellung erweiterbarer Handlungsfähigkeiten der Mitarbeiter ist mitnichten ein Papiertiger, sondern für Unternehmen im Wettbewerb überlebenswichtig.
Wie kann die Relevanz sichergestellt werden?
Die Relevanz kann und muss durch die Strategiediskussion gesetzt werden. Ist die künftige Strategie diffus und schlecht zu umreißen, werden auch die abgeleiteten Kompetenzanforderungen und die entsprechenden Handlungsanker diffus und damit wenig relevant sein. Ist die Strategie klar, gibt es kein besseres Mittel, die für ein Unternehmen zentralen Kompetenzen herauszufinden und die Mitarbeiter entsprechend auszuwählen, einzusetzen und weiter zu entwickeln. Zentrale Schlüsselkompetenzen sind der wichtigste Türöffner einer outputorientierten Personalentwicklung.
Ist eine zentrale Steuerung der Kompetenzentwicklung eigentlich noch zeitgemäß? Weiß der Einzelne nicht am besten, welche Kompetenzen er hat und in welchem Bereich er sich entwickeln muss?
Das denke ich nicht. Wir haben an der School of International Business and Entrepreneurship der Steinbeis-Universität in Berlin jahrelang die Kompetenzen von allen unseren Studierenden gemessen – und zwar jeweils am Anfang, in der Mitte und am Ende ihrer Studienzeit. Dabei ist eine klare Tendenz auffällig: Frauen schätzen sich anfangs fast immer schlechter ein als sie von den anderen gesehen werden, Männer hingegen liegen stets oberhalb der allgemeinen Einschätzung. Selbsteinschätzungen sollten also auf jeden Fall ergänzt werden mit Fremdeinschätzungen. Nach meiner Meinung und der meiner Kollegen braucht man mindestens acht Einschätzungen, um ein einigermaßen objektivierbares Urteil zu bekommen. Das muss natürlich elektronisch funktionieren, sonst dauert es zu lange.
Was halten Sie von Assessment Centern als Kompetenzmessinstrument?
Assessment Center haben häufig den Nachteil, dass sie nicht sehr valide sind. Vor allem dann nicht, wenn sie nicht in kurzen Abständen umgebaut werden.
Wieso nicht?
Weil die Menschen sich darauf vorbereiten. Es gibt unzählige Bücher, mit denen man sich auf die Standardfragen einstellen kann. Besser sind gegenseitige Einschätzungen durch Kollegen und Vorgesetzte, aber nur wenn die Mitarbeiter sich untereinander gut kennen. Wenn nicht, wie zum Beispiel bei Neueinstellungen, ist ein gut gemachtes Assessment Center eine wichtige erste Stufe. Genau für diesen Fall wurde auch das KODE-Verfahren entwickelt.
Es gibt die vier Grundkompetenzen: personale, Aktivitäts- und handlungsbezogene, fachlich-methodische sowie sozial-kommunikative Kompetenzen. Welche Gewichtungen nehmen Sie in den Unternehmen wahr? Spielen alle vier dieselbe Rolle?
Man kann deutlich sehen, dass die personalen Kompetenzen bislang eine noch zu geringe Rolle spielen. Weil viele Menschen sich als Person selbst nicht ernst nehmen.
Was sind beispielsweise personale Kompetenzen?
Dazu gehören vor allem in die persönliche Handlungsfähigkeit integrierte Werte. Was ist für mich als Mensch besonders wertvoll? Auf der anderen Seite spielen die Fach- und Methodenkompetenzen, die nicht selten mit dem Fach- und Methodenwissen verwechselt werden, eine große Rolle. Viele Führungskräfte, aber auch andere, ziehen sich immer wieder darauf zurück, wenn Situationen schwierig werden. Sie nutzen es als „Schutzschild“ anstatt aktiver zu werden oder die sozialen Kompetenzen zu erhöhen. Aktivitätskompetenzen, also dass Menschen von sich aus eigeninitiativ handeln, werden sicherlich immer wichtiger.
Es muss aber auch die strukturellen Möglichkeiten geben, die Kompetenzen zu entwickeln.
Absolut. Es gibt den Begriff von Rolf Arnold der Ermöglichungsdidaktik, der meint, dass man Menschen den Raum gibt, Kompetenzen selbst zu entwickeln. Man kann Kompetenzen nicht lehren, indem sich jemand vorne hinstellt und eine Vorlesung hält. Die Menschen müssen in Situationen gebracht werden, in denen sie Kompetenzen entwickeln, in Bezug auf Aktivitätskompetenzen beispielsweise einem Job nachgehen oder ein Projekt machen, in dem Aktivität gefragt ist. Auch Trainings sind möglich, wenn auch nicht optimal.
Wenn nun festgestellt wird, dass in den nächsten zwei Jahren eine bestimmte Kompetenz nötig ist, die im Haus noch nicht vorhanden ist, dann werden Mitarbeiter in Weiterbildungen gesteckt?
Das wäre meines Erachtens der falsche Weg. Wenn zum Beispiel eine bestimmte fachliche Fähigkeit fehlt, dann macht es wenig Sinn den Mitarbeitern ein Seminar oder ähnliches aufzudrücken. Wenn Menschen etwas lernen sollen, was sie nicht betrifft oder nicht interessiert, wird nichts hängen bleiben. Sie brauchen Leute, die sich die notwendigen Fähigkeiten einschließlich des notwendigen Wissens selbst aneignen beziehungsweise die selbst dort hingehen, wo sie es sich aneignen können, weil sie lernfähig und gewohnt sind, selbstorganisiert zu handeln.
Nun leben wir in digitalen Zeiten und Unternehmen sind gefordert, immer agiler zu werden. Heute kann es sogar passieren, dass Geschäftsmodelle sich in kurzer Zeit komplett ändern. Sind da Kompetenzmodelle nicht zu träge und unflexibel?
In der Tat umfasst ein Kern der Kompetenzentwicklung die Werteinstellungen von Menschen und die ändern sich in der Regel – genauso wie die darauf aufbauenden Schlüsselkompetenzen – eher langsam. Und wenn diese Veränderung langsamer erfolgt als die betrieblichen Prozesse selbst, steht die Personalabteilung vor einer großen Herausforderung. Es liegt an ihr, dann zu sagen, ob sie die Geschwindigkeit mitgehen kann. Es gibt aber auch immer mehr besonders wirksame Trainingsmethoden und Arbeitsprozesse, die eine schnelle Kompetenzentwicklung ermöglichen. Dafür brauchen Sie aber auch Menschen, die in der Lage sind, die Veränderungen mitzutragen, die veränderungsfähig sind und die neue Kompetenzen schnell und flexibel entwickeln können.