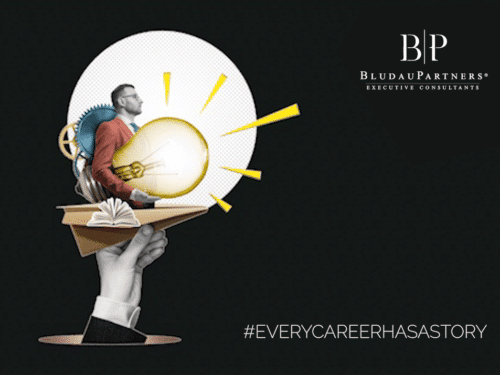Während andere gelassen im Biergarten sitzen, blickt Till Raether auf das „dunkle Gebirge“, das sich seit dreißig Jahren immer wieder schier unüberwindbar vor ihm auftürmt. In seinem autobiografischen Essay beseelt er dieses rätselhafte Phänomen mit Worten.
Es ist ein unbestimmter Schmerz, eine vage Störung im inneren System, die viele kennen, doch nicht vermögen in Worte zu fassen – oder sie gar „Depression“ zu nennen. Der Hamburger Journalist und Autor Till Raether verzweifelte jahrzehntelang an der Frage, ob diese Mischung aus Schaffen, Sich-Zusammenreißen, Liegenbleiben und Schämen zu den Unebenheiten des Lebens gehört oder er vielleicht doch von „schwarzen Bussen“ abgeholt wird. So formulierte es einst der amerikanische Schriftsteller F. Scott Fitzgerald. Busse, die ihn immer wieder an einen vertrauten Ort bringen: zu seiner Depression.
Während andere ihre Geburtstage ausgelassen begehen, sagt Till Raether die Feier anlässlich seines Vierzigsten kurz vorher ab. Die Menschen strömen im Frühling nach draußen, für ihn sind die warmen Monate mitunter die grausamsten. Er möchte sein dunkles Inneres nicht ins Sonnenlicht halten. Denn dann wird ihm schwer bewusst, „wie unleicht und unbeweglich und insgesamt einfach nicht vorzeigbar die Seele“ ist. Also bleibt er liegen, und Scham gesellt sich erbarmungslos dazu und wispert: Reiß dich zusammen! Ein Satz, den wir alle kennen und dem sich Till Raether widmet. Was sagt er eigentlich aus? Und was vermag er in uns loszutreten? Am Ende will dieser Satz, dass wir Kraft aufwenden, damit andere nicht merken, wie es uns geht. Eine unausgesprochene Forderung, die verwandt ist mit dem Satz, den Kinder sicherlich auch heute noch oft hören: Zieh nicht so einen Flunsch! Mach nicht so ein Gesicht! Aber wohin mit den Gesichtszügen, die einem einfach so traurig und schwer geworden sind, als würde das Gesicht „nach innen regieren“?
Till Raether blickt auch auf seine depressive Mutter und erkennt zerknirscht, dass er ihr all die Ratschläge gibt, die er selbst nicht zu hören erträgt (Geh doch einfach raus, meditiere oder mache Yoga!). Weil sie nicht helfen, sondern immer auch übersetzt „Reiß dich zusammen!“ verkünden.
Die Antwort auf diese Forderung unserer Zeit ist der stete Versuch, alle Erwartungen zu erfüllen. Till Raether ist gut in seinem Angestelltenjob. Er ist drei Jahre lang stellvertretender Chefredakteur bei der Brigitte und gefragter Autor und Kolumnist, unter anderem für das SZ-Magazin. Er erledigt seine Aufgaben gewissenhaft und schiebt sich selbst mit einer Mischung aus Erschöpfung und Erleichterung durch den Arbeitstag. Erschöpft, weil er ständig über seine Grenzen geht, erleichtert, weil er es schafft, Aufgaben zu bewältigen. Sein Hauptantrieb als hochfunktionaler Depressiver ist, gegen die Angst anzukämpfen, zu versagen. Bloß niemanden enttäuschen. Er ist süchtig nach Anerkennung, die er von anderen braucht, da er sie sich selbst nicht geben kann.
Sein Hausarzt nennt das alles eine „leichte bis mittlere Depression“. Später sagt ein Therapeut „depressive Episode“ dazu. Diese könne auch Jahrzehnte dauern. Am Ende klingt das alles nicht nach dem „dunklen Schimmelpelz“, der ihm auf der Seele liegt. Gleichzeitig nährt die Vagheit der Diagnose die komplizierte Mischung aus Selbsterhöhung („Ich bin zu besonders, um mir helfen zu lassen.“) und gleichzeitiger Selbsterniedrigung („Ich habe es nicht verdient, mir helfen zu lassen.“).
Er entschließt sich, zusätzlich zur Therapie Medikamente zu nehmen und erfährt dadurch, was es bedeutet, nicht mehr durch das dunkle Gebirge zu müssen, sondern die Traurigkeit wie graue Seifenblasen auf sich zukommen zu sehen. Damit ist sie zu etwas geworden, das ihn nicht ausmacht, sondern etwas, das vorübergeht. Auf einmal ist da Platz für Freude, Gelassenheit, gesunde Indifferenz. Sein vermeintliches Schwachsein wandelt sich in eine Stärke zur Freiheit; die Freiheit, Nein zu sagen und damit Ja zur eigenen Begrenztheit und emotionalen Vielfalt. „Ich bin der beschädigte Mensch, der ich immer schon war“, bekennt er, nun jedoch ohne den kräftezehrenden Versuch, dies zu verbergen. Und plötzlich wird diese Kraft nutzbar für andere Dinge. Dinge, die schön sind. Till Raether hat mit diesem äußerst persönlichen Text die verborgenen Risse, die das Gemüt durchziehen können, auf unnachahmliche Weise für uns alle sichtbar gemacht.
Till Raether: Bin ich schon depressiv, oder ist das noch das Leben?
128 Seiten, Rowohlt Polaris, 14 Euro.
Erschienen im März 2021.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Status. Das Heft können Sie hier bestellen.