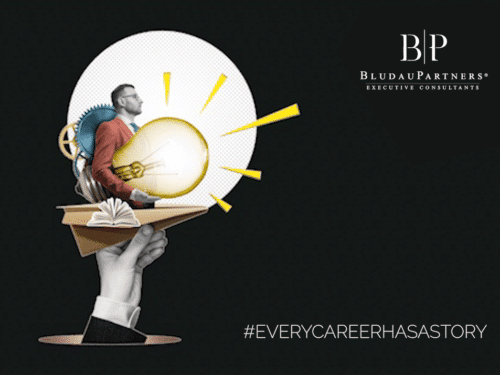Mitarbeiter mit körperlichen oder mentalen Einschränkungen können nicht immer die gleichen Arbeiten ausführen wie ihre Kollegen. Was müssen Arbeitgeber bei der Inklusion beachten?
Einzig der Schreibtischstuhl lässt erahnen, dass etwas anders ist. Das Sitzpolster ist in der Mitte geteilt. Damit kann Anika Schulz mit ihrer Beinprothese auch im Büro arbeiten – wie die anderen Mitarbeiter des Großhandelsbetriebs Edeka Nord im schleswig-holsteinischen Neumünster. Im Gegensatz zu den anderen etwa 5.800 Angestellten aber ist die Lebensgeschichte von Anika Schulz beispiellos. Es zeugt von enormer Willensstärke, dass die gelernte Handelsfachpackerin wieder arbeitet. Hinter ihr liegen ein Unfall, unvorhersehbare Komplikationen und monatelange Krankenhausaufenthalte.
Knapp einhundert Kilometer weiter südlich, im Hamburger Stadtteil Peute, sitzt Tobias Gehrmann mit seinem Ausbilder Stefan Schmoldt zusammen. Gehrmann arbeitet beim Kupferproduzenten Aurubis. Er ist hörgeschädigt. Der 23-Jährige absolviert gerade das dritte Lehrjahr als Elektroniker für Automatisierungstechnik. Und seine Leistungen sind so gut, dass unlängst der Antrag für eine Verkürzung der Ausbildungszeit von dreieinhalb auf drei Jahren gestellt wurde.
Wer hierzulande ein Handicap hat, findet schwerer einen Job
Anika Schulz und Tobias Gehrmann sind zwei von über zehn Millionen Menschen in Deutschland mit einer amtlich anerkannten Behinderung. Wer hierzulande ein Handicap hat, ob körperlicher oder geistiger Natur, findet schwerer einen Job auf dem Arbeitsmarkt als Menschen ohne Beeinträchtigung. „Menschen mit Behinderungen sind in Deutschland immer noch überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen“, sagt Verena Bentele. Die 35-Jährige ist die geschäftsführende Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Tatsächlich waren 2016 rund 171.000 schwerbehinderte Menschen ohne Arbeit, die Quote ist fast doppelt so hoch wie die Arbeitslosenquote bei Menschen ohne Behinderung. Menschen mit Schwerbehinderung suchen im Durchschnitt mehr als drei Monate länger nach einer Arbeitsstelle als Menschen ohne Behinderung. „Diesen Zustand können wir nur ändern, wenn Diversität immer mehr zur DNA der Unternehmenskultur wird“, sagt Bentele.
Die Unternehmenskultur ist das eine, das Gesetz das andere. Jede Firma mit mehr als 20 Beschäftigten muss mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze mit Mitarbeitern besetzen, die eine Behinderung haben. 2015 betrug die Quote unter privaten Arbeitgebern 4,1 Prozent. Über 93.000 Unternehmen, die die Quote gar nicht oder nicht ausreichend erfüllten, mussten die sogenannte Ausgleichsabgabe zahlen. Wer nur auf einen Anteil von zwei Prozent schwerbehinderter Mitarbeiter kommt, muss pro unbesetztem Pflichtplatz und Monat 320 Euro zahlen. Die Unterschiede zwischen den Unternehmen sind dabei eklatant. Während die meisten Konzerne mindestens vier Prozent erreichen, kommen viele kleine und mittlere Unternehmen nur auf zwei Prozent. Rund 37.000 der deutschen Arbeitgeber haben keinen einzigen Mitarbeiter mit Behinderung eingestellt.
Inklusion kann ein Gewinn für das Unternehmen sein
Gehrmanns Arbeitgeber ist bei der Anstellung von Menschen mit Handicap ganz offenbar führend. Beim Kupferhersteller beträgt die Schwerbehindertenquote über sieben Prozent. Vor zehn Jahren lag der Anteil bei fünf Prozent. „Im Vergleich mit anderen schneiden wir gut ab. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir als Industrieunternehmen viele Arbeitsplätze haben, die mit körperlicher Anstrengung verbunden sind“, sagt Aurubis-Pressesprecherin Michaela Hessling. Schulz’ Arbeitgeber Edeka Nord, einer der sieben Großhandelsbetriebe des deutschen Lebensmittelhandel-Primus, kommt aktuell auf 4,2 Prozent.
Ist Altruismus der Treiber für eine höhere Schwerbehindertenquote? Auch eine Imageverbesserung kann der Grund für die Einstellung von Schwerbehinderten sein. Abgesehen davon hat sich auch die Erkenntnis herumgesprochen: Menschen mit Handicap können ein Gewinn für das Unternehmen sein. Sie bringen sich überdurchschnittlich gut und aktiv in Teams ein und motivieren damit auch ihre Kollegen. Sie bringen andere Sichtweisen ein und legen in vielen Fällen auf Aspekte Wert, die Mitarbeiter ohne Behinderung nicht im Blick haben, von denen sie aber durchaus ebenso profitieren – etwa höhenverstellbare Büromöbel oder Aufzüge.
Nicht immer fällt eine Behinderung auf; bei Anika Schulz ist sie hingegen evident. Zum Gespräch kommt die 33-Jährige langsam den Flur entlang. Sie zieht ihr Bein nach. Schulz’ Geschichte beginnt im März 2014: Beim Fußball reißt ihr ein Kreuzband. Das passiert etwa 90.000 Menschen jährlich in Deutschland. Für Ärzte sind Kreuzbandrisse eine Routineoperation. Nur nicht in diesem Fall. Die ersten Komplikationen treten auf, als sich die Wunde nach der OP infiziert. Es folgen sechzig Eingriffe, um das Kniegelenk zu erhalten. Am Ende verbringt Schulz insgesamt zwei Jahre in Krankenhäusern. Irgendwann raten die Ärzte zur Oberschenkelamputation.
Mit Unterstützung und Eigeninitiative zurück in den Job
„Ich habe mich häufig während der Zeit gefragt, ob ich jemals wieder arbeiten kann“, sagt Schulz. „Ich hatte Bedenken, wie meine Kollegen reagieren, wenn ich wieder zur Arbeit komme.“ Anika Schulz ist kein Mensch, der sich leicht unterkriegen lässt. Vor dem Unfall arbeitete sie als ehrenamtliche Trainerin einer Mädchen-Fußballmannschaft. Gesunde Durchsetzungsfähigkeit ist dafür zwingend vonnöten.
Während der Krankenhauszeit hielt sie den Kontakt zu Kollegen und Chefs. Gleich im Anschluss begab sie sich in Reha. In einer Gehschule lernte sie mit der Prothese zu gehen. Die 30.000 Euro für den Beinersatz zahlte die Krankenkasse.
Noch während dieser Zeit prüfte sie zusammen mit ihrem Chef Magnus Kirschstein und den Kollegen aus dem betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement interne Joboptionen. „Es ist seitens des Arbeitgebers nicht einfach, eine Stelle wieder zu besetzen. Man will ja keinem vor den Kopf stoßen“, sagt Kirschstein.
„Ich bekomme vollste Unterstützung“
Anika Schulz arbeitet seit ihrer Wiedereingliederung in der sogenannten Leistungslohnerfassung. Ein Teil der Tätigkeiten beinhaltet die tägliche Erfassung und Berechnung des Leistungsdurchschnitts der Kommissionierer. „Die Eingliederung lief sehr gut“, sagt Schulz. Den 750 Euro teuren Schreibtischstuhl bezahlte das Integrationsamt der Stadt Neumünster, ebenso den höhenverstellbaren Tisch.
Und was nicht einmal der Geschäftsführung vorbehalten ist, darf sie: Mit ihrem Auto direkt vor dem Haupteingang parken. „Ich bekomme vollste Unterstützung, wenn ich sie benötige“, sagt Schulz. Beim Treppensteigen nimmt sie Stufe für Stufe.
Wie Anika Schulz bleibt auch Azubi Tobias Gehrmann seinen beruflichen Idealen treu. Er ist sogar mobiler als so manch anderer unversehrter Erwachsener. Gehrmann ist von Geburt an schwerhörig. Er wächst im nordrhein-westfälischen Leverkusen auf. 2015 zieht er nach Hamburg, wo auch seine Schwester lebt. „Ich habe durch eine Kooperation von Schwerhörigenschulen schon länger Freunde in Hamburg, und Aurubis hat am schnellsten auf meine Bewerbung geantwortet“, sagt Gehrmann.
Bereits als Jugendlicher war ihm klar, dass er in einem gewerblichen Beruf arbeiten möchte. „Ich habe einfach Spaß an Technik“, sagt er. Gehrmann trägt sogenannte Cochlea-Implantate auf der Kopfhaut. Sie bestehen aus einem Mikrofon, einem digitalen Sprachprozessor und dem Implantat selbst. Die Technologie ermöglicht ihm die Teilhabe am beruflichen und privaten Leben.
An Grenzen gestoßen
Im Arbeitsalltag sieht er sich dennoch manchmal Missverständnissen und Hürden gegenüber. Aber eine wirklich schlechte Erfahrung hat er nur während eines Schülerpraktikums gemacht. Damals fragte ihn eines Tages ein Kollege nach dem Namen eines Mitarbeiters. Gehrmann musste einen Moment überlegen. Der Kollege dachte, Gehrmann habe ihn nicht verstanden. Also sprach er immer lauter und Gehrmann war eingeschüchtert.
Bei Aurubis läuft es meistens gut. Auch wenn der ein oder andere Geselle sensibler sein könnte. Oder schlicht wüsste, dass es Schwerhörigen hilft, wenn man sie beim Sprechen direkt anschaut. Wie kürzlich, als ein Vorgesetzter einem Dutzend Azubis im Schnelldurchgang elektrotechnische Feinheiten einer Anlage erklärte. Die Worte flogen durch den Raum, jede Menge technischer Vokabeln, längst nicht jeder Begriff war für die Lehrlinge geläufig. „Ich warte dann ab und frage später in Ruhe nach“, sagt Gehrmann.
Damit er trotz der mitunter wuseligen Atmosphäre in der Berufsschulklasse dem Unterricht folgen kann, fand sich schnell eine Lösung: Der Lehrer spricht in ein Mikrofon. „So muss ich den Lehrer nicht anschauen, sondern kann mich auf das Schreiben konzentrieren“, sagt Gehrmann. Der Azubi schmiedet bereits Karrierepläne. „Ein Examen zum Techniker zu machen, wäre eine Option“, sagt er. Seine Leistungen motivieren ihn.
Die Edeka-Nord-Mitarbeiterin Anika Schulz ist zufrieden mit ihrem Job. Eigeninitiativ und mit Unterstützung hat sie den Weg zurück ins Büro gefunden. Nun setzt sie alles daran, eine höherwertige Prothese zu bekommen, um auch sportlich wieder aktiv werden zu können. „Der Sport war der Mittelpunkt meines Lebens“, sagt sie. Doch der Zugang zum Sport bleibt ihr vorerst verwehrt. Die Bezahlung einer entsprechenden Beinprothese, die rund 52.000 Euro kostet, haben Kranken- und Rentenkasse abgelehnt. Gegen den Bescheid hat Schulz Widerspruch eingelegt. Dafür ist sie in den Sozialverband Deutschland eingetreten. „Ich kann zwar vieles allein, aber da bin ich an meine Grenzen gestoßen“, sagt sie.