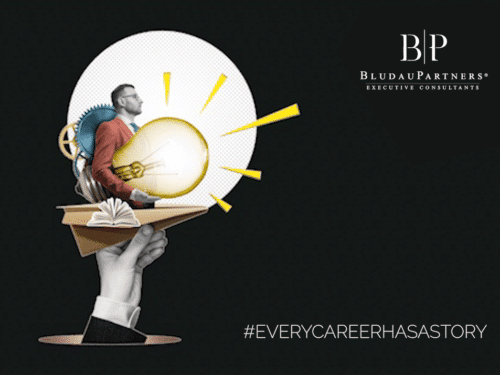Volker Kitz erklärt, warum beruflicher Erfolg nicht unbedingt Leidenschaft erfordert.
Kürzlich sollte ich einen Vortrag auf einer Tagung für Personaler halten. Mein Vorredner war ein prominenter Mann, der über das Thema „Glück bei der Arbeit“ sprach. Seine These: Wer es nicht gefunden hat, ist selbst schuld. Sein Beleg: eine wahre Geschichte, die berührt. Ein Herzchirurg in Zürich rettet Leben, verdient viel Geld, ist renommiert. Mit 56 Jahren fällt ihm auf, dass seine Leidenschaft das LKW-Fahren ist. Er macht den Führerschein, tauscht Skalpell gegen 460 PS und brettert mit 40 Tonnen über die Straßen Europas. Seine Verwandlung erregte Aufsehen. Das Publikum schaut gerührt: Ja, so einfach ist es, mit seiner Arbeit glücklich zu sein. Was mache ich falsch?
Ich lege meinen vorbereiteten Vortrag zur Seite und lade die Gäste ein, sich vorzustellen, die Geschichte hätte umgekehrt begonnen: Ein LKW-Fahrer findet mit Mitte 50 heraus, dass sein Lebenstraum darin besteht, als angesehener Herzchirurg zu arbeiten. Weiter komme ich nicht, Gelächter bricht aus. Inspirierende Erzählungen von Menschen, die ihrem Herzen folgen und plötzlich etwas ganz anderes machen – manchmal müssen wir sie nur umdrehen, um zu merken, welchem Blödsinn wir aufsitzen. Solche Geschichten schaden, denn sie suggerieren zweierlei. Erstens: Es ist so leicht, eine Arbeit zu machen, für die man brennt, und nur Trottel tun das nicht. Zweitens: Leidenschaft ist das Maß der Dinge. Beides ist falsch.
Es ist eben doch nicht so einfach, nur der Leidenschaft zu folgen. Das Gros der Gesellschaft besteht nämlich nicht aus prominenten Herzchirurgen. Der LKW-Fahrer steht für alle, die gemäß dieser Logik einfach „nur“ herausfinden müssten, was sie erfüllt, um daraus ab morgen einen Beruf zu machen. Bankangestellte, Krankenschwestern, Pressesprecher, Ärzte: Die Masse der arbeitenden Bevölkerung kann ihren Job nicht wechseln wie ein Profilfoto auf Facebook.
Leidenschaft zum Maß der Dinge zu erheben wäre sinnvoll, wenn leidenschaftliche Arbeit ein Garant für gute Ergebnisse und ein zufriedenes Leben wäre. So klingt zumindest das Diktat, das heute in Leitbildern und im Unternehmenssprech wuchert: Newsletter schreiben, Überweisungen ausführen, Toiletten schrubben – all das wird „mit“ oder „aus Leidenschaft“ gemacht. Damit wollen die Unternehmen sagen: Hier leisten begeisterte Menschen exzellente Arbeit. Es ist das Pendant zur „guten Milch von glücklichen Kühen“.
Wer die Leidenschaftsthese überprüfen will, braucht sich nur eine Folge der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) anzusehen. Dort wimmelt es von Menschen, die vor Leidenschaft für die Musik platzen – und dabei atemberaubend schlecht singen. DSDS ist ein kurzweiliger Beweis dafür, was Leidenschaft mit der Frage zu tun hat, ob jemand seine Arbeit gut macht: nichts.
Die Floskeln leidenschaftlicher Versager
Außerhalb von Fernsehsendungen gibt es weniger unterhaltsame, aber nicht weniger überzeugende Belege gegen die Leidenschaftsthese: Rechtsanwälte beherzigen die Regel, sich in einer wichtigen Angelegenheit nicht selbst zu vertreten. Ärzte operieren ungern Angehörige. Der Grund: Man ist betroffen, und damit die fehlt Distanz, der nüchterne Abstand; die Leidenschaft hätte Überhand.
Es sind die scheinbar banalen Dinge, auf die es ankommt: Sorgfalt und Zuverlässigkeit, Konzentration und Aufmerksamkeit. Einen Termin im Kalender eintragen. Einer Kundin oder einem Mitarbeiter genau zuhören. Nachdenken, bevor man spricht. Sich am nächsten Tag an das erinnern, was man gesagt hat, und sich daran messen lassen. Für diese schlichten Anforderungen braucht man Besonnenheit und die Bereitschaft, sich mit Details zu beschäftigen. An ihre Stelle ist heute oft ein mehr oder weniger fröhliches „Sorry, ist mir durchgerutscht“ getreten.Leidenschaft ist die Gegenspielerin der genannten Fähigkeiten. Sie schafft ein erregtes Grundrauschen, das nüchterne Distanz zum eigenen Handeln zerstört. Sie täuscht mit flotten Floskeln darüber hinweg, dass gute Arbeit oft aus wenig glamourösen Zutaten entsteht.
Einsteiger sind häufig schockiert, wenn sie erfahren, wie sich der Arbeitsalltag von dem unterscheidet, was sie aus der Ausbildung kennen. Im Studium ist die Kurve steil. Dass es in der Berufsausübung umgekehrt sein wird, sagt ihnen niemand. Kommt das Arbeitsleben in Büchern, Zeitungen, Film oder Fernsehen vor, geht es selten um Alltagsroutine: Ein Arzt rettet jede Sekunde Leben, die Stewardess eines Kreuzfahrtschiffs bringt Menschen zusammen (Traumhochzeit folgt!), Journalisten decken den großen Skandal auf. Ein Getränk servieren, ein Formular ausfüllen, eine Kostenstelle eintragen, ein Interview redigieren – was 95 Prozent der Berufe ausmacht, findet in den medialen Darstellungen nicht statt. Und in Stellenanzeigen und Bewerbungsgesprächen kommen Routineaufgaben ohnehin nicht vor. Unsere Gesellschaft neigt dazu, so zu tun, als bestünde Arbeit nur aus Spaß, Spannung und tollen Menschen um uns herum.
Leidenschaftszwang macht unglücklich
Es gibt Menschen, die leidenschaftlich arbeiten und mit ihrem Leben glücklich sind. Es gibt Menschen, die leidenschaftlich arbeiten und mit ihrem Leben unglücklich sind. Und es gibt glückliche Menschen, die nicht für ihren Beruf brennen. Leidenschaft bei der Arbeit steht in keinem zwingenden Verhältnis zu einem gelungenen Leben. Und zur Qualität der Arbeit sowieso nicht. Es ist der Leidenschaftszwang, der über Generationen einen Schleier des Unglücklichseins gelegt hat. Wir tun so, als wäre Leidenschaft bei der Arbeit Normal- und Idealfall zugleich: Wer seine Arbeit nicht mit an Besinnungslosigkeit grenzender Hingabe verrichtet, gilt als suspekt. Millionen Menschen sitzen im Büro, stehen am Fließband oder hinter der Theke und fragen sich: Was läuft falsch bei mir? Sie suchen, grübeln und verzweifeln.
Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich lese, dass ein Unternehmen Mitarbeiter sucht, die „leidenschaftlich“ arbeiten. Ich würde jemanden suchen, der gut arbeitet. Beschäftigte sollten nicht daran gemessen werden, wie gut sie ihre Arbeit finden, sondern daran, wie gut sie sie machen. Das wäre nicht nur gerechter, es wäre auch motivierend. Ehrlichkeit steigert Zufriedenheit und Produktivität. Es ist einen Versuch wert.