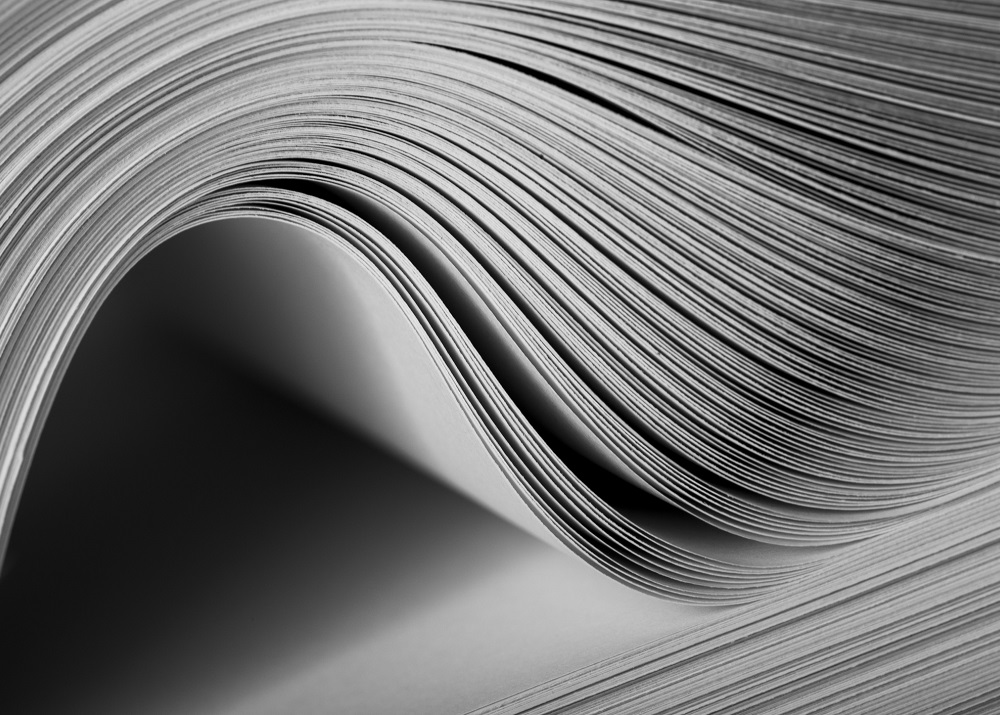Arbeitgeber sind verpflichtet, ihren Beschäftigten die wesentlichen Vertragsbedingungen zu Beginn ihrer Tätigkeit mitzuteilen. Diese Pflicht ergibt sich aus dem Nachweisgesetz in weitgehend unveränderter Form seit 1995. In der arbeitsrechtlichen Praxis fand das Gesetz bislang jedoch wenig Aufmerksamkeit. Die Übergabe eines verschriftlichten Arbeitsvertrags ist ohnehin in Deutschland recht üblich. Ob in dem Vertrag der gesamte Katalog von Informationen im Sinne des Nachweisgesetzes enthalten war, wurde bislang in den meisten Unternehmen nicht im Detail verifiziert, weil Verstöße in der Praxis keine Sanktionen nach sich zogen.
Mit der Überarbeitung des Nachweisgesetzes, die zum 1. August 2022 wirksam wurde, ändert sich nun die Situation. Interessenverbände sparen nicht mit Kritik an der gesetzlichen Neuerung und Personalabteilungen schütteln den Kopf über die Auswirkungen des Gesetzes für ihre Prozesse. Für eine Weile beschäftigten sich Arbeitsrechtler und Inhouse-Juristinnen jedenfalls mit kaum einem Thema so häufig wie mit der Umsetzung dieser Gesetzesänderung. Besonders betroffen sind Unternehmen, die ihre Arbeitsverträge in elektronischer Form abschließen. Was ist also passiert?
Festhalten an Schriftform und empfindliche Sanktionen
Zur Umsetzung der EU-Richtlinie über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen ergänzte die Gesetzgebung den Katalog der mitteilungspflichtigen Vertragsbedingungen im überschaubaren Umfang. Diese Neuerung hätte gewiss keine derart große Resonanz erzeugt. Deutlich gewichtiger ist die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form der Mitteilung. Es war zwar bereits im Nachweisgesetz von 1995 die Schriftform vorgesehen, seit 2001 kennt das Bürgerliche Gesetzbuch allerdings in § 126a die elektronische Form. Diese ist hinsichtlich der qualifizierten elektronischen Signatur mit einer handschriftlichen Unterschrift gleichzusetzen. Viele Unternehmen schließen Arbeitsverträge darum mittlerweile elektronisch ab.
Den Nachweis in elektronischer Form schließt das Nachweisgesetz jedoch ausdrücklich aus. Diese Vorgabe geht über jene der EU-Richtlinie hinaus. Dort heißt es in Artikel 5 Absatz 1, dass der Nachweis „als Dokument“ erfolgen muss. Das schließt insbesondere eine elektronische Form ein. Im heutigen Zeitalter der Digitalisierung und des Vormarsches digitaler Prozesse in allen Bereichen ist unverständlich, warum der Gesetzgeber hierzulande an veralteten Vorschriften wie der Schriftform festhält, wenn doch die EU-Richtlinie Tür und Tor zu modernem Handeln offen gelassen hat.
Andere Staaten sind weiter. In Belgien etwa besteht jedenfalls bei einem unbefristeten Arbeitsverhältnis keine Schriftformerfordernis hinsichtlich des Nachweises der Arbeitsbedingungen. Schweden geht einen Mittelweg und gibt eine schriftliche Mitteilung nur vor, wenn die künftige Arbeitskraft sie fordert. Durch den Ausschluss der elektronischen Form erzeugt das neue Nachweisgesetz einen unnötigen bürokratischen Aufwand. Eine Begründung für die Entscheidung, nur die Schriftform und nicht die elektronische Form gelten zu lassen, liefert der Gesetzgeber erstaunlicherweise nicht.
Schnell kam in Unternehmen die Frage auf, ob nicht eine pragmatische Anwendung unter Missachtung der Schriftform möglich sei. Doch dies ist riskant. Denn mit der Ausweitung der Nachweispflicht ergänzte der Gesetzgeber auch eine Sanktion bei Verstößen. Ein unterlassener oder nicht ausreichender Nachweis der Vertragsbedingungen stellt seit dem 1. August 2022 eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit Bußgeldern von bis zu 2.000 Euro – je Verstoß – geahndet werden kann. Auf den ersten Blick erscheint es schwer vorstellbar, dass Ordnungsbehörden Strafen verhängen, weil Unternehmen zwar die inhaltlichen Anforderungen des Nachweisgesetzes beachten, jedoch ausschließlich in elektronischer Form informieren. Doch werden Unternehmen das verbliebene Risiko eingehen und sich einer Verfolgung der Ordnungsbehörden aussetzen? Eher nicht.
Digitaler Arbeitsvertrag ist weiterhin möglich
Entgegen einem derzeit weit verbreiteten Irrtum können Arbeitsverträge jedoch nach wie vor digital abgeschlossen werden. Um dem Nachweisgesetz zu genügen, müssen Arbeitgeber den Beschäftigten dann jedoch zumindest einen schriftlichen (also im Original unterschriebenen) Beipackzettel aushändigen, der die Informationen des Katalogs aus Paragraph 2 Absatz 2 Nachweisgesetz enthält. Dieses Vorgehen erscheint auf den ersten Blick unnötig kompliziert. Es kann aber insbesondere sinnvoll sein, wenn zugleich die Arbeitsverträge kurz gehalten werden sollen. Denn mit einer umfassenden Wiedergabe dieses Katalogs werden Arbeitsverträge in den meisten Fällen deutlich umfangreicher.
Aus diesem Grund erwägen im Übrigen einige Arbeitgeber, einen derartigen Beipackzettel zu erstellen, obwohl sie ihre Arbeitsverträge schriftlich abschließen. Dann bedarf es des Beipackzettels nicht, wenn der Arbeitsvertrag alle Angaben enthält, die das Nachweisgesetz erfordert. Mit diesem Procedere lässt sich aber der Arbeitsvertrag überschaubar halten.
Wichtig bleibt dabei die Beachtung der Fristen des Nachweisgesetzes. Bereits am ersten Tag der Arbeitsleistung müssen die Angaben zu den Vertragsparteien, zum Arbeitsentgelt und den vereinbarten Arbeitszeiten verschriftlicht sein. Für weitere Angaben bleiben sieben Tage oder gar ein Monat. Zur Vereinfachung der Prozesse empfiehlt es sich aber, die unterschiedlichen Fristen nicht auszuschöpfen, sondern alle Arbeitsbedingungen zeitgleich schriftlich nachzuweisen.
Nicht zuletzt müssen Arbeitgeber bereits aktiven Beschäftigten eine Mitteilung über die Vertragsbedingungen zukommen lassen. Hier hatte der Gesetzgeber ein Einsehen und setzt zumindest ein ausdrückliches Verlangen der Beschäftigten voraus. Bislang halten sich derartige Forderungen zur Entlastung der Personalabteilungen in Grenzen. Spätestens über Anpassungen im laufenden Arbeitsverhältnis wie einer Gehaltserhöhung oder Änderung der Arbeitszeiten muss der Arbeitgeber dennoch – wie dargelegt – schriftlich informieren.
Geht die Digitalisierung an Deutschland vorbei?
Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung gibt es ein Kapitel mit dem Titel Respekt, Chancen und soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt. Bereits dem Titel nach will die Koalition also mehr Fortschritt wagen. Vor diesem Hintergrund ist es unerklärlich, dass Unternehmen Archive anlegen müssen, um handschriftlich unterzeichnete Dokumente aufzubewahren – zumal der Gesetzgeber damit zum wiederholten Male die Chance einer Digitalisierung nicht nutzt.
In der Fachwelt weckt dies Erinnerungen an die virtuelle Einigungsstelle. Trotz weitgehend einhelliger Forderungen aus der Praxis nach einer dauerhaften Regelung ließ der Gesetzgeber eine zeitlich befristete Regelung auslaufen, wonach Einigungsstellen im Lichte von Lockdowns und Kontaktbeschränkungen ohne physisches Treffen möglich gewesen wären. Ebenso wenig schafft der Gesetzgeber die Möglichkeit, Betriebsratswahlen zu digitalisieren und Online-Wahlen zu ermöglichen. Das ist im Zeitalter digital agierender Unternehmen und remote arbeitender Beschäftigten wenig fortschrittlich. Eine Online-Betriebsratswahl wäre gegenüber einer Wahl mit Stimmzetteln auf Papier umweltschonender und könnte zu einer höheren Wahlbeteiligung führen. Dies wiederum könnte zu einer Stärkung der demokratischen Legitimation des Betriebsrats beitragen. Was bleibt, ist ein Papierzwang und ein deutlicher Mehraufwand für die Arbeitgeber. Ein Mehrwert für Beschäftigte aus der Aufrechterhaltung der Schriftform ist nicht zu erkennen. Auch ein Mehrwert für Gerichtsverfahren und behördliche Vorgänge ist nicht gegeben. Elektronische Dokumente sind dort mittlerweile zu Beweiszwecken gängig. Das betont auch der Deutsche Anwaltsverein und der Bund der Arbeitsgerichtsbarkeit. Doch der Gesetzgeber ließ sich nicht beirren und hielt entgegen den Forderungen der Fachverbände an der Forderung der Schriftform fest.
In besonderer Weise werden Arbeitgeber mit formalen Hürden belastet, die sich für den Abschluss von Arbeitsverträgen in elektronischer Form oder gar der gesamten Personalakte entschieden haben. Damit widerspricht die Regierungskoalition ihrer selbst ausgerufenen Digitalisierungsstrategie. Wünschenswert wäre, dass der Gesetzgeber umdenkt und sich für weniger strenge Formvorschriften öffnet. Doch das bleibt ein frommer Wunsch, der sich auf absehbare Zeit leider nicht realisieren dürfte.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Grenzen. Das Heft können Sie hier bestellen.