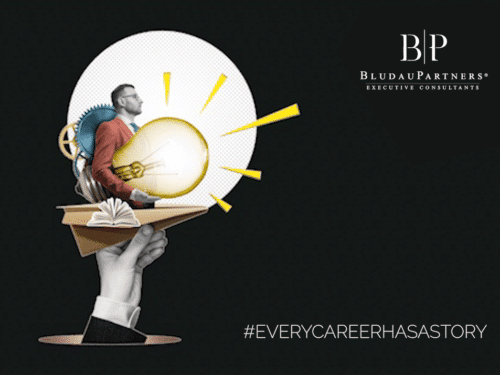Jede Personalabteilung, die etwas auf sich hält, kann heute ein akribisch ausformuliertes Kompetenzmodell vorweisen. Doch in immer mehr Unternehmen wird klar: Viele der bestehenden Kompetenzmodelle sind zu unbeweglich für eine agile, dynamische Arbeitswelt.
Erich Unkrig weiß: Wenn sich die Ereignisse überschlagen, ist es wichtig, ruhig zu bleiben, langfristig zu denken und besonnen zu handeln. Seit sieben Jahren ist er Leiter der Personalentwicklung bei der Deutschland-Tochter des französischen Atomkonzerns Areva. 4.800 Mitarbeiter entwickeln in Deutschland für Areva Sicherheitstechnik, Brennelemente und Versuchsanlagen für Kernkraftwerke. Ruhige Zeiten hat es für die Kernenergie-Spezialisten schon lange nicht mehr gegeben: Spätestens seit dem Beginn der Energiewende in Deutschland ist die Branche hierzulande im Umbruch. Und auch der französische Mutterkonzern steckt mitten in einer Umstrukturierung. „Die Energiebranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, insbesondere in Deutschland“, sagt Unkrig. „Deshalb stellte sich in unserem Unternehmen die Frage: Welche Kompetenzen haben und brauchen wir im Unternehmen, um, wie man im Krisenmanagement so sagt, vor die Krise zu kommen. Statt nur von ihr getrieben zu werden.“
Eigentlich hätte den Personalverantwortlichen die Antwort auf diese Frage leicht fallen müssen. Denn der Energietechnik-Konzern konnte zur Analyse vorhandener Kompetenzen auf ein ausgeklügeltes achtstufiges Kompetenzmodell zurückgreifen, das seit langem im Unternehmen etabliert war. Und wozu ist so ein Kompetenzmodell da, wenn nicht um die Frage zu beantworten, ob ausreichend erfolgskritische Kompetenzen im Unternehmen vorhanden sind?
Ein Kompetenzmodell legt per Definition fest, welche unternehmensspezifischen Kernkompetenzen Mitarbeiter mitbringen oder entwickeln müssen, damit ein Unternehmen seine Ziele erreichen kann. Aus diesem, oft recht abstrakten, Grundmodell lassen sich dann funktions-, rollen- oder positionsspezifische Anforderungen ableiten, die oft in detailreichen, mehrstufigen Kompetenzkatalogen niedergeschrieben werden. Mit solchen ausgeklügelten Modellen wollen Personaler Systematik und Vergleichbarkeit schaffen, eine einheitliche Sprachregelung als Basis für die gesamte Personalentwicklung finden – und nicht zuletzt auch gegenüber der Geschäftsführung strategische Relevanz beweisen. Denn wer mit Powerpoint kompatiblen Kennzahlen und detailreichen Schaubildern Auskunft darüber geben kann, wie sich das Kompetenz-Reservoir im Unternehmen zusammensetzt und entwickelt, kann bei Meetings mit der Geschäftsführung durchaus beeindrucken.
Je komplexer und kleinteiliger ein Kompetenzkatalog ist, desto besser, schien dabei lange vielerorts die Devise zu lauten. Das Problem: Dabei blieben vor lauter Begeisterung für Details oft die Aussagekraft und der Realitätsbezug der Modelle auf der Strecke. „Viele Kompetenzmodelle, die wir in der Unternehmenspraxis sehen, sind leider schlecht gemacht“, kritisiert Martin Kersting, Professor für Personalpsychologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. „Häufig sind Modelle zu kleinteilig angelegt, sie definieren Kompetenzen zu eng“, erklärt er. „Dann kann ich zwar alles messen und in Kennzahlen fassen, aber am Ende habe ich ein überkomplexes und starres System, aus dem ich keine praxisrelevanten, zukunftsorientierten Aussagen für den dynamischen Unternehmensalltag mehr ableiten kann.“ Oft würden Kompetenzmodelle zudem im stillen
Kämmerlein von Experten und Beratern geschrieben, statt sie gemeinsam mit Mitarbeitern und Führungskräften aus der Unternehmenspraxis heraus zu entwickeln. „Die Sprache bleibt dann insgesamt oft zu abstrakt und ungenau. Auf der einen Seite sieht man nichtssagende Formulierungen wie „Power to the People“. Und auf der anderen Seite zu detailverliebte Ansätze, mit Details wie Präsentationskompetenzen.“ Statt sich den grundlegenden Merkmalen zuzuwenden, die für verschiedene Anforderungen relevant sind, wende man sich Fertigkeiten zu, die sich zwar leicht messen lassen, aber keine übergeordnete Bedeutung haben, kritisiert Kersting. Mit solchen Modellen könne man keine praktische Personalarbeit machen.
Konkrete Handlungsanweisungen
Vor ähnlichen Problemen standen auch die Areva-Personaler, als sie im Jahr 2013 anhand des bestehenden Kompetenzmodells eine zukunftsfähige, unternehmerisch wirksame Grundlage für die Personal- und Führungskräfteentwicklung schaffen sollten. „Das ursprüngliche Kompetenzmodell war in einer aus psychologischer Perspektive sehr präzisen Sprache formuliert, traf jedoch nicht die Sprache unserer internen Kunden“, sagt Personalentwickler Unkrig. „Vor allem aber passte es nicht mehr zu den veränderten Anforderungen.“ Also begann auf Konzernebene ein Dialog über eine Reform, bei dem auch um Grundsätzliches gerungen wurde: „Wir haben kontroverse Diskussionen geführt, bei denen es zum Beispiel darum ging, den Begriff Kompetenz von dem der Qualifikation abzugrenzen“, berichtet Unkrig.
Als Kompetenzen definierte das Unternehmen ein Bündel von geistigen und praktischen Fähigkeiten, Einstellungen und Werten, mit denen Mitarbeiter anstehende Aufgaben und Probleme eigenverantwortlich lösen können. „Die darin beschriebenen Kompetenzen sind für Areva erfolgskritisch – es gilt, sie im Unternehmen zu stärken, und, wo nötig, zu entwickeln“, sagt Unkrig. Qualifikationen im Sinne aktuell vorhandener fachlicher, funktionaler Fähigkeiten hingegen könnten und müssten im Unternehmen laufend angepasst werden. „Fachliche Kompetenzen unterliegen einem viel schnelleren Wandel als soziale, persönliche und Führungskompetenzen“, sagt Unkrig. „Ich bin daher überzeugt, dass Unternehmen eher vermeiden sollten, diese fachlichen und funktionalen mit den letztgenannten Kompetenzfeldern in einem Modell abzubilden“, sagt er. „Denn die Vermischung würde die Halbwertszeit eines Modells drastisch reduzieren.“ Ein Kompetenzmodell, das ständig aktualisiert werden muss, könne aber nicht Sinn und Zweck sein. „Ein Kompetenzmodell muss unbedingt langlebig sein. Es geht ja darum, aus einem solchen Modell heraus langfristige Lern- und Entwicklungsprozesse vor allem in den genannten persönlichen, sozialen und Führungskompetenzen zu initiieren und zu gestalten“, sagt Unkrig. „Wenn Sie regelmäßig das Kompetenzmodell als Orientierungspunkt ändern, dann torpedieren Sie auch die damit verbundenen Lern- und Entwicklungsprozesse.“
Am Ende des Diskussionsprozesses bei Areva standen statt acht nur noch fünf Kompetenzfelder: Mitarbeiter sollen Strategien in Aktionen umsetzen können, Veränderungen vorantreiben, Teams und Mitarbeiter motivieren, vorgegebene Ergebnisse erreichen und Kreativität fordern und fördern. „Das hat natürlich erst mal eine gewisse Flughöhe. Wichtig war, das Ganze so zu übersetzen, dass Mitarbeiter auch verstehen, welche Anforderungen das Modell an sie persönlich in ihrer jeweiligen Rolle stellt“, sagt Unkrig. Daher wurde jedes Kompetenzfeld für die drei Rollen Führungskraft, Mitarbeiter und Kollege beschrieben. „Wir haben sehr konkrete Handlungsanweisungen formuliert, die genau definieren: Was heißt das konkret für mich als Führungskraft, was heißt das für mich als Mitarbeiter, was heißt das für mich als Kollege“, erklärt der Personalentwickler. „Mitarbeiterbefragungen zeigen uns, dass tatsächlich alle Mitarbeiter mit dem neuen Modell gut arbeiten können“, sagt er. „Es gilt als pragmatisch und selbsterklärend. Aber vor allem: Es bringt einen echten Mehrwert – und darum geht es ja.“
Ähnlich wie bei Areva ist derzeit in vielen Unternehmen der Ruf nach neuen, agilen Kompetenzen bei Führungskräften und Mitarbeitern zu hören, berichtet Benedikt Hackl, Leiter des Forschungsinstituts HR-Impulsgeber in München. „Unternehmen brauchen eine agile Führungs- und Lernkultur, wenn sie auf den immer dynamischeren Märkten bestehen wollen“, sagt Hackl. Reaktionsfähigkeit, Flexibilität, Schnelligkeit und umgehende Kompetenzanpassung an veränderte Umweltbedingungen seien gefragt. „Das Problem ist, dass es vielerorts noch an fundierten Konzepten fehlt, um die nötigen Kompetenzen für diese neue Kultur zu entwickeln.“ Viele Unternehmen seien derzeit in einem Findungsprozess. „Man sucht nach neuen Kompetenzmodellen, um die Unternehmenskultur zu verändern.“
Die Kultur muss sich ändern
In diesem Prozess befindet sich auch die AOK Baden-Württemberg. Im Jahr 2015 hat die Krankenkasse das Kompetenzmodell für mehr als 10.000 Mitarbeiter überarbeitet. Auch hier stand am Anfang der Reform die Erkenntnis: Die Unternehmenskultur muss sich verändern. „Das Gesamtunternehmen soll sich weg von einer Anweisungs- und hin zu einer Verantwortungshierarchie und kooperativen Managementpraxis entwickeln“, erklärt Martin Hofmann, Leiter strategische Personalentwicklung. Kern des neuen Kompetenzmodells bilden daher die Entwicklungswerte Sinnorientierung, Eigeninitiative, Mut und Stolz. „Diese Werte beschreiben die innere Haltung, die wir uns von allen Mitarbeitern und Führungskräften wünschen“, sagt Hofmann.
Damit das Modell auch tatsächlich in der Unternehmenspraxis ankommt und gelebt wird, setzen die Personalentwickler auf ein IT-basiertes Tool: Mitarbeiter können im Intranet auf das sogenannte Kompetenzhaus zugreifen. Es macht transparent, welche Kompetenzen auf jeder Ebene des Unternehmens erwartet werden und gibt Anwendungstipps für die Praxis. Die Mitarbeiter können nicht nur genau sehen, was von ihnen erwartet wird – sondern auch, welche Anforderungen das Unternehmen an jeden ihrer Kollegen stellt. Diese neue Transparenz bewegt etwas im Unternehmen. „Die Resonanz ist sehr groß, das Feedback positiv“, sagt Hofmann. Bis zu 5.000 Klicks monatlich registriert das Kompetenzhaus. „Es lenkt den Blick auf die eigene Person und zeigt: Veränderung beginnt mit mir selbst“, erklärt Hofmann den Effekt. „Wir wollen mit dem neuen Kompetenzmodell bewusst einen langfristigen Prozess anstoßen“, sagt er. Noch stehe man am Anfang der gewünschten Entwicklung. „Wir wollen ja nicht weniger als eine neue Geisteshaltung bei jedem einzelnen der 10.000 Mitarbeiter verinnerlichen.“
Vier Schritte zum Kompetenzmodell
Ein Kompetenzmodell auf die Beine zu stellen, das die Personalentwicklung und das Unternehmen strategisch wirklich weiter bringt, ist ein zeitaufwändiges Projekt. Damit sich Personaler nicht verzetteln, sollten sie es strukturiert in vier Schritten angehen.
1. Planung und Kontext-Analyse
Ein gutes Kompetenzmodell setzt bei einer Analyse des Unternehmenskontextes an: Es gilt, Informationen zusammenzutragen über aktuelle und zukünftige Unternehmensziele, Marktbedingungen, Unternehmenskultur, Kunden, Beziehungen der Mitarbeiter untereinander und Führungsverhalten.
2. Modellentwicklung
Im nächsten Schritt gilt es, die gesammelten Informationen zu ordnen und eine klare, exakte und differenzierte Beschreibung der gewünschten Kompetenzen zu finden: Welche Kompetenzen sind für alle Mitarbeiter erfolgversprechend? Welches Verhalten und welche Leistungen stecken dahinter? In welchen Ausprägungen kommen die Kompetenzen vor?
3. Kompetenzen operationalisieren
Das Kompetenzmodell soll ohne Brüche für sämtliche Tools der Personalentwicklung genutzt werden: Es gilt also, das Modell an alle Tools und Bereiche der Personalarbeit anzuschließen, von Mitarbeitergesprächen über die Leistungsbeurteilung bis hin zu Führungskräfte-Coachings.
4. Monitoring und Anpassung
Gibt es neue Unternehmensziele, neue Geschäftsführer oder unerwartete Marktentwicklungen? Haben diese Auswirkungen auf die geforderten Kompetenzen? Mit dem einmaligen Formulieren eines Kompetenzmodells ist es nicht getan. Es muss laufend auf Aktualität überprüft werden.