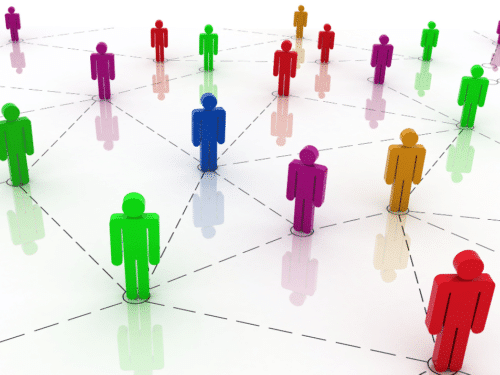Die Corona-Krise offenbart die Schwachstellen unserer Gesellschaft und unserer Arbeitswelt. Die Autorin und Philosophieprofessorin Lisa Herzog über die ungleiche Verteilung von Anerkennung und Lohn, die drohende Revolution der Mittelschicht und darüber, wie eine Arbeitswelt nach der Pandemie aussehen könnte.
Frau Herzog, wir führen dieses Gespräch Ende März. Wenn das Interview veröffentlicht wird, könnte die Lage in Bezug auf die Corona-Krise wieder eine ganz andere sein. Ist es überhaupt schon an der Zeit, darüber nachzudenken, wie unsere Arbeitswelt nach der Pandemie aussehen wird?
Wir sollten uns unbedingt und grundsätzlich immer Gedanken über die Arbeitswelt machen, auch weil sich in den vergangenen Jahren ein paar Dinge in eine problematische Richtung entwickelt haben. Die derzeitige Krise macht die Diskrepanzen sichtbar.
Welche Diskrepanzen meinen Sie?
Es geht darum, wie bestimmte Gruppen in der Arbeitswelt wahrgenommen und behandelt werden, jetzt und vor der Krise. Die gesellschaftliche Anerkennung und die Einkommen sind höchst ungleich verteilt. Das betrifft Pflegekräfte, Kassierer oder jene, die in der Logistik arbeiten. Berufe, die als niedere Tätigkeiten abgetan worden sind. Jetzt sind sie es, die das aktuelle öffentliche Leben noch am Laufen halten. Und alle stellen fest: Ohne sie kommt unsere Gesellschaft nicht aus. Und dann gibt es auch noch die Dienstleistungen, die zwar nicht überlebensnotwendig, aber für unser Sozialleben unglaublich wichtig sind: Restaurants, Cafés, kleine Geschäfte. Die Frage ist: Wird es sie nach der Krise noch geben? Oder bleiben nur die großen globalen Konzerne übrig? Unser gesellschaftliches Leben wäre dann sehr viel ärmer.
Derzeit ist ein Teil der Gesellschaft mit Kurzarbeit und langen, gleichförmigen Tagen mit Ausgangsbeschränkungen konfrontiert. Ärzte und Pfleger hingegen schieben 24-Stunden-Schichten und sind einer hohen Ansteckungs- und Lebensgefahr ausgesetzt, so wie auch der überarbeitete Kassierer im Supermarkt, der dann auch noch beschimpft wird, weil das Toilettenpapier rationiert werden musste.
Normalerweise schafft Arbeit positive Formen des Soziallebens. Doch das funktioniert jetzt nicht mehr. Die einen sind einsam und stellen fest, wie sehr ihnen der soziale Kontakt fehlt. Die anderen erleben extrem verdichtete Formen der Arbeit, die nur noch ein sehr eingeschränktes Miteinander zulassen. Es ist kaum Zeit, sich besonnen zu besprechen, weil lebensnotwendige Aufgaben keinen Aufschub dulden.
Warum ist das soziale Miteinander im Arbeitskontext so wichtig?
Gerade wenn schwierige ethische Entscheidungen anstehen, ist es wichtig, dass es genügend Zeit gibt, um diese Situation mit Kollegen zu besprechen, um innezuhalten und in Ruhe zu überlegen: Wie geht man nun vor? Dann beispielsweise, wenn sich Ärzte fragen müssen: Wen können und sollten wir retten, wenn nur noch ein Beatmungsgerät zur Verfügung steht?
Momentan geht es sehr viel um die unbürokratische und durchaus großzügige Rettung von Unternehmen. Mitarbeiter hingegen haben qua Kurzarbeitszeit Lohneinbußen hinzunehmen. Wie wird sich dieses Gefälle auswirken?
Die Gefahr dabei ist, dass Ungleichheiten weiter verschärft werden. Meine größte Sorge ist, dass die jetzt schon Privilegierten noch privilegierter sein werden und diejenigen, die ohnehin benachteiligt sind, weiter abrutschen. Das ist der klassische Matthäus-Effekt: Wer hat, dem wird gegeben, und wer wenig hat, dem wird auch das noch genommen. Ich befürchte, dass die Generation, die nach der Krise das erste Mal in den Arbeitsmarkt eintritt, enorm schlecht dasteht. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Kohorten, die in Krisenzeiten auf den Arbeitsmarkt kommen, ihr Leben lang ein niedrigeres Gehalt haben, während jene, die bei einer guten Konjunktur in den Arbeitsmarkt eintreten, langfristig besser verdienen. Auch längere Schulschließungen können negative Auswirkungen haben, weil nicht alle Kinder bei den Schularbeiten unterstützt werden können, was sich wiederum negativ auf die Chancengleichheit auswirkt.
Wie könnte ein drohender Anstieg dieser ungleichen Verteilung abgefedert werden?
Wir müssen diejenigen, die jetzt weniger unter der Krise leiden oder vielleicht sogar davon profitieren, in die Pflicht nehmen. Man könnte Abgaben auf die größten Vermögen einführen, um die durch Corona entstandenen Schäden aufzufangen. Denn diese Vermögen können nur durch all die Menschen erhalten bleiben, die gerade alles geben, um die Gesellschaft auch jetzt noch weiter zu versorgen.
Vor der Pandemie ging es Deutschland wirtschaftlich betrachtet vergleichsweise gut. Diese Situation erlaubte es, in Ruhe über eine Veränderung der Arbeitswelt nachzudenken. Das wirkt rückblickend wie Luxus, jetzt wo es ums nackte Überleben auf allen Seiten geht. Wie wird uns die Rezession in der Art und Weise, wie wir arbeiten, beeinflussen?
Das kommt darauf an, was wir als Gesellschaft aus dieser Krise machen. Es gibt auch positive Effekte: Wir sehen viel stärker, welche Berufsgruppen wichtige Beiträge leisten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das deutsche System, mit Kündigungsschutz, Mitbestimmung und Kurzarbeitsregelungen, wieder aufgewertet wird, weil wir damit womöglich viel besser durch die Krise kommen werden als mit einem stark deregulierten System wie im angelsächsischen Raum. Denkbar ist auch, dass sich die Bereitschaft, digitale Instrumente zu nutzen, erhöht, weil die Unternehmen derzeit sehen: Es geht ja doch. Das wiederum könnte auch generell die Partizipation von Angestellten stärken. Vieles lässt sich digital entscheiden und über die meisten Themen können die Mitarbeiter digital und dadurch auch kostengünstig abstimmen.
Sie sagen, dass digitale Werkzeuge die Demokratisierung von Unternehmen voranbringen können, weil sie eine gemeinsame Diskussion aller Beteiligten ermöglichen. Derzeit werden besagte Tools mehr denn je genutzt. Wird ihre Verwendung die Krise überdauern und die Arbeitswelt demokratisieren?
Allein durch die Verwendung eines digitalen Tools wird Macht nicht automatisch geteilt. Allerdings wurde bisher oft das Argument gegen partizipative Strukturen vorgebracht, dass sie zu teuer seien. Aber das stimmt einfach nicht, wenn man digitale Tools dabei intelligent nutzt. Die Frage wäre dann vielmehr: Wer darf eine Online-Abstimmung einberufen? Dürfen das dann wieder nur die Führungskräfte oder dürfen so etwas auch die Mitarbeiter initiieren?
Sie arbeiten als Philosophieprofessorin an der Universität Groningen. Wie ist die Lage in den Niederlanden?
Ich bin jetzt wieder in Deutschland. Der Unibetrieb läuft jetzt komplett online weiter und so wird es wohl bis Ende des akademischen Jahres auch bleiben. In den Niederlanden verfolgt man generell einen etwas liberaleren Ansatz: Es wurden zum Beispiel weniger Restriktionen angesichts der Pandemie auferlegt. Es gibt keine Ausgangsbeschränkungen und viele Geschäfte haben noch geöffnet. Aber der öffentliche Druck hat dazu geführt, dass nun doch Kitas und Schulen geschlossen worden sind, wie in anderen europäischen Ländern auch.
Die Kitas und Schulen sind hierzulande ebenfalls seit Wochen geschlossen und Eltern reiben sich zunehmend, trotz Kurzarbeit, zwischen Arbeit und Erziehung auf.
Hoffentlich spricht sich dadurch endlich bei den sogenannten Entscheidungsträgern herum, dass Fürsorgearbeit eben auch Arbeit ist, die immer jemand machen muss. Vielleicht sind die Arbeitgeber nach der Krise eher bereit, flexiblere Lösungen für die Bewältigung des Arbeitsalltags zu finden und Homeoffice und andere Mechanismen – wie Arbeitszeitkonten – im Sinne der Vereinbarkeit zu stärken. Vielleicht gelingt es uns, von dieser Anwesenheitskultur wegzukommen. Ich verstehe nicht, warum das System in Deutschland immer noch so starr ist.
Nur elf Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland haben vor der Krise häufig oder zeitweise im Homeoffice gearbeitet. In den Niederlanden waren es bereits fast 40 Prozent. Wie erklären Sie sich diesen Unterschied?
Das Bewusstsein dafür, dass Familien Zeit füreinander brauchen, ist in den Niederlanden ausgeprägter. Es ist häufig so, dass beide Elternteile jeweils achtzig Prozent arbeiten, also jeder einen Tag in der Woche mit den Kindern verbringt. Deswegen könnte es sein, dass die Flexibilität in der Wahl des Arbeitsorts eine größere ist als in Deutschland.
Ein ganzes Land befindet sich mittlerweile gefühlt im Homeoffice und selbst die Kanzlerin hat eine Zeit lang via Telearbeit regiert. Würden Sie sagen, dass sich die private Sphäre und der Arbeitskosmos so besser vereinbaren lassen oder verlagern sich die Probleme einfach nur? Stichwort: Zwang zur permanenten Erreichbarkeit?
Das ist in sehr hohem Maße eine kulturelle Frage, was voneinander erwartet werden kann. Selbst wenn von offizieller Seite gesagt wird, man solle sich nicht stressen, setzen sich Angestellte unter Druck. Es entsteht häufig eine Sozialdynamik, in der jeder genau beobachtet, wie viel der andere leistet. Das ist eine Frage der sozialen Normen und hat auch damit zu tun, wie angstbehaftet die Arbeitswelt ist.
Was schlagen Sie vor, damit sich das ändert?
Wir müssen ehrlicher zueinander werden, wenn wir über Arbeit sprechen: Ich konnte mich zum Beispiel in den ersten Tagen der Corona-Krise kaum auf meine Arbeit konzentrieren und habe ständig die aktuellen Infiziertenzahlen im Liveticker angesehen. Unter den Kolleginnen und Kollegen meiner Fakultät herrschte darüber aber komplette Offenheit, dass es vielen so ging – und ich denke, dass uns das allen geholfen hat. Es wäre sehr anders gewesen, wenn ich Angst gehabt hätte, das überhaupt nur zuzugeben.
Sie haben sich in Ihrer Forschung viel mit dem Wert der Arbeit beschäftigt. Welchen Wert hat sie noch, wenn sie von Angst geleitet ist?
Dazu muss man erst einmal unterscheiden zwischen dem Marktwert einer Arbeit, der von Angebot und Nachfrage bestimmt wird und dem funktionalen Wert einer Arbeit, durch den die Gesellschaft am Laufen gehalten wird. Und letztlich den subjektiven, persönlichen Wert der Arbeit, also ob sie zum Beispiel als positiv erlebtwird. Diese verschiedenen Werte können durch staatliche Regulierungen, aber auch dadurch, wie Firmen geführt werden, sehr unterschiedlich gewichtet sein. Angst hat sehr viel mit der wirtschaftlichen Dimension zu tun und damit, dass Menschen ihren Job nicht verlieren wollen. In den vergangenen Jahren wurden viele Angestellte mittels dieser Angst angetrieben, einen Marktwert zu erzeugen, obwohl man aus der psychologischen Forschung weiß, dass dadurch die Leistung nicht besser wird. Kreativität und innovatives Denken lassen sich nicht durch Druck erzeugen. Wir brauchen also eine Neujustierung des Marktwerts im Verhältnis zum gesellschaftlichen Wert und zum subjektiven Wert.
Sie sind Autorin des Buchs „Die Rettung der Arbeit“. Warum oder wovor muss die Arbeit denn eigentlich gerettet werden und wie kann das gehen?
Arbeit wird oft aus einer rein ökonomischen Perspektive gesehen. Aber Arbeit ist auch ein extrem wichtiger sozialer Ort, der unsere Gesellschaft entweder zusammenhält oder auseinandertreibt. In den vergangenen Jahren gab es divergente Tendenzen, die durch digitale Technologien noch verstärkt wurden, zum Beispiel durch Plattformen wie Uber oder Amazon Mechanical Turk, über die man Mikroarbeit anbieten oder kaufen kann. Das sind extrem prekäre Formen von Arbeit, durch die kein Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt geleistet wird.
Wir wagen mal einen Blick in die Kristallkugel: Wie wird unsere Arbeitswelt nach der Krise aussehen?
Es wird wahrscheinlich – oder sagen wir hoffentlich – auch weiterhin eine höhere Flexibilität geben in Bezug auf die Arbeitsorte und einen stärkeren Einsatz von digitalen Technologien. Das sind aber nur die Oberflächenphänomene. Die Frage ist, ob wir es schaffen, dass Arbeit wieder stärker nach ihrer sozialen Bedeutung bewertet wird. Und ob jene Berufe, in denen die Arbeitsbedingungen schlecht sind, aufgewertet werden. Man kann nur hoffen, dass die derzeitigen Einsichten zu konkreten Änderungen führen und nicht einfach wieder verpuffen, wenn die Krise vorüber ist. Ich würde mir wünschen, dass uns auch nach der Pandemie allen bewusst bleibt, wie sehr wir alle voneinander abhängen.
Zur Gesprächspartnerin:
Lisa Herzog, 1983 geboren, ist Philosophieprofessorin und lehrt am Zentrum für Philosophie, Politik und Wirtschaft der Universität Groningen in den Niederlanden. Herzog forscht zu den Themen soziale Gerechtigkeit, Philosophie der Märkte, Geschichte des ökonomischen und politischen Denkens und Unternehmensethik. Sie hat in Oxford promoviert und unter anderem an den Universitäten St. Gallen und Stanford gelehrt. Bis 2019 war Herzog Professorin für Politische Philosophie und Theorie an der Hochschule für Politik an der Technischen Universität München. Sie ist Autorin des Buchs „Die Rettung der Arbeit. Ein politischer Aufruf“.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Hochstapler. Das Heft können Sie hier bestellen.