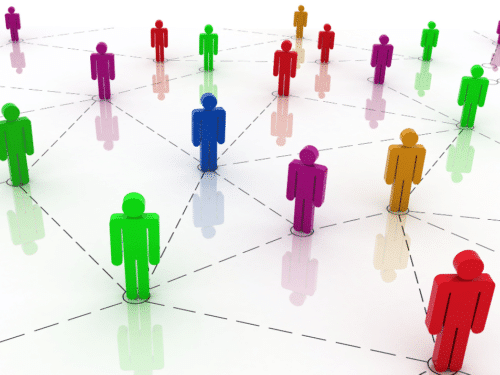Statussymbole sind ein Zeichen für Erfolg – zumindest waren sie das einmal. Inzwischen haben viele ausgedient. Corona verstärkt die Dynamik. Das hat auch Folgen für HR.
Mein Haus, mein Auto, mein Boot – so lautet der Dreiklang des Erfolgs in einem Werbespot von 1995. Wer es im Leben geschafft hat, kann sich solche Statussymbole leisten. Doch was Mitte der 1990er Jahre für einen Dreiklang reichte, löst sich langsam auf, auch in der Personalpolitik. Nicht erst seit Corona haben Auto und Büro als Lockmittel für Führungskräfte ausgedient. 2019 war der Dienstwagen laut Umfrage des Digitalverbands Bitkom für gerade einmal zwölf Prozent der Personalverantwortlichen ein Lockmittel. Für 70 Prozent der Unter-30-Jährigen ist das Auto kein Statussymbol mehr. „Wir leben in einer Überflussgesellschaft, in der sich der materielle Status und seine Symbolik erschöpft haben“, sagt Trendforscher Tristan Horx. „Statt Quantität zählt Qualität. Es geht nicht mehr darum, wie viel wir haben, sondern wie glücklich und gesund wir sind.“
Auch Glück und Gesundheit werden mitunter über Symbole inszeniert, zum Beispiel die Yoga-Matte im Sonnenuntergang, frische Smoothies oder Avocado-Toasts. Dafür reicht ein Blick in die Bilder-Plattform Instagram. Der Mensch sei ein soziales Wesen und geprägt von Rollen und Hierarchien, sagt Horx. Einen Status zu haben, heiße, sich abzugrenzen. Symbole helfen dabei, doch werden sie vielfältiger und vor allem subtiler. „Die perfekte Inszenierung hat sich spätestens seit der Pandemie als ein Schein-Status entmystifiziert“, sagt Horx. Die Dauerfreude auf Instagram hat sich in der Krise mehr und mehr erschöpft.
Alte Erkennungsmerkmale
Auch in der Wirtschaft gilt: Statussymbole verändern sich. Wer sie sucht, muss heute genauer hinschauen. Dreiteiler und Aktentasche wurden spätestens mit einem CEO wie Mark Zuckerberg als Erkennungsmerkmale für Chefin oder Boss aufgesprengt. „Auch Frauen haben das Bild der CEOs bunter gemacht“, sagt Ulrike Wieduwilt, Deutschlandchefin von der internationalen Personalberatung Russell Reynolds. Gerade amerikanischen Unternehmen sei es zu verdanken, dass Statussymbole in der Arbeitswelt keine so große Rolle mehr spielen. Ihren eigenen Berufseinstieg beim US-Konzern Mars nennt sie „eine wunderbare Schule“: Alle hätten in der gleichen Kantine gegessen, die gleichen Parkplätze genutzt und wären für jede und jeden erreichbar gewesen. Erst mit dem Wechsel in ein deutsches Unternehmen habe sie Statusdenken kennengelernt.
Wieduwilt hat in ihrer Arbeit als Beraterin erlebt, dass das Zustandekommen eines Arbeitsvertrags an der Marke des Dienstwagens scheitern kann. Autos, eine Assistenz und die Anzahl der Fenster im Büro waren früher wichtige Aspekte. Heute würde das noch am ehesten in sehr traditionellen Unternehmen zählen. „In den Unternehmen, die sich als modern und agil verstehen, spielen Statussymbole keine Rolle mehr“, sagt Wieduwilt.
Business School statt Business Class
Google ist so ein Unternehmen: Der Tech-Konzern gibt an, bewusst auf Statussymbole zu verzichten. Benefits wie kostenloses Essen, Gleitzeit oder Physiotherapie kommen allen zugute. Die Hierarchie ist weniger sichtbar, aber trotzdem da. Sie konstituiert sich in erster Linie über Verantwortung und Gehalt. „Manager wollen sich noch immer von anderen absetzen. Nur suchen sie dafür jetzt andere Symbole“, sagt Wieduwilt. Zum Beispiel, wie groß ein Team ist, ob sie Budgetverantwortung haben und wie eng die Anbindung an den Vorstand ist. Auch Abschlüsse von Business Schools spielten eine Rolle, schon in der Bewerbung, aber auch bei Fragen der Fortbildung. Lebenslanges Lernen werde zu einem Statussymbol. Das Bücherregal in der Zoom-Konferenz ist längst legendär. Inzwischen würden Bewerberinnen und Kandidaten Bände aus dem Regal ziehen, um zu zeigen, dass diese keine Attrappen sind.
Man zeigt also nicht, was man ist, sondern was man wird. Das bedeutet Status heute. Es geht um Veränderung und Flexibilität. „Früher galt es als schick, sich um gewisse Dinge nicht selbst zu kümmern, E-Mails ausdrucken zu lassen und Telefonate nur über das eigene Vorzimmer anzunehmen. Heute ist es modern, die IT zu beherrschen und kurzerhand selbst zum Handy zu greifen“, sagt Wieduwilt.
Maximale Flexibilität und Vertrauen
Im Homeoffice haben Führungskräfte auch keine andere Wahl. Corona hat viele Entwicklungen beschleunigt. „Das spielt vor allem jungen Generationen in die Hände, die mehr Flexibilität suchen“, sagt Tristan Horx. Mit ihrem verträumten Zugang zu Status, also Momente zu sammeln statt Dinge, sind sie laut Horx oft am Arbeitsmarkt gescheitert. So flexibel waren viele Unternehmen nicht, vor allem nicht in Deutschland. Corona zeigt, dass es doch möglich ist. „Alles, was maximale Flexibilität beweist, wird in Zukunft zum neuen Statussymbol“, sagt Horx.
Genau das führt wieder zu Google: Obwohl das Unternehmen nach eigener Aussage keine Statussymbole nutzt, hat es sich selbst zu einem entwickelt. Weil es mit Benefits und Büros einer der beliebtesten Arbeitgeber weltweit ist. Und weil Google beeinflusst, wie sich die Welt verändert, also Purpose und Impact hat darauf, was die neue Generation sucht. Immer mehr Unternehmen wollen sich für diese Sinnsuche positionieren, auch Merck: Der Konzern aus Darmstadt ist mit über 350 Jahre Geschichte einer der ältesten im Land. Heute erklären auf der Website Beschäftigte in Videos, was sie für die Zukunft bewirken wollen und können. Es geht um Ambition, Gemeinschaft und Verantwortung. „Bahnbrechendes beginnt mit Neugier“, lautet der Leitsatz. Für Chief Human Resources Manager Dietmar Eidens bedeutet das: „Alles dreht sich bei uns jetzt um Purpose. Statussymbole, mit denen sich Einzelne abgrenzen wollen, haben keinen Platz mehr. Sie sind wie eine aussterbende Tier- oder Pflanzenart, gegen die wir aber auch bewusst vorgehen.“
Aktive Marginalisierung alter Symbole
Merck macht das, indem vermehrt nicht mehr individuelle Leistung gemessen wird, sondern die des Teams. Das Unternehmen hat zwar noch Dienstwagen, vor allem im Vertrieb und in Deutschland, wo über die Hälfte aller Autos zum Einsatz kommen, aber in der internen Richtlinie wird bewusst auf alternative Antriebe gesetzt. „Wir machen das für mehr Nachhaltigkeit und als Zeichen gegen alte Statussymbole“, sagt Eidens. Wer einen Dienstwagen will, kann ihn haben, aber eine Mehrheit der Angestellten würden inzwischen lieber die Pauschale oder andere Benefits wählen, die Merck in einem Menü anbietet.
„Meine Individualität ist mein Status“, sagt Horx. Merck unterstützt das mit seinem Benefit-Menü. Wer dagegen Statussymbole fordert, muss das mit einem Mehrwert erklären. Will jemand zum Beispiel eine Fortbildung an einer Eliteschule absolvieren und sich das bezahlen lassen, fragt Merck, wie sich das rentiert oder ob es nicht bessere Alternativen gebe, zum Beispiel in China oder Europa. Das spart Kosten und kommt mehr Menschen zugute, unterstützt also den Purpose-Ansatz. Schon in Vorstellungsgesprächen wählt Merck Personen, die keinen Wert mehr auf Statussymbole legen. Zumindest sofern sie der Arbeitsmarkt lässt. Denn im Wissenschaftsbereich spielen alte Statussymbole wie Titel eine große Rolle. Es sei gegenläufig zum erwarteten Erfolg, sich nicht daran zu orientieren, sagt Eidens. Das gilt auch für die Bedeutung von Dienstwagen im Vertrieb.
Es ist also eine Einzelfallentscheidung, welche Statussymbole Merck zulässt, aber kein Bestandteil mehr der Unternehmenskultur. Dafür setzt das Unternehmen auf eine „Doppelstrategie aus aktiver Marginalisierung und passivem Sich-von-selbst-Erledigen“, wie Eidens es nennt. Je globaler ein Konzern aufgestellt sei, desto irrelevanter werde das Thema Status mit der Zeit. Gerade in Deutschland sei die Soll-Lücke noch sehr hoch. Aber auch hier würde mit der neuen Generation eine alte Denke abgelöst. Selbst die Boomer-Generation habe inzwischen dazugelernt und würde pragmatischer mit Statusfragen umgehen.
Rein theoretisch könnte es passieren, dass sich das noch einmal umdreht. Tristan Horx sagt, dass Corona zu einer Knappheit führe, die Materielles wieder aufwerten könne. Ganz nach dem Motto: Alle arbeiten zu Hause, nur ich habe ein großes Büro. Aber das sei nur temporär. Im Grunde gehe es darum, tiefere Werte zu zeigen: Gemeinschaft und echte Verbundenheit statt Oberflächlichkeit und Inszenierung. Wer in Zukunft Autos, Häuser und Boote zeigt, um zu beweisen, wer er ist, zählt laut Horx zu den Proll-Professionals. Die wird es zum Teil immer geben. Für die Arbeitswelt formuliert es Ulrike Wieduwilt wie folgt: „Arbeitgeber müssen sich in Zukunft mehr Mühe geben, Mitarbeiter individuell anzuerkennen und konstant zu fördern. Wer in seinem Beruf keine inhaltliche Erfüllung findet, wird sich schnell neu orientieren.“ Da hilft dann auch kein Statussymbol mehr weiter.
Lesen Sie auch: Die neuen Symbole der Macht
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Status. Das Heft können Sie hier bestellen.