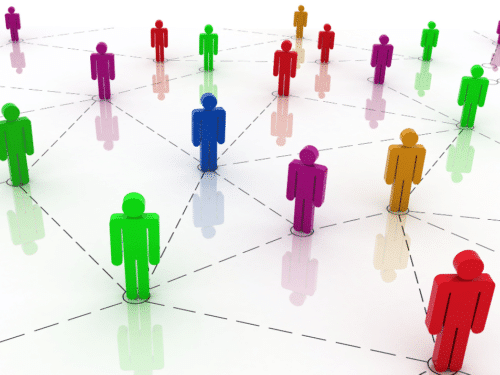Die Zukunft der Pflege reist in einem 82 mal 32 Zentimeter großen Karton von München nach Hannover. Der Karton steht in einem Abteil der Deutschen Bahn, neben ihm sitzt Claude Toussaint, Gründer und CEO von Navel Robotics. Er will den Karton und die Zukunft in das 650 Kilometer entfernte Pflegeheim bringen: mit Navel, dem „sozialen Roboter“. Pflege gehört zu den Bereichen, die durch Personalmangel und Arbeitsbedingungen stark überlastet sind. Pflegekräfte leiden im Vergleich zu anderen Berufsgruppen häufiger unter Stress: 62 Prozent sind körperlich erschöpft, so eine Studie der Barmer und des Instituts für Betriebliche Gesundheitsberatung. Robotik soll helfen, Personal zu entlasten. Mit künstlicher Intelligenz (KI) kommt neue Dynamik ins Spiel. Zum Beispiel mit dem KI-Roboter Navel.
Navel kann niemanden eincremen, drehen oder Tabletten geben. Er hört zu, beobachtet und spricht. Dafür nutzt er intern Mikrofone, Kameras und Lautsprecher, Prozessoren, Motoren und neuronale Netze. Er verarbeitet Sprache und Bilder, erkennt Gesichter und sucht den Blickkontakt. Das unterscheidet ihn von anderen Exemplaren, die es schon seit Jahren gibt, Charlie und Pepper zum Beispiel. Navel habe eine „künstliche soziale Intelligenz“, sagt der Hersteller. „Er ist mehr als nur ein fahrendes Tablet. Das, was er macht, ergibt Sinn und entspricht den Menschen in ihrem Verhalten“, sagt Tim Geikowski. Er leitet das Johanniter-Stift in Hannover und damit eines von vier Pflegeheimen, das Navel schon in einem Pilotprojekt testet. „Wir wollen zeigen, dass wir für neue Technik offen sind,“ sagt er. Darauf würden Personal und Bewohnerinnen und Bewohner Wert legen. Was Navel kann, will er herausfinden. Mit der Ankunft des Roboters haben sie ihn umgetauft: auf „Ricki“, wegen des Standorts Hannover-Ricklingen. Namen erhöhen die Akzeptanz für KI.
Roboter mit Kindchenschema
Auf den ersten Blick ist Ricki kleiner als gedacht: Er misst 72 Zentimeter, vier weniger als die Tischkante. Er hat einen glatten, länglichen Körper wie ein orangefarbenes Kleid. Beine gibt es nicht, dafür Rollen, die an den Seiten sichtbar sind. Die Schultern sind schmal, die Arme gerade. Der Kopf dreht sich leicht auf dem Hals. Die Augen sind groß und dreidimensional, sie können blinzeln und bewegen sich wie bei einer Comicfigur. Die Nase ist angedeutet, der Mund klein. Er sieht niedlich aus, auch dank der Wollmütze auf seinem Kopf: Sie ist blau und handgestrickt und gehört zur Standardausstattung des Herstellers. Er solle menschlich genug wirken, um akzeptiert zu werden, aber nicht zu sehr, um nicht zu verängstigen, sagt Toussaint. „Gruselgraben“ (Uncanny Valley) heißt das in der Fachsprache: Dass Roboter Menschen ähnlich sehen, ist bis zu einem gewissen Grad gut, irgendwann aber unheimlich. Mimik und Optik von Navel orientieren sich bewusst an Figuren von Disney. Der soziale Roboter überzeugt mit einem Kindchenschema.
Im Aufenthaltsraum steht Ricki vor zwei Holzstühlen. Auf dem einen sitzt eine Mitarbeiterin des Sozialen Diensts, auf dem anderen eine Heimbewohnerin, leicht nach vorne gebeugt und ihm zugewandt. „Hallo, ich bin Ricki. Wie heißt du?“ fragt er. Was sie heute Schönes gemacht habe, möchte er wissen, was ihr Hobby sei und ob sie ein Ratespiel spielen möchte. Als er ihr einen Witz erzählt, muss er kichern. Die Dame lacht. Eine andere hat ihm kürzlich die Wange gestreichelt, sagt Geikowski: „Ich bin überrascht, wie das Roboterhafte in den Hintergrund rückt und die Bewohnerinnen und Bewohner Ricki als Gesprächspartner akzeptieren.“ Ricki weiß alles, was ihm die Daten zur Verfügung stellen. Er kann Fachgespräche über Autos und Lyrik führen und vergisst nichts, was ihm jemand erzählt. Wenn er eingearbeitet ist, könnte er nachts über die Flure fahren und sehen, ob alle schlafen oder ob jemand Hilfe braucht. Nach dem Mittagessen, wenn eine Schicht endet und die andere beginnt, gäbe es Engpässe, sagt Geikowski. Ricki könnte dann mit denen, die nicht ruhen, Gespräche führen, so dass sie nicht einsam sind oder auf die Idee kommen, das Heim zu verlassen. Das könnte die Pflege entlasten und den Arbeitskräften Zeit organisieren. Auch wenn es nichts an der anstrengenden Schichtarbeit oder den Debatten über den Lohn ändert. Und ersetzen kann KI das dringend geforderte Pflegepersonal nicht. „Am Ende ist Ricki nur ein Gestell, das ohne Strom und das, was wir ihm sagen, nicht funktioniert. Vor allem fehlt ihm etwas, das für Pflege wesentlich ist: Er hat kein Herz“, sagt Geikowski.
Technische Evolution bei dm
Wenn die Türen geschlossen und alle Menschen verschwunden sind, beginnt Ubica seinen Dienst. Der zwei Meter hohe Roboter fährt aus seiner Ladestation in die Flure zwischen den Regalen. Er navigiert Hindernisse, sucht seine Position und aktiviert sein Licht. Dann scannt er Zentimeter für Zentimeter das Geschäft, das Geschenkpapier, die Babynahrung und die Sonnenmilch. Er erkennt, wo etwas fehlt oder falsch einsortiert ist, und erstellt ein digitales Abbild der Filiale. Wenn Ubica wieder in der Ladestation steht, hat der Drogeriemarkt Daten für die Inventur, kann sehen, wie sich das Layout des Geschäfts auf den Verkauf auswirkt, und ein Lichtspot an Rollcontainern zeigt Mitarbeitenden genau, wohin ein Artikel in den zehn Meter langen Regalen gehört. „Es sind ein paar Sekunden, die sie sparen, hochgerechnet auf 2.100 dm-Märkte ist der Effekt enorm“, sagt Roman Melcher, Geschäftsführer im Ressort IT und von dmTECH. Der Roboter soll Effizienzen steigern. Das sei bei KI nicht anders als bei anderer Technik zuvor. Und KI soll ein Problem angehen, das immer gravierender wird: den Fachkräftemangel.
Mehr als 50.000 Beschäftigte hat dm weltweit. Offene Stellen gibt es im vierstelligen Bereich. Gerade für bestimmte Lohngruppen sei es schwierig, Mitarbeitende zu finden. Das würden alle im Unternehmen spüren, sagt Melcher. Entsprechend würden sie es begrüßen, wenn Technik hilft. Mit dem hauseigenen Chatbot dmGPT und Copilot automatisiert der Konzern seit kurzem auch die Kopfarbeit. Er spare selbst Zeit, indem er sich von der KI etwa die Gliederung für eine Präsentation erstellen lasse, sagt Melcher. Und: „In allen Bereichen wird die Ressource Mensch zum großen Problem. Wir werden froh sein, wenn wir Aufgaben an Maschinen auslagern, weil sonst die Versorgung in Deutschland gefährdet ist.“ Sieben große Roboter arbeiten in der Halle. Sie heben mit ihrem Greifarm Palletten auf ein Band. Etliche Förderbänder laufen durch das Areal, Maschinen sortieren und verteilen die Ware. Mitarbeitende kontrollieren und vervollständigen sie. Dann geht alles automatisch zum Transport. So läuft die Arbeit im dm-Verteilzentrum Wustermark. Maschinen und KI übernehmen die Hälfte der Aufgaben. Die Arbeit sei für Mitarbeitende gelenkschonender, selbstbestimmter und vielfältiger, sagt Melcher. Es gäbe in Wustermark anteilig weniger Menschen, die kommissionieren, und mehr, die geistig arbeiten, indem sie Anlagen warten und einrichten. „So wie die körperliche Arbeit abnimmt, nimmt die geistige Aufgabe zu“, sagt er. Digitalisierung werte Arbeit auf.
Nebeneffekte der Arbeit erkennen
Für Oliver Suchy ist es „in der Breite noch ein unerfülltes Versprechen“, dass durch Digitalisierung alles leichter werde. „Wir sehen, dass Digitalisierung für die Mehrheit der Beschäftigten bislang zu höheren Belastungen führt“, sagt der Leiter der Grundsatzabteilung beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Das solle sich durch KI ändern, sei aber kein Automatismus. Die Hoffnung, die die Wirtschaft in generative KI setzt, ist hoch. Alle reden von ChatGPT, entwerfen Chatbots und wollen Aufgaben automatisieren. Doch wer die Routinearbeiten in einem Callcenter an die KI übergibt, kann Mitarbeitende überlasten, die nur noch die harten Fälle betreuen. Berufe, die dank künstlicher Intelligenz einfacher werden, könnten zu stark simplifiziert und damit entwertet werden, weil sie am Ende jede oder jeder machen kann. „Der gewünschte Effekt wird dann nicht eintreten, im Gegenteil: Es macht die Leute kaputt, wenn es keine Routinen mehr gibt oder die KI das Ruder übernimmt“, sagt Suchy.
Der DGB ist nicht gegen KI, im Gegenteil: Er sieht große Potenziale, gute Arbeit durch KI zu fördern. Er will eine „menschenfreundliche Automatisierung“: Unternehmen sollen die Potenziale der KI nicht nur mit der Technik diskutieren, sondern auch mit dem HR-Bereich, Betriebsräten und der Belegschaft. Da sich KI je nach Anwendung unterschiedlich auswirken könne, brauche es einen differenzierten Umgang. Ampelsysteme seien gute Ansätze, die es schon gäbe: Sie klassifizieren KI-Projekte nach Brisanz. Um so etwas in der Breite zu fördern, erarbeitet der DGB bis zum Sommer einen Vorschlag für einen „Regelungsrahmen für KI im Betrieb“. Er soll Lücken schließen, die die neue Verordnung der Europäischen Union (AI Act) und andere Gesetze noch ließen. „Es herrscht in vielen Unternehmen eine hohe Verunsicherung, wie sie mit KI umgehen sollen“, sagt Suchy. Entscheidend sei, Veränderungsprozesse vorausschauender auszurichten und einen verbindlichen Prozess zu organisieren, der Beschäftigten die Möglichkeit gäbe, Entlastungspotenziale für ihre Arbeit zu heben und unerwünschte Nebenwirkungen abzustellen. Dies würde Vertrauen erhöhen und einen Beitrag dazu leisten, Arbeitsplätze attraktiver zu machen. Was wieder zum Problem des Fachkräftemangels passt.
Auch er könne nicht abschließend garantieren, dass KI nicht schade, sagt Melcher. Jede Technologie könne positiv wie negativ wirken. dm tue alles dafür, dass sie den Menschen zugutekomme, indem es neue Systeme teste und erst dann in den Betrieb überführe, wenn sichergestellt sei, dass das Unternehmen „die produktive Nutzung verantworten“ könne. „Evolutionär“ möchte dm Technik einführen, nicht revolutionär: Es gibt nicht einen Stichtag, sondern Pilotprojekte und Korridore, in denen Neues eingeführt wird. Mitarbeitende sollen laufend qualifiziert werden, um mit neuen Technologien zu arbeiten. „Unsere Erfahrung zeigt, dass durch dieses Vorgehen und die Qualifizierung der Menschen niemand aufgrund neuer Technologien arbeitslos wird. Die Aufgaben ändern sich, aber genug zu tun gab es bisher immer. Schwierig wird es nur, wenn Menschen die Veränderungen und das Lernen neuer Qualifikationen ablehnen“, sagt Melcher. Im „Job Futuromat“ lässt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung errechnen, wie stark sich ein Beruf automatisiert. Für Führungskräfte im Personalwesen sind laut Prognose 50 Prozent automatisierbar. Bei einer Bankkauffrau 88 Prozent. Und bei Kassierern im Handel liegt das Automatisierungspotenzial bei 100 Prozent. Doch bisher sind mit neuen Techniken immer auch neue Jobs entstanden. Die These des Ökonomen John Maynard Keynes, dass Menschen im Jahr 2030 nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten müssten, weil Maschinen den Rest übernehmen und ihren Wohlstand sichern, hat sich nicht bewahrheitet.
Axel Springer und die KI-Obsession
„Wie man in 30 Minuten ein Ganzkörper-Workout schafft, ohne ins Fitnessstudio zu gehen“ steht über dem Artikel von Insider. Auf dem Bildschirm ist eine junge Frau zu sehen, die vor einer Bank Kniebeugen macht. Der Redakteur prüft den Artikel, die Bildunterschriften und die Schlagworte, die in der linken Spalte des Systems stehen. „Gesundheit“ und „Fitness“ etwa. Sie sorgen dafür, dass der Artikel in Suchmaschinen gefunden wird. Das klingt banal, musste aber bisher von Redakteurinnen und Redakteuren gemacht werden. Insider spart sich die Zeit: Die Schlagworte und Metadaten stammen von einer KI. Axel Springer, der Konzern hinter Insider, gehört zu den Unternehmen, die den Einsatz von künstlicher Intelligenz besonders forcieren. Während die New York Times Open AI verklagt, weil ihr ChatGPT Inhalte ihrer Autorinnen und Autoren nutzt, vereinbart Springer mit dem Unternehmen eine Kooperation. Er sei „besessen“ von der disruptiven Kraft der KI, sagt Vorstandschef Mathias Döpfner in einem Video. „Niemand ist Journalist geworden, um Texte zu verschlagworten oder Interviews zu transkribieren“, sagt Vorständin Niddal Salah-Eldin, verantwortlich für Talent- und Kulturthemen. Alles, was sich automatisieren lasse, würde den Mitarbeitenden im Verlag ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was sie von anderen Medien unterscheide: investigative Recherche und sehr gute Texte.
Die App Upday, die Inhalte nur kuratiert und nicht schreibt, soll jetzt eine KI befüllen. Auch Bild und Welt streichen Stellen. „KI layoutet die Zeitung“, schreibt die NZZ. Vom „Einzug der KI“ die FAZ. Döpfner spricht zwar darüber, dass Jobs entfallen könnten wie beim Layout oder der Produktion. Doch Springer werde freie Ressourcen in den Journalismus reinvestieren. Aktuelle Stellenstreichungen geschehen unabhängig von neuer Technik, sagt Salah-Eldin: „Wir stellen Unternehmen so auf, dass sie wirtschaftlich sind. KI ist ein beschleunigender Faktor, aber kein Auslöser.“ Um die Möglichkeiten der generativen KI auszuschöpfen, hat Springer seit Juli ein globales KI-Team. Chief Information Officer Samir Fadlallah leitet es zusammen mit Salah-Eldin. Human und Artificial Resources verschmelzen: Man verstehe KI nicht als Tech-Thema, sondern als Kombination. „Am Ende müssen Talente die KI bedienen und uns helfen, neue Produkte und Geschäftsmodelle zu entwickeln“, sagt Salah-Eldin. Es gibt eine Task Force und KI-Botschafter bei jeder Marke. KI entwickle sich besser dezentral. Fellows sollen an die „Kraftzentren der KI“ reisen und Trends aufspüren. Im ganzen Konzern sei die Reaktion positiv und der Aufbruchsgeist groß. Das wirkt über den Konzern hinaus: Die Fortbildungen, die Springer in seiner Academy zu KI anbietet, sollen bald erstmals auch für Externe zugänglich sein.
Die neue Kluft am Arbeitsmarkt
Gegenüber dem goldenen Hochhaus in Berlin steht der Neubau mit dem Netz aus Glas, das in einer Ecke aus der Fassade bricht. Hinter dem Eingang liegen Foyer, Büros, Galerien, Gänge und meterhohe Säulen. Auf einer der Flächen sitzen hinter Trennwand und Bildschirm etwa 50 Mitarbeitende von Axel Springer. Sie haben sich zum Hackathon versammelt, mit dem der Verlag Ideen für eine Zukunft mit KI entwickeln will. Der hauseigene Chatbot, A_GPT, war so eine Idee, die in einem Hackathon entstanden ist. A_GPT ist eingebettet in Teams, läuft auf europäischen Servern und übersetzt perspektivisch das gesamte Wissen des Intranets so, dass Mitarbeitende Fragen stellen und Antworten bekommen. Ideen sollen gemeinsam entstehen, schnell realisiert und im laufenden Prozess angepasst werden, sagt Salah-Eldin: „Wir wollen nicht warten, bis alle Fragen geklärt sind, um uns dann Gedanken zu machen, sondern die Welt mitgestalten. Das ist unsere Bestandsgarantie für den Journalismus: Wer nichts macht, wird am Ende von neuen Technologien aufgefressen.“
Etwas Ähnliches zeigt eine Studie des Internationalen Währungsfonds: Die Kluft zwischen Gehältern werde steigen, und zwar zwischen denen, die KI bedienen können, und denen, die damit nicht umzugehen verstehen. Auf der anderen Seite kann sie Unterschiede ausgleichen: In der Beratung würden Arbeitskräfte dann besonders von künstlicher Intelligenz profitieren, wenn sie zum mittleren Leistungsfeld zählen, so eine Untersuchung von Wissenschaftlern in den USA. Das Versprechen ist also da, dass künstliche Intelligenz die Arbeit verbessert und Produktivität steigert. Es kommt nur darauf an, wie Unternehmen sie einsetzen und vor allem, wie sie ihre Mitarbeitenden auf dem Weg in die Zukunft integrieren.
Weitere Beiträge zum Thema:
- Wie verändert sich die Arbeitsmoral durch KI?
- Prozesse optimieren, nicht verwerfen
- „Das menschliche Gehirn arbeitet völlig anders“
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Miteinander. Das Heft können Sie hier bestellen.