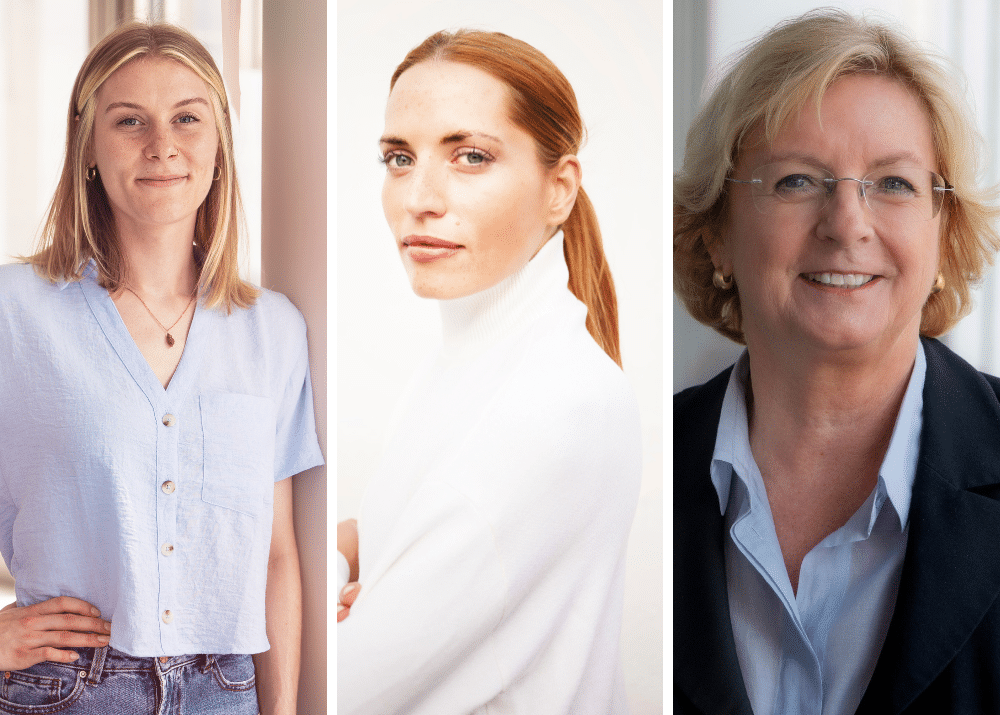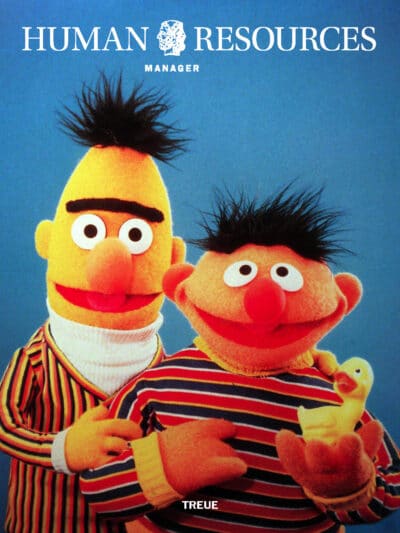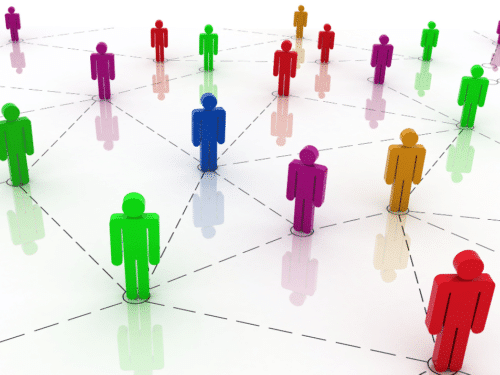Vorurteile, Schubladendenken, Unwissenheit: Konfliktpotenzial gibt es in den Büros hierzulande genügend. Während für die Babyboomer (Jahrgänge 1946 –1964) oft Arbeit und Karriere an oberster Stelle stehen und Leistung in Arbeitszeit gemessen wird, will die nachfolgende Generation X (1965 –1979) arbeiten, um zu leben. Sie legt zwar Wert auf eine gesunde Work-Life-Balance, doch berufliches Vorankommen und ein hoher Lebensstandard sind genauso hoch angesehen – wenn nötig auch mit Ellenbogenmentalität durchgesetzt. Die Millennials oder Generation Y (1980 bis cicra 1994) sind mit unendlichen Möglichkeiten aufgewachsen, schätzen Flexibilität und flache Hierarchien. Die Gen Z (ab circa 1995) sieht ihren Sinn nicht in der Karriere, sondern will die Welt zu einem besseren Ort machen – preußische Arbeitstugend gehört nicht zu ihren Charakteristika.
Je nach Durchmischung treffen also vier Generationen am Arbeitsplatz aufeinander – die Altersspanne in einem Team kann so durchaus mehr als 40 Jahre betragen. Das ist nicht nur eine Herausforderung für Führungskräfte, sondern auch für HR. Es muss dafür sorgen, dass die Stimmung in altersgemischten Teams nicht kippt und muss die Mitarbeitenden bei der Stange halten. Bei der Generation X ist das vergleichsweise leicht: Die Forsa-Studie Die vergessenen Leistungsträger im Auftrag des Personalspezialisten Onlyfy bestätigt, dass 69 Prozent der 43- bis 58-Jährigen langfristig bei ihrem Arbeitgeber bleiben wollen. 55 Prozent können sich sogar vorstellen, bis zur Rente dort zu arbeiten. Das macht die Generation X noch vor den Babyboomern zu den loyalsten Arbeitnehmenden. Im Vergleich ist die Wechselbereitschaft der Gen Z deutlich höher: 51 Prozent können sich vorstellen, den Arbeitgeber zu wechseln. Bei der Generation Y sind es 47 Prozent. Die Millennials sind mitunter als Jobhopper verschrien. Sie messen Loyalität nicht daran, wie lange sie bei einem Unternehmen bleiben, sondern wie stark sie sich in dieser Zeit für ihren Arbeitgeber ins Zeug legen. Eine Lösung, um möglichst allen entgegenzukommen und Beschäftigte bei Laune zu halten, kann lebensphasenorientierte Personalpolitik sein. Sie besteht aus vielen Puzzleteilen, so dass sich jeder genau das für sich passende Teilchen raussuchen kann. Standard ist hier die Eltern- und Familienzeit, immerhin spielt Familienfreundlichkeit seit langem eine große Rolle, wenn es um die Attraktivität des Arbeitgebers geht.
Auch für Nachwuchskräfte legen sich Firmen ordentlich ins Zeug, bieten in hauseigenen Akademien und externen Workshops das Rüstzeug für eine gelungene Karriere. Schwieriger wird es bei weichen Faktoren wie Teamzusammenhalt und Unternehmenskultur, die vor allem für die Generationen X und Y ein entscheidendes Treue-Kriterium sind. Deshalb gilt für HR: genau zuhören – und allen gerecht werden, zumindest so gut es irgendwie geht. So komplex die einzelnen Bestandteile lebensphasenorientierter Personalpolitik auch sind: Berufs- und Lebensphasen lassen sich clustern – und daraus kann HR übergreifende Strategien ableiten. Zum Beispiel für die Lebensphasen Single, Krankheit, Familie und Kinderbetreuung, Familie und Pflege. Wir haben drei Vertreterinnen aus verschiedenen Lebensphasen gefragt, warum sie ihrem Arbeitgeber treu sind.
Emma Ostendorf, 25 Jahre alt, seit sechs Monaten Volontärin im Bereich B2B-Kommunikation und Datenanalyse bei Otto:

Treue bis zur Rente? Das ist nichts für mich.
„Vor einem Jahr habe ich noch Kommunikationsmanagement in Lingen studiert, jetzt wohne ich in Hamburg und arbeite bei Otto. Dass es die Hansestadt werden soll, war mir schon lange klar. Beim Arbeitgeber dagegen war ich offen: Ich habe mich bei einigen Unternehmen beworben, die meine Wertvorstellungen und Erwartungen erfüllen. Damit meine ich sowohl die Ansprüche, die ich an einen Arbeitgeber beziehungsweise an ein Unternehmen habe, als auch die an mich selbst.
Und die sind eigentlich relativ simpel: Ich will nicht, dass mein Arbeitgeber der größte Weltverpester ist. Oder dass er sich für Dinge stark macht, die ich nicht vertrete. Klar, Otto ist ein E-Commerce-Unternehmen und verkauft auch Kleidung. Beides kann man negativ sehen, also die Textilproduktion und den Energiebedarf von Digitalunternehmen. Otto aber versucht, auf die Themen einzugehen und Stück für Stück besser zu werden, und darauf kommt es für mich an. Ich finde es wichtig, dass sich mein Arbeitgeber dafür einsetzt, dass die Welt besser wird, etwa für Nachhaltigkeit und Diversity, gegen Diskriminierung oder Rassismus.
Die Otto-HR hat einen Leitfaden entwickelt, der trans Menschen im Umwandlungsprozess unterstützt. Es gibt Coding-Konferenzen nur für Frauen. Viele Beratungsleistungen sind speziell für ältere Menschen zugeschnitten. Ich finde das sehr gut, obwohl ich nicht alle Angebote nutzen kann. Wenn mein Arbeitgeber andere Gruppen im Unternehmen stärker unterstützt, ist das total okay und sollte auch so sein. Das ist ja kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Und darauf kommt es doch am Ende an, zumindest für mich. Deshalb habe ich in der Bewerbungsphase darauf geachtet, wie mit den Menschen im Unternehmen umgegangen wird. Werden sie unterstützt? Wird ihre Stimme gehört? Wie sind die Leute in meiner künftigen Abteilung drauf? Ich hatte schon viel Gutes über Otto aus meinem Bekanntenkreis gehört, habe Artikel über das Unternehmen gelesen und Bewertungen gesucht. Und ich muss sagen: Wenn ich gewusst hätte, wie es hier ist, hätte ich mich noch viel eher beworben. Besonders gut gefällt mir, dass Otto das ÖPNV-Ticket bezuschusst, ich fahre nämlich nur Bahn. Auch der Campus ist wunderschön mit Meditationsräumen und Billardtischen. In der Kantine gibt es für mich als Veganerin eine große Auswahl. Das hätte ich nie erwartet, aber bin total froh, diese Benefits zu haben. Würde es das alles nicht geben, wäre das aber auch in Ordnung. Für mich ist das Zwischenmenschliche entscheidender. Ich bin ein großer Fan von Diskurs. Jeder darf seine Meinung haben und äußern.
Ich kann mir vorstellen, dass all diese Maßnahmen und die Arbeitskultur dazu führen, dass viele Beschäftigte hier über lange Zeit arbeiten möchten, dem Unternehmen also gewissermaßen treu bleiben. Trotzdem gibt es aber je nach Lebensphase, in der die Menschen stecken, unterschiedliche Ansichten zur Arbeit und auch zum Thema dauerhafte Loyalität. Mein Team besteht aus rund 25 Leuten, vom Volontär bis zur altgedienten Fachkraft. Ich merke schon, dass ältere Generationen daran gewöhnt sind, jeden Tag ins Büro zu gehen und ihre Arbeitszeit dort zu verbringen. Ich bin gerne vor Ort, aber keine fünf Tage am Stück. Und ich möchte maximal die Zeit arbeiten, die in meinem Arbeitsvertrag steht. Mal Überstunden zu machen, ist okay, aber nicht täglich. Mir ist wichtig, dass Überstunden vergütet werden in Freizeit oder Geld. Nach meinem Volontariat würde ich gerne in Vollzeit übernommen werden. Aber Treue bis zur Rente? Das ist nichts für mich. Nach spätestens fünf bis zehn Jahren will ich den Absprung schaffen und nach Süddeutschland ziehen. Das sehen meine privaten Pläne vor – und die sind mir nun mal noch wichtiger als mein Job. Mal schauen, welche Arbeitgeber dort meine Erwartungen erfüllen.“
Franziska Teutscher, 35 Jahre alt, seit August 2022 Head of Finance bei Snipes in Köln:

Als Mutter ist mir Sicherheit wichtig
„Ich bin im Finance-Bereich schon viel herumgekommen. Seit meiner Ausbildung vor knapp 15 Jahren habe ich in diversen Teams, Positionen und Städten gearbeitet und empfinde das als große Bereicherung. Nun bin ich seit vergangenem August Head of Finance bei Snipes, einer Handelskette für Streetwear und Sneaker, und möchte hierbleiben. Die Stelle ist toll – genau die richtige Mischung aus Führungsverantwortung und neuen Projekten. Ich bin aus persönlichen Gründen nach Köln gezogen, habe schnell Freundschaften gefunden, und mein fünfjähriger Sohn ist nach dem letzten Karneval ein echter Kölsche Jung geworden. Das alles lässt mich inzwischen sagen, an einem Punkt angekommen zu sein, an dem ich es mir vorstellen kann, meinem Job und der Stadt für lange Zeit treu zu bleiben. Vor wenigen Jahren war das noch ganz anders. Ich habe gern Jobs gewechselt, um etwas Neues zu sehen und zu lernen. Ich hatte stets den Stellenmarkt im Blick, und wenn es etwas Spannendes gab, habe ich mich spontan beworben und einen Neustart gewagt. Nach meiner Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation mit anschließender Weiterbildung zur Bilanzbuchhalterin in meiner Heimatstadt Hamburg und ersten Anstellungen dort habe ich knapp drei Jahre in Amsterdam gearbeitet. In zwei etablierten Positionen mit festen Abläufen. Bei meinem nächsten Job wollte ich genau das Gegenteil ausprobieren und bin bei einem jungen Unternehmen in München gelandet. Dort habe ich zum ersten Mal Führungsverantwortung übernommen und die Finanzabteilung mit aufgebaut. Das hatte alles ziemliche Start-up-Vibes und war eine superspannende Zeit. Dann kam Corona und ich sehnte mich nach Sicherheit. Also wechselte ich zu einem Unternehmen, das deutschlandweit orthopädische Kliniken betreibt. Hier war das zehnköpfige Team eher älter und hatten eine lange Erwerbsbiografie. Wir alle bringen viele wertvolle Erfahrungen durch unsere individuellen Lebenswege und Lebenssituationen mit. Ich habe durch die verschiedenen Teams sehr viel gelernt und will keine der Stationen missen. Meiner Generation wird Jobhopping oft vorgeworfen. Ich sehe darin aber nichts Negatives: Dank meiner Wechsel gewinne ich schnell einen Überblick über Teams, Dynamiken und Prozesse.
Gleichzeitig spricht nichts dagegen, wenn Mitarbeitende lange bei einem Arbeitgeber bleiben. Es ist der Mix, von dem alle profitieren. Wechsel und neue Erfahrungen müssen nicht immer nur von außerhalb kommen. Unternehmen können es durchaus in den eigenen Strukturen fördern, dass Mitarbeitende über den Tellerrand blicken: Etwa indem sie Weiterbildungen anbieten und Querschnittsprojekte anbieten, in denen Menschen aus verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten. Das versuche ich auch in meinem Team zu vermitteln. Ich möchte allen eine Perspektive bieten. Niemand soll das Gefühl haben: Wenn ich jetzt hierbleibe, dann geht es die nächsten zwanzig Jahre genauso weiter. Denn das ist doch ein furchtbarer Gedanke – zumindest für mich.
Bei Snipes kann ich solche Perspektiven aufzeigen, weil es leicht gemacht wird, die Stelle innerhalb des Unternehmens zu wechseln, und Aufstiegschancen geboten werden. Es gibt Beispielkarrieren von ehemaligen Praktikanten oder Store-Mitarbeiterinnen, die eine Führungsposition bei Snipes erreicht haben. Darüber hinaus gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich regelmäßig weiterzubilden. Eine davon ist der Snipes-Campus, auf dem Mitarbeitende verschiedene Seminare und Kurse besuchen können. Das sind fachliche Angebote, wie Excel, oder Sprachkurse, aber auch Kurse für ein besseres Zeitmanagement. Snipes ist für mich mehr als ein Arbeitgeber, wenn es darum geht, bei sich verändernden Lebenssituationen die Sicherheit und Unterstützung zu bekommen, die es braucht, um neue Routinen zu finden. Als Mutter schätze ich so etwas selbst absolut wert. Denn natürlich beeinflussen unsere persönlichen Umstände, wie wir unseren Arbeitsalltag gestalten. Aber es sind auch all die vermeintlichen Kleinigkeiten und Benefits wie eine Mitarbeiterkantine und ein Mitarbeiterrabatt, ein Fitnessstudio, eine betriebliche Altersvorsoge und mein geliebtes Job-Rad, die mir das Gefühl geben: Hier möchte ich bleiben.“
Renate Doetzer, 61 Jahre alt, seit zwölf Jahren bei SAP, sieben davon in der Abteilung Operations and People:

In den Jahren vor der Rente wünsche ich mir Flexibilität
„Ich arbeite seit zwölf Jahren bei SAP. Damit bin ich knapp so lange dabei wie die Kollegen im Durchschnitt – 13 Jahre. Vorher war ich vier Jahre bei einer Consulting-Firma und hatte einen großen Chemiekonzern als Klienten. In meinem alten Job nutzten wir SAP-Programme; mir fiel auf, dass ich manche Daten immer wieder von vorne eintragen musste, und ich dachte mir: Das muss doch effektiver gehen! Mich reizte der Gedanke, wie vielen Menschen ich den Arbeitsalltag erleichtern würde, wenn die Software die Prozesse beim Dateneintrag vereinfachen könnte. Außerdem wollte ich mich im Bereich IT weiterbilden, und da bietet sich ein Software-Unternehmen natürlich an. Also bewarb ich mich erfolgreich und fing in der Entwicklungsabteilung am Standort Mörfelden an. Trotzdem merkte ich nach einigen Jahren, dass ich näher an den Bedürfnissen der Menschen arbeiten wollte. Dabei kam mir zugute, dass SAP ein internes Fellowship-Programm anbietet, welches allen Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt, temporär in einem anderen Bereich mitzuarbeiten und zu sehen, welche Möglichkeiten es im Unternehmen gibt. Denn die Arbeit in den Abteilungen und Positionen ist bei einem so großen Konzern sehr vielfältig. Der Alltag einer Softwareentwicklerin ist komplett anders als der von jemandem im Bereich People. Ich absolvierte mein Fellowship im Team Global Diversity and Inclusion am Hauptsitz in Walldorf und mir war schnell klar: Das ist „meine“ Abteilung. 2016 wechselte ich permanent dorthin. Mein Projekt als Fellow war im Rahmen eines Programms für Menschen mit Autismus; mittlerweile leite ich das Thema Inclusive and Accessible Workplace. Ich glaube, es ist ein großer Vorteil älterer Angestellter, dass sie sich selbst und ihre Stärken besser kennen. Programme wie das Fellowship erleichtern es, in die Stelle zu kommen, in der sie persönlich am besten arbeiten. Heute bin ich Accessibility Strategist und entwickle Strategien, um Mitarbeitende mit Behinderungen besser einzubinden – die übrigens oft auch für Nichtbehinderte nützlich sind.
Nun, da ich nur noch ein paar Jahre bis zur Rente habe, frage ich mich, wie es weitergeht. Aktuell stecke ich noch mitten in einem Großprojekt, das mir sehr am Herzen liegt: Bis 2025 optimieren wir die Barrierefreiheit unserer Kommunikation. Schon jetzt gebe ich gern mein Know-how an Jüngere weiter, zum Beispiel in internen Mentoring-Programmen. Ähnliches könnte ich später als Beraterin oder Coach außerhalb des Unternehmens anbieten – denn das Thema Inklusion und Kommunikation ist gerade sehr aktuell. Das heißt übrigens nicht, dass ich meine Stelle hier komplett aufgeben muss. Ich könnte in Teilzeit gehen und freiberuflich nebenher arbeiten; mein Arbeitgeber erlaubt solche Modelle. Oder ich nutze die Altersteilzeit, die SAP im Blockteilzeitmodell anbietet. Dabei kann man die Arbeitszeit aufsplitten: in eine aktive Phase, in der man voll arbeitet, aber nur einen Teil des Gehalts ausgezahlt bekommt, und eine freie, passive Phase, in der man weiter Gehalt erhält, ohne zu arbeiten. So hätte ich noch einmal sehr flexibel die Möglichkeit, als Beraterin tätig zu werden.“
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Treue. Das Heft können Sie hier bestellen.