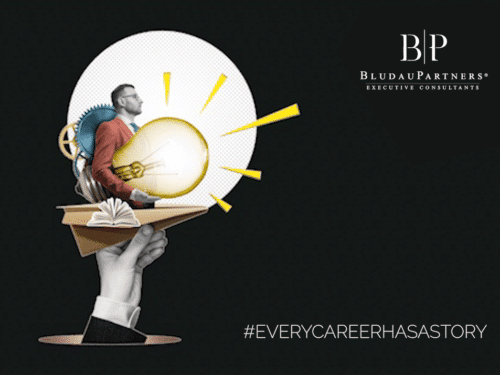Kennen Sie sich ein bisschen aus mit Quantenphysik oder zumindest mit der Nerd-Sitcom The Big Bang Theory? Dann wissen Sie vielleicht, dass es in diesem Feld seit langem Grabenkämpfe gibt – und zwar zwischen Fans der Stringtheorie und dem Lager derer, die auf die Schleifenquantengravitation schwören. Gesucht ist nichts weniger als eine Weltformel, da geht es schon mal scharfzüngig zu. So lästerte vor einigen Jahren der Physiker Peter Woit, die String-Modelle seien methodisch so unzureichend, dass sie es nicht einmal verdienten, als falsch bezeichnet zu werden.
Nun ist HR weder auf der Suche nach einer Weltformel, noch teilt sich der Berufsstand exakt in zwei Gruppen, die ihre Herangehensweise als indiskutable Blaupause betrachten. Eifrige Diskussionen gibt es trotzdem – und tatsächlich haben sich über die Zeit insbesondere zwei Antworten auf die Frage, welches Selbstverständnis das Personalmanagement im Unternehmen verfolgen sollte, herausgeschält. Das in den neunziger Jahren von Dave Ulrich entwickelte HR-Business-Partner-Modell und die jüngere Idee von HR als People Company.
Schon von außen wird schnell sichtbar, wie sich die Funktion im Unternehmen begreift: Betitelt sich die Abteilung mit behördlichem Beiklang als Personalwesen? Klassisch als Human Resources? Bindungsorientiert als Human Relations? Oder womöglich topmodern als People and Culture Unit? Die eigene Verschlagwortung gibt einen Hinweis, welchem Denkmodell die Verantwortlichen nahestehen.
Heute gehört in vielen großen Unternehmen das Business-Partner-Modell zum Standard. Dass es sich in den vergangenen 20 Jahren immer weiter etablierte, hat dem Selbstwertgefühl des Personalmanagements einen Schub verpasst. Statt als Verwalter agiert es seither wie ein Gestalter und Stratege, als ein Partner eben. Doch heute geht das Modell vielen nicht mehr weit genug. Der Fachkräftemangel und die dadurch veränderten Bedürfnisse lassen oftmals nur einen Schluss zu: Die Zukunft liegt in der People Company. In neuen HR-Organisationen seien Business-Partner eher out, heißt es dann. Zu stark sei der Fokus auf ökonomische Faktoren gerichtet. Gewinnmaximierung statt Menschenförderung? Klingt antiquiert. Stattdessen en vogue: mehr dezentrale Verantwortung bei People-Themen. Laut einer Studie des Softwareunternehmens Sage aus dem Jahr 2019 erwarten 94 Prozent der 500 befragten HR-Verantwortlichen, dass sich der HR-Begriff in eine People-Funktion wandelt. Hat das einst gefeierte Ulrich-Modell also ausgedient?
Judith Hübner ist am Telefon und als Antwort auf diese Frage seufzt sie zunächst. „Wann hören wir endlich auf, darüber zu reden?“, sagt die HR-Chefin des Chemieunternehmens Sasol. Hübner ist seit 20 Jahren als Personalerin tätig, lange Zeit selbst als Business-Partnerin. „In keinem anderen Unternehmensbereich wird so prominent über Methoden gestritten wie in HR“, sagt sie. Dahinter steckt aus ihrer Sicht die Suche nach der sichtbaren strategischen Bedeutung, danach, wichtiger zu werden und die eigene Funktion durch ein offizielles Modell zu legitimieren. Denn HR, lautet Hübners Diagnose, hat einen tief sitzenden Minderwertigkeitskomplex: „Alle da draußen glauben, sie könnten unseren Job genauso gut machen – welchen Wert gutes HR-Management hat, wird oft von Geschäftsführungen nicht gesehen.“
Eine Elite diskutiert
Auf Kongressen und Plattformen wie Linkedin ringen versierte HR-Verantwortliche derweil darum, wer die modernste und zukunftsträchtigste Herangehensweise verfolgt. Ihre Beiträge – die für Außenstehende zuweilen tatsächlich nach Quantenphysik klingen – suggerieren eine enorme Professionalisierung des Berufsstands. Dabei wird schnell vergessen: Es ist in der Regel eine fortgeschrittene Bubble, die dort an Modellen feilt und sich dazu austauscht – die HR-Elite sozusagen. Es handelt sich um Vertreterinnen und Vertreter großer Konzerne und moderner Mittelständler, die einen Schritt weiter gehen möchten, als das HR-Business-Partner-Modell es in seiner Urfassung vorsah. Sie wollen sich noch mehr auf die Menschen im Unternehmen fokussieren, die Organisation komplett durchdringen. Doch dieses Expertentum ist beileibe nicht gleichmäßig auf alle deutschen Arbeitgeber verteilt, wie Judith Hübner beobachtet. „Nach wie vor gibt es eine große Masse von Personalverantwortlichen, die fast ausschließlich verwaltet, die überhaupt erst versucht, in puncto Strategie den Fuß in die Tür zu bekommen.“ Vor allem viele kleine und mittelständische sowie eigentümergeführte Unternehmen haben in ihrer Wahrnehmung den Anschluss bislang komplett verpasst, sie scheinen zum ewigen Verwalten verdammt zu sein.
Und dann gibt es eine hohe Quote von Lippenbekenntnissen, glaubt Hübner: Unternehmen, die zwar damit werben, HR als Partnerschaft auf Augenhöhe zu betrachten, um modern zu wirken – deren Managementebene sich dann in der Praxis aber doch jede strategische Einmischung vonseiten des HR-Business-Partners verbittet, wenn es hart auf hart kommt. Hübner erkennt das oft schon an Stellenanzeigen für Business Partner, deren Aufgabenkatalog dann vor allem doch Verwaltung und operativen Kleinkram umfasst.
Die Personalerin hat das bei Coca-Cola Deutschland anders erlebt. Von 2014 bis 2017 leitete sie die dortige HR-Business-Partner-Organisation und den HR-Shared-Service. Das sei gut gelaufen, einziges Manko: Bei manchen Business Partnern habe es noch an praktischem Verständnis für den jeweiligen Partner-Bereich gefehlt, zum Beispiel für Finanzthemen oder den Verkauf. Das Modell war einige Jahre davor installiert worden, 2009 – mit einer kleinen Gruppe von Partnern, die direkt bei den einzelnen Vorstandsmitgliedern andockten. „Ich hatte das Glück, dass mein Vorstandspartner dankbar für die Rolle war und ich Sparringspartnerin sein konnte. Das ist nicht überall so, viele müssen auch heute noch um Gehör kämpfen“, sagt Hübner.
Ihre jetzige Position ist keine Business-Partnerschaft, heißt: Sie muss viel diskutieren, um den Gestaltungsfreiraum zu erhalten, den es in ihrem Berufsverständnis zwingend erfordert. Sonst entsteht ein Problem: „Wenn man nicht strategisch eingebunden ist, plant man Maßnahmen am eigentlichen Ziel vorbei, macht zum Beispiel ein Führungskräftetraining, ohne zu wissen, wo die Reise eigentlich hingehen soll und was genau zu optimieren ist.“ Mit dem Business-Partner-Modell – wenn es auch tatsächlich von allen gelebt wird – gab es diese Schwierigkeiten nicht.
HR-Business-Partner-Modell
Das Konzept hat der amerikanische HR-Experte Dave Ulrich 1997 entwickelt. Das zuvor meist administrativ geprägte Personalwesen organisiert sich ihm zufolge idealerweise als strategisch agierender Partner der zentralen Geschäftsbereiche. Der Gedanke dahinter: Bei HR geht es vor allem um Business, also die erfolgreiche Geschäftsentwicklung. HR-Business-Partner sind gleichermaßen Sparringspartner der Mitarbeitenden als auch der Unternehmensleitung. Sie haben ihren Platz im HR-Team, arbeiten aber selbstständiger: Sie beraten ihre Stakeholder auf Augenhöhe. Ulrich definierte vier Rollen: Strategy Partner, Change Agent, Employee Champion und Administration Expert. In der Praxis teilt sich das Modell in drei Bereiche der HR-Organisation auf (Drei-Säulen-Modell): Die Shared-Services-Organisation, bei der die administrativen Prozesse angesiedelt sind, die Business-Partner-Organisation, die die Führungskräfte berät und das Center of Excellence, das für die beiden anderen Säulen Strategien und Prozesse entwickelt. Je nach Firmengröße und Bedarf ist die Zahl der Business Partner variabel.
Führt das Modell zum Erfolg?
Dass dieses Modell im Personalwesen der Stein der Weisen ist, war lange Zeit eine eher gefühlte Wahrheit. 2021 widmete sich eine Studie der FH Bielefeld in Zusammenarbeit mit den Universitäten Düsseldorf und Paderborn dieser Frage. „Das HR-Business-Partner-Modell funktioniert, es trägt tatsächlich zum Erfolg eines Unternehmens bei“, resümiert Studienleiter Bernhard Wach nach der Analyse von 300 Unternehmen in Deutschland und Großbritannien. Zwar brauche es in Deutschland wegen des hiesigen Arbeitsrechts nicht die Rolle des „Anwalts der Mitarbeiter“, wie sie im angelsächsischen Raum im Modell vorgesehen ist. Aber auch hierzulande profitierten die Unternehmen laut des HR-Professors erheblich davon, das Personalwesen frühzeitig an wichtigen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Die gesteigerte Effizienz zeigte sich anhand der Befragungsergebnisse. Im Vergleich zu Wettbewerbsunternehmen derselben Branche agierten die HR-Partner-Organisationen kostenbewusster und -effizienter. „Das Modell ist zu Recht State of the Art in der Organisation des Personalwesens“, bilanziert Wach für Unternehmen ab 100 Beschäftigten. Der Grund: Das frühe Eingebundensein erhöhe die Transparenz und vereinfache die Umsetzungsphasen. „Das Zusammenspiel aus administrativen Rollenleistungen und strategischem Anspruch leistet einen großen Beitrag zum Unternehmenserfolg“, sagt er. Zudem lasse sich das Modell ja auch evolutionär entwickeln, um Bereiche erweitern und an das Unternehmen anpassen. „Je nach Branche, Unternehmensgröße oder -alter bestehen spezifische Anforderungen, denen auch innerhalb dezidierter HR-Rollen Rechnung getragen werden sollte.“ Auch Ulrich selbst hatte immer wieder Anpassungen am Modell vorgenommen.
Wach glaubt nicht, dass das Modell am Ende ist. Zwar kann der Experte den Trend, HR als isolierte Funktion abschaffen zu wollen, nachvollziehen. Doch auch im People Business brauche es eine Person, die sich auskennt und verantwortlich fühlt. Personalerin Hübner sieht das ähnlich: „Man kann zum Beispiel HR-Aufgaben in Fachbereiche integrieren. Aber auch der jeweilige Leader braucht die richtigen Skills und die Akzeptanz von allen Beteiligten im Unternehmen“, sagt sie. Solche modernen Modelle erfordern vor allem die Offenheit der Geschäftsführungen. Sie sieht ein zunehmendes Auseinanderdriften: Während manche Unternehmen mit voller Energie am perfekten Modell tüfteln, bleiben viele andere starr in der HR-Verwalterfraktion hängen.
HR als People Company
Eine People Company stellt ihre Beschäftigten in den Fokus. Um deren Motivation und Produktivität zu steigern, werden Bedürfnisse gezielt abgefragt und bedient, zum Beispiel über Weiterbildungen, aber auch die generelle Arbeitskultur. Zuletzt mehrten sich die Stimmen von HR-Profis, die dazu auffordern, HR solle sich selbst entsprechend aufstellen, prominent unter ihnen Walter Jochmann, Partner der Personalberatung Kienbaum. Das entspricht dem Selbstverständnis der Personalabteilung als Business Enabler. Statt eines Business Partners füllt sie die Rolle eines Key Account Managers aus, als Berater, der gemeinsam mit anderen HR-Rollen kompetente Lösungen organisiert. Jochmann schlägt zudem eine Art Aufsichtsrat für das Personalmanagement vor, in dem zum Beispiel Betriebsratsmitglieder, aber auch Young Professionals und andere Stakeholder sitzen. Dieses Board bespricht alle paar Wochen die wichtigsten Kennzahlen des Geschäftsverlaufs, Strategie- und Personalthemen.
Das Kind braucht einen Namen
Und dann ist da ja noch die Sache mit der Namensgebung. Judith Hübner stößt sich, wie viele andere auch, an dem technokratisch wirkenden Ressourcen-Begriff in HR. People and Culture findet sie allerdings auch nicht ideal: „Natürlich sollte das Personalmanagement die Unternehmenskultur prägen. Aber dafür ist die Führung insgesamt verantwortlich – wir haben ja kein Kulturmonopol.“ Auch sollte die Funktion nicht zu sehr nach Feelgood klingen. Bei Bezeichnungen, die weichere Faktoren wie Kultur – statt Business und Strategie – in den Mittelpunkt rücken, sieht sie eine Gefahr. Wer sich bei Hübner im HR-Team auf eine Stelle bewirbt, sollte auf die Frage „Was reizt Sie an Personalarbeit?“ besser nicht als Erstes antworten: „Ich arbeite so gerne mit Menschen.“ Eine Antwort, die aus ihrer Sicht das Selbstverständnis besser trifft: „Weil mich interessiert, wie das Unternehmen ganzheitlich funktioniert und jeder daran beteiligte Mensch sich optimal dafür einbringen kann.“ Das ist also der Anspruch – welches Modell sich am besten dafür eignet, ihn umzusetzen, ist variabel.
Davon ist auch Studienautor und HR-Professor Wach überzeugt. „Am wichtigsten ist, dass das Personalmanagement emanzipiert auftritt“, sagt er. Heißt: HR sollte strategisch eingebunden sein, auch wenn es darum geht, die komplexen Herausforderungen von künstlicher Intelligenz bis Klimawandel vorausschauend anzugehen. Und HR sollte das Unternehmen zum Beispiel im Hinblick auf administrative Abläufe effizienter machen. Das Business-Partner-Modell eigne sich dafür, die Struktur der People Company unter Umständen ebenfalls. „Wir sollten diese Aufgabe nicht an einem einzigen Modell festmachen oder Moden hinterherlaufen, sonst kippt die Diskussion ins Dogmatische“, warnt Wach. Und darüber könnte es zu Verhärtungen kommen statt zu befruchtenden Dialogen. Wie in der Serie The Big Bang Theory. Da unterbricht Physikerin Leslie die sich anbahnende Liebelei mit ihrem Kollegen Leonard jäh, als sie herausfindet, dass sie unterschiedlichen Lagern angehören. „Gut, dass ich nun die Wahrheit über dich weiß“, sagt sie fassungslos. „Denn dass du Anhänger der Stringtheorie bist, ist ein Dealbreaker.“
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Selbstverständnis. Das Heft können Sie hier bestellen.