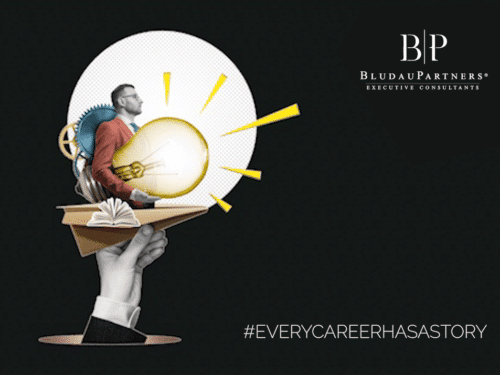Der erste Tag im neuen Job, ein modernes Großraumbüro mit Blick auf den Kölner Dom. Den Laptop in der Hand, gilt es, sich nun einen Platz zu suchen. „Setz dich, wohin du magst, wir machen Desk Sharing“, sagt der Chef. Also gut, dann hier in Fensternähe. Die Kollegin am Tisch gegenüber lächelt unsicher. Was ist los? „Normalerweise sitzt da immer Jenny, die müsste gleich kommen“, sagt sie zaghaft. „Aber bleib ruhig dort!“ Wenig später stellt sich dann noch heraus, dass die spontan ausgewählte bunte Kaffeetasse eigentlich Anna gehört. Was natürlich nicht schlimm ist, wie diese eilig versichert. Wird ja sowieso alles geteilt hier.
Was diese kleine Anekdote aus dem eigenen Erleben zeigt: Die meisten von uns sehnen sich nach Ritualen und Beständigkeit im Arbeitsleben. Auch wenn das nicht so lässig klingt, wie das Verfechten agiler Sharing-Modelle. Flexibel bleiben, das ist die Devise unserer Zeit. Arbeitszeiten und -orte sollen genauso frei gestaltbar sein wie die Rollen, die wir ausfüllen. Statt starrer Konzepte ist am liebsten alles on demand, wähl- und wandelbar. Und das fängt eben oft schon beim Schreibtisch an. Tatsächlich soll es unsere Innovationskraft anregen, wenn wir nicht jeden Tag am selben Platz sitzen, umgeben von denselben Fotos, Büchern und Menschen. Axel Koch, Coach und Dekan der Fakultät Wirtschaftspsychologie und Professor für Training & Coaching an der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning, ist wohlvertraut mit solchen Versuchen von Arbeitgebern, an die mentale Flexibilität ihrer Beschäftigten zu appellieren. Und er weiß auch: Nicht immer fruchtet sie. „So etwas ist auch eine Typfrage“, sagt er. „In jedem Team wird es Leute geben, die qua Persönlichkeitsstruktur offen und entspannt damit umgehen, wenn sich das Arbeitsumfeld oder die Aufgaben ändern. Und andere, die ihre Routinen lieben und mit dem Wandel hadern.“
Geistig flexibel zu sein, ist im Jobumfeld natürlich ein Bonus. Den Erkenntnissen der Kognitionsforschung zufolge bedeutet das: Menschen sind imstande, ihr Verhalten und ihre Denkmuster zu verändern, wenn es die äußeren Umstände verlangen. „Meiner Erfahrung zufolge sind es nur 20 bis maximal 30 Prozent von uns, die auf immer neue Entwicklungsmöglichkeiten und Wandel erpicht sind“, sagt Koch. Dass die Mehrheit Routinen vorzieht, ist kein Wunder. Denn unser Gehirn kann bei vertrauten Abläufen und Aufgaben in den Ökonomiemodus schalten, wir arbeiten dann unaufgeregt und effektiv.
Routinen lassen uns erfolgreicher arbeiten
Doch wer besonders bedacht auf das Einhalten von Gewohntem ist, hat mitunter ein Problem. Solche Beschäftigten tendieren unter Umständen dazu, jeden Change-Mechanismus im Unternehmen als persönliche Schikane zu empfinden, fühlen sich schnell in ihrer Identität bedroht. Vor allem in Multikrisen-Zeiten, in denen – wie während der Pandemie – auch ihr Privatleben völlig auf den Kopf gestellt wurde. Dann noch eine zusätzliche Last durch Änderungen, Vorgesetzte, die von der nun geforderten Extrameile faseln? Das weckt Frust und Widerstand. Die Führungskräfte, die Koch in solchen Situationen berät, fürchten sich indessen „vorm großen Meckern“ aus diesem Teil der Belegschaft, wenn sie eine vom Topmanagement beschlossene Neuerung durchsetzen sollen. Egal ob es um vermeintliche Kleinigkeiten wie die Einführung eines Desk-Sharing-Modells geht oder um große Transformationen und Neuordnungen im Unternehmen: „Das Management denkt viel zu oft in Maßnahmen, im sachlichen Nutzen“, beobachtet Koch. „Und übersieht dabei den wichtigsten Faktor: die menschliche Psyche.“
Empathie walten zu lassen, ist eine wichtige Aufgabe für HR und für Führung insgesamt. Zuerst gilt es zu verstehen: Warum sperrt sich mein Gegenüber etwa gegen den neuen Prozess? „Hier gibt es oft verschiedene Ebenen des Widerstands“, sagt Koch: „Die einen glauben, dass doch alles gut ist, wie es ist. Andere finden, dass ihr persönlicher Einflussbereich zu klein ist, um die Transformation bei sich selbst anzusetzen. Und wieder andere sagen schlicht: Ich kann mich da leider nicht umgewöhnen, bin nicht der Typ dafür.“ Erst wenn die Führungskraft genau zuhört und versteht, woran es bei jedem einzelnen Teammitglied hakt, kann sie einen Weg finden, damit umzugehen.
Was grundsätzlich gilt: Wandel muss erklärt werden, damit er eben nicht den Stempel einer Willkürhandlung von oben bekommt. Etwa: Warum wollen wir auf agiles Arbeiten umschwenken? Was ist die Vision dahinter? Sagt das Mittelmanagement lapidar zu seinen Truppen: „Wir müssen das jetzt anders machen, hat uns die Geschäftsführung oktroyiert, sorry Leute“, sollte niemand auf leuchtende Augen hoffen. Wer sich aber mit dem Sinn beschäftigt und sich die Sorgen und Vorbehalte anhört, kann zumindest einen Großteil der Teams mitziehen.
Uniper: Plötzlich neue Rollen
Christiane Kosmas beklagt sich nicht über unflexible Beschäftigte, ist stattdessen voll des Lobes. Seit 2021 ist die ehemalige Aldi-Personalerin Senior Vice President HR Operations bei Uniper. Sie kam in aufreibenden Zeiten in das Energieunternehmen, das 2016 als Abspaltung von Eon entstanden war. Denn hier gab es in den vergangenen Jahren keinen wohldosierten Wandel, sondern einen harten Zickzackkurs. 2021 sollte Uniper in den finnischen Fortum-Konzern integriert werden, auf die neue Firmenkultur wurde die Belegschaft bereits eingeschworen. Doch dann kam alles anders. Anfang 2022 begann der Ukraine-Krieg. Uniper glich ausbleibende Gaslieferungen seitens der russischen Gazprom zu deutlich höheren Preisen aus und belieferte seine Kunden weiter – dadurch geriet das Unternehmen wirtschaftlich ins Wanken. Schließlich wurde es im Dezember verstaatlicht, es folgte ein Vorstandswechsel. Das vergangene Jahr bedeutete also für alle rund 7.000 Beschäftigten ein aufregendes Hin und Her. Eigentlich hätte 2022 der Fokus unter anderem auf Personalentwicklung gelegt werden sollen. Doch dann rückten infolge der finanziellen Schieflage andere Maßnahmen in den Vordergrund. HR musste flexibel sein, arbeitete agiler, priorisierte Themen um.
„Die größte Herausforderung war für Uniper, die Menschen motiviert an Bord zu halten, indem wir ihnen immer wieder erklärt haben, warum wir gerade welche Wege einschlagen. So konnten wir Vertrauen stärken“, sagt Kosmas. Die Kombination aus der internen Unsicherheit bei gleichzeitigem Arbeitnehmermarkt bot schließlich die Verführung, sich nach einem anderen Job umzuschauen, in ein ruhigeres Fahrwasser zu wechseln. „Deshalb wurde Vergütung auch ein sehr wichtiges Thema, denn bei uns ist ein Teil der Gehälter an den Unternehmenserfolg gekoppelt. Das mussten wir auffangen“, sagt Kosmas. „Aber Geld allein bewegt die Menschen natürlich nicht zum Bleiben. Daher legen wir Wert auf ein gemischtes Portfolio an Retention-Maßnahmen. Insbesondere individuelle Maßnahmen und maßgeschneiderte persönliche Entwicklungspläne spielen eine wichtige Rolle.“
Neu ist seit diesem Jahr beispielsweise das Whole-Person-Programm. In diesem abteilungs- und standortübergreifenden Lernformat geht es darum, die Mitarbeitenden in ihrer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung und Selbstführung zu unterstützen, um ihr volles Potenzial in der jeweiligen Rolle zu entfalten. Im Zentrum steht die Frage: Wie lassen sich Körper, Herz, Verstand und Seele ausbalancieren? Auch Coachings lassen sich nach Bedarf anschließen. Viele Mitarbeitende und auch Führungskräfte haben die Chance, teilzunehmen, direkt wahrgenommen. „Es ist wichtig, dass Führungskräfte mit gutem Beispiel vorangehen“, erklärt Kosmas. „Wir wollen den Menschen Zeit und Begleitung dafür einräumen, über ihre Rollen nachzudenken“, sagt die Personalchefin. „So können sie eigene Entwicklungschancen erkennen und definieren.“ Denn das ist im vergangenen Jahr, als es vor allem darum ging, gemeinsam die Energieversorgung im Land zu gewährleisten, etwas zu kurz gekommen.
Dabei war Flexibilität 2022 gefordert wie nie, Rollen wurden im Verlauf der Krise teils obsolet, Personal musste anders eingesetzt werden als geplant. So hatte es beispielsweise noch zu Beginn des vergangenen Jahres ein Transformationsteam gegeben, das sich mit der Integration Unipers in den finnischen Fortum-Konzern beschäftigt hat. Plötzlich war das Thema vom Tisch. Es ging stattdessen um die Frage: Wie gelingt die Stabilisierung des Unternehmens? „Man kann den Beschäftigten dann nicht einfach sagen: Ab morgen kümmerst du dich bitte darum“, sagt Kosmas. Stattdessen brauchte es Vorbereitung, Enabling: Coachings, Reflexionen, Weiterbildungsmaßnahmen. All das hat sich ausgezahlt, findet die Personalerin: „Mein Eindruck ist, die Kolleginnen und Kollegen sitzen heute wieder fest im Sattel.“ Dass sie so flexibel waren, ihre Komfortzone zu verlassen, rechnet sie ihnen hoch an.
Es ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass Menschen bereit sind, ihre Aufgabengebiete komplett zu wechseln, weil gerade Not im Unternehmen besteht. Dass Arbeitgeber ein Recht darauf haben, dass Mitarbeitende sich bis zu einem bestimmten Grad anpassen und verändern, findet Konrad Stadler allerdings schon. „Wenn jemand mit 52 sagt: Auf den Zug der Digitalisierung springe ich nicht mehr auf, dann geht das natürlich nicht“, sagt der Philosoph und Change-Berater. Zwar werde er oder sie vielleicht nicht zum IT-Profi, müsse sich aber zumindest mit der neuen Unternehmenssoftware vertraut machen.
Flexibilität kann auch Loslassen bedeuten
Stadler wird von Führungskräften oft dann hinzugezogen, wenn es knirscht im Change, wenn Beschäftigte sich aus Sicht ihrer Vorgesetzten nicht flexibel genug zeigen. „Oft verlangt das Topmanagement den Menschen viel zu viel Tempo ab“, sagt er. Für den Vorstand läge der Sinn des Neuen komplett auf der Hand, ihn zu erklären, werde jedoch vernachlässigt. Mitunter sogar dann, wenn der Wandel den Arbeitsalltag komplett umkrempele. Das hat er beispielsweise in der Beratung eines großen Bauunternehmens beobachtet. Dieses war dazu übergegangen, die Fertigungs- und Bauprozesse zu industrialisieren. Wo früher Ingenieurinnen und Ingenieure mit großer Kunstfertigkeit Bauwerke schufen, sollte nun mit Standards und Takten gearbeitet werden. Die betroffenen Fachleute fühlten sich in ihrem Berufsethos gekränkt, reagierten frustriert. „Menschen haben ein Grundbedürfnis, ihr Selbstkonzept zu bewahren“, sagt Stadler. Haben sie den Eindruck, nicht nur ihre Arbeit, sondern sie selbst sollen verändert werden, dann gehen sie – verständlicherweise – in den Widerstand. Der Berater legte den Führungskräften also nahe, zuerst das Warum anschaulich zu machen. Dass die Maßnahme keine Geringschätzung der Ingenieursarbeit ist, sondern auf veränderte Marktbedingungen zurückgeht: Wenn es auf den Baustellen chronisch an Personal fehlt, dann müssen mehr Prozesse automatisiert laufen, um als Unternehmen bestehen zu können. „Das sollte man aber nicht einfach via Powerpoint-Präsentation erklären, sondern wirklich erlebbar machen, etwa über eine Musterbaustelle, die allen gezeigt wird“, sagt Stadler. Denn zu oft werde die Abstraktionsfähigkeit der Menschen von den großen Visionären im Hintergrund überschätzt.
Wenn sie selbst in Neuerungsprozesse eingebunden werden, sie mitentwickeln und beeinflussen dürfen, ist am ehesten vorzubeugen, dass Fachkräfte sich durch solche Maßnahmen degradiert fühlen. Zudem sollte es Leuchtturmprojekte und jeweilige Change-Updates geben. Aber auch die Teamzusammenstellung selbst spielt eine Rolle, wenn es um Anpassungsfähigkeit geht, weiß Stadler.
Wenn die Flexibleren – oft, wenn auch nicht immer, sind das die Jüngeren im Team – mit den weniger Wandlungswilligen zusammensitzen, sollte jede Perspektive wertgeschätzt werden, statt in den Kampf zu gehen. Angesichts des Change kann man gemeinsam überlegen: Welche Rahmenbedingungen können womöglich auch innerhalb des Wandels stabil bleiben? Was muss sich tatsächlich ändern? Wie gehen wir mit den unterschiedlichen Bedürfnissen um? Psychologe Koch ist dabei ein Verfechter der Disney-Methode, die auf den gleichnamigen Trickfilmschöpfer zurückgeht. In dem Unterhaltungskonzern sei es die Strategie gewesen, dass neue Ideen von Personen diskutiert werden, die sie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten: Enthusiastische und geistig flexible Träumer stehen hemdsärmeligen Machern gegenüber – sowie Neutralen und den Kritikern, die überall nach einem Haar in der Suppe suchen. „Wendet man dieses Denkmodell im Change an, kommen oft pragmatische und gleichzeitig beschwingte Umsetzungsmöglichkeiten heraus“, sagt Koch.
Doch bei allen Kompromissen: Nicht immer werden sich hundert Prozent der Beteiligten am Ende mit gewandelten Aufgabenbereichen und neuen Prozessen anfreunden können. Für Arbeitgeber wird das vor allem dann zum Problem, wenn sie innerlich aussteigen, aber nicht kündigen, Stichwort Quiet Quitting. Denn gerade diejenigen, die dem Wandel eher ablehnend gegenüberstehen, scheuen sich häufig vor einem klaren Cut. Ihnen fehlt es schließlich oft auch an der Flexibilität, sich beruflich umzuorientieren. „Wenn sich die Rahmenbedingungen des eigenen Tuns radikal ändern, muss man das nicht zwangsläufig aushalten“, sagt Koch. Aber was tun, wenn HR oder die direkte Führungskraft in den regelmäßigen Gesprächen merkt: Da wird jemand nicht glücklich und es wäre eigentlich heilsam für sie oder ihn loszulassen? Kochs Vorschlag: „Meine Reaktion wäre dann: Ich sehe, dass du nicht zufrieden in deiner Rolle bist. Wie stellst du dir die kommenden Monate und Jahre vor? Welche Spielräume siehst du, dass die Situation besser wird für dich?“ Auch ein externes Coaching anzubieten, könne hilfreich sein. Oft gäbe es mehr Spielräume als geahnt. Aber: „Flexibilität heißt nicht, dass Menschen sich verbiegen müssen, zu Opfern werden und in ihrem Berufsalltag leiden“, sagt Koch. Zu gehen kann unter Umständen also ein guter Weg sein, wenn jemand mit dem Change nicht zurechtkommt. So ist es auch bei dem Bauunternehmen gewesen, das Konrad Stadler beraten hat: Manche Ingenieurinnen und Ingenieure hatten Freude daran, ganz neue Methoden für die Automatisierung mitzutragen. Andere erkannten den von ihnen gewählten Beruf in der neuen Tätigkeit nicht wieder und entschlossen sich, das Unternehmen zu verlassen. Bei so drastischen Änderungen ist das durchaus nachvollziehbar, wenn die Flexibilität nicht ausreicht.
Geteilte Arbeitsplätze werden indessen wohl niemanden ins tiefe Unglück stürzen. Im eingangs genannten Kölner Büro haben die Teammitglieder, denen „ihr“ Platz wichtig ist, übrigens strategisch ein paar persönliche Gegenstände auf den jeweiligen Tischen platziert. Nur fürs Gefühl. Bilder und Pflanzen sind im Zweifel ja auch schnell wieder weggeräumt. Wenn neue Kolleginnen und Kollegen kommen, zum Beispiel. Alles ganz flexibel.
Weitere Artikel:
- „Optimismus macht flexibel“
- Sieben Gedanken zu Multitasking
- Resiliente Führung im Alltag: So schaffen Sie Routinen
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Flexibilität. Das Heft können Sie hier bestellen.