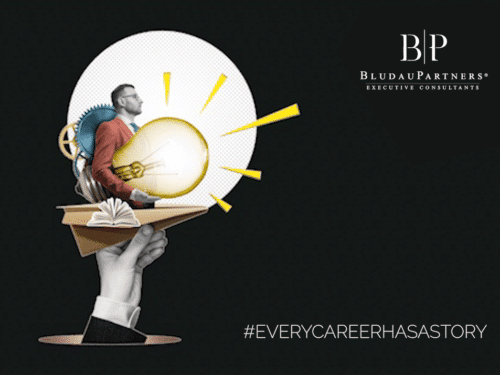Als die Pandemie noch jung war, waren die Menschen, ob groß oder klein, durch die staatlich verhängten Lockdowns immer wieder quälend lange auf engem Raum zusammengepfercht. Kein Spielplatz, kein Kino, kein Fitnessstudio, keine Partys. Viele Menschen konnten diese freizeitgewordene Alternativlosigkeit kaum ertragen. Also wurden Spiele angeschafft: Die Industrie rund um klassische Gesellschaftsspiele sowie Online- und Videospiele boomte. Die Spieleindustrie etwa setzte 2021 weltweit mehr als 180 Milliarden Dollar um – so viel wie nie zuvor.
Nicht nur in deutschen Wohnzimmern gibt es ein wundersames Wachstum der Spieledichte zu bestaunen. Auch woanders setzte es bereits vor einiger Zeit ein: in Unternehmen. Waren es Anfang der 2000er nur vereinzelte Berliner Start-ups, die in Stellenausschreibungen in betonter Lässigkeit auf den Kickertisch im Eingangsbereich verwiesen, so verfügt heute gefühlt jeder noch so verschnarchte Mittelständler über eine eigene Playstation-Lounge. Vor wenigen Jahrzehnten hätte ein solches Angebot irritiert. „Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps“ lautet schließlich eine alte deutsche Beamtenweisheit. Will heißen: Arbeit und Privates sind bitteschön zu trennen. Sie kommt aus einer Zeit, in der es eher unüblich gewesen wäre, als Teamevent eine Schnitzeljagd zu veranstalten und zwischen zwei Management-Meetings Tischtennisturniere zu bestreiten.
Dieser Essay könnte nun also folgende Geschichte erzählen: Früher galt das Spiel als kindisch, es hatte im professionellen Raum nichts zu suchen. Heute sind wir glücklicherweise weiter, haben das Potenzial erkannt, das im Spielerischen steckt. Toben uns aus, entwickeln uns weiter, unterstützt von begeisterten Arbeitgebern, die den Nährboden dafür bereiten. New Work. Gamification. Playfulness. Hurra!
Futter fürs Gehirn
Aber so funktioniert die Geschichte leider nicht. „Wir verlernen das Spielen zusehends“, sagt Gerald Hüther betrübt. Der Neurowissenschaftler beschäftigt sich seit Langem mit dem Thema, hat ihm gemeinsam mit Co-Autor Christoph Quarch 2016 sogar ein Buch gewidmet: Rettet das Spiel. Hüther weiß, wie essenziell das Spielen für die menschliche Entwicklung ist. „Das Spiel ist die effektivste und ursprünglichste Lernmethode“, sagt er. „Es ist ein Austesten dessen, was geht. Zum Beispiel, indem die Katze ihrem Schwanz hinterherjagt oder das Kind ausprobiert, wie es die Eltern zur Weißglut bringen kann.“ Beim Spielen werden Botenstoffe freigesetzt, die in unseren Gehirnen das Wachstum unserer neuronalen Vernetzungen anregen.
Zwar gibt es immer mehr Spiele, analog wie digital. Doch den Kern des Spielerischen, der das Reservoir der riesigen Vernetzungsmöglichkeiten in unseren Hirnen ausschöpft, erkennt Hüther darin seltener. „Wenn etwa ein Kind im Wald aus den Materialien, die es dort findet, aus eigenem Antrieb eine Zwergenhütte baut, dann hat es unendliche Möglichkeiten, kann seinen Entdeckergeist vorantreiben“, erklärt der Hirnforscher. „Spielt es ein Computer- oder Brettspiel, sind die Optionen indessen sehr begrenzt, es gibt zu viele vorgefertigte Muster.“ Statt einem weißen Blatt Papier gibt es also „Malen nach Zahlen“, statt einfacher bunter Klötze inzwischen eine durchkomponierte Lego-Themenwelt. Der Entdeckergeist wird in enge Bahnen geleitet.
Erwachsene verstehen unter Spielen oft sowieso etwas ganz anderes: Nämlich eine vom eigentlichen Tun abgekoppelte Freizeitbeschäftigung. Hierbei geht es eben nicht um das Austesten neuer Möglichkeiten, sondern am Ende meist (recht plump) darum, sich zu messen, zu siegen. „Regelbasierte Spiele, die aufs Gewinnen zielen, haben einen völlig anderen Effekt als das freie Spiel. Ich würde sie eigentlich nicht einmal Spiel nennen wollen, sondern eher in die Kategorie Wettkampf schieben“, sagt Hüther. Was dem Spielen entgegensteht, ist der Druck: Die Spielenden sollen ja trotzdem effizient sein, das Spiel steht in einer Erwartung. Das sei kontraproduktiv, findet Hüther. „Wir brauchen mehr offene, ziellose Spiele.“ Wenn sofort ein Effekt erwartet wird, ist das Spielerische nämlich leider nur vorgetäuscht.
Auch beim Online-Rollenspiel Tibia gibt es klare Ziele. Ritter, Druiden und andere Charaktere bekämpfen Monster und sammeln dabei möglichst viele Erfahrungspunkte. Diese symbolisieren das Level einer Figur, das immer weiter gesteigert werden kann. Tibia gibt es seit 1997, es wird von einer halben Million Menschen weltweit gespielt. Es ist der bisher größte Hit des Regensburger Softwareentwicklers Cipsoft, entstanden zunächst als ein studentisches Hobbyprojekt der Unternehmensgründer. Heute arbeiten hier rund 100 Menschen, viele von ihnen haben sich aus Begeisterung für das Spiel – oder Computerspiele generell – für ihren Arbeitgeber entschieden.
Spielraum schaffen
Cipsoft-Personalchefin Sandra Hennig gehört nicht dazu. „Ehrlich gesagt: Ich bin keine große Gamerin“, gibt sie zu. „Aber ich habe mich trotzdem ganz bewusst für den Job entschieden – wegen der Kultur.“ Die Werte als Arbeitgeber werden durch drei „Pixelbotschafter“ symbolisiert: Der Ritter steht für Sicherheit, der Drache für Freiheit und die Entdeckerin für Neugier. „Dein Spielraum“ lautet das Motto der Arbeitgebermarke. Und die wird gelebt, wie Hennig betont. Damit ist nicht unbedingt gemeint, dass die Beschäftigten sich jederzeit im Gemeinschaftsraum „Ciploft“ zum gemeinsamen Zocken verabreden können. Das ist der physische Spielraum, sozusagen. Viel wichtiger ist aber etwas anderes. Wer hier arbeitet – egal ob als Programmiererin, Game-Designer oder auch in HR und Vertrieb –, bekommt Spielraum im Sinne von mehr Zeit für eigene Ideen und weniger Druck. Seit 2021 dürfen nämlich alle Beschäftigten 20 Prozent ihrer Arbeitszeit damit verbringen, an eigenen Spieleideen zu tüfteln. Wer einen Einfall für ein neues Online-Game hat, kann ihn allein oder mit anderen umsetzen. Und sich ganz frei Weiterbildungen aussuchen, um das eigens initiierte Projekt voranzutreiben – etwa als Personalerin bei Interesse einen Designkurs belegen.
„Diese Möglichkeit wird viel und gern genutzt“, sagt Hennig. Aktuell werden von Mitarbeitenden in Eigenregie mehrere neue Spielwelten erschaffen, die dann – verbunden mit einer kleinen internen Feier – im ganzen Unternehmen vorgestellt werden. Zur Marktreife hat es bislang zwar noch keines dieser persönlichen Projekte geschafft. „Aber darum geht es zu diesem Zeitpunkt ja auch noch nicht“, sagt Hennig. „Die Option, einen Teil der Arbeitszeit für eigene Projekte einzusetzen, ist auch als Spielwiese gedacht. Die Menschen sollen Spaß haben und sich ausprobieren. Und wenn die eigene Idee irgendwann nicht mehr weiterverfolgt wird, ist das natürlich auch kein Problem.“
Was das Unternehmen erkannt hat: Wer Fantasiewelten erschafft, ist auf Kreativität angewiesen. Und äußerer Druck ist dafür alles andere als förderlich. „Hier wird mit Vertrauen gearbeitet. Zwar gibt es individuelle Ziele und Teamziele, aber wie man dort hinkommt, bleibt allen weitgehend selbst überlassen“, sagt die Personalerin. Es werde sehr darauf geachtet, dass es den Mitarbeitenden gut gehe, dass sie nicht unter Stress gerieten. Tatsächlich schafft das Mehr an Lockerheit, der Spielraum, für Arbeitgeber und Beschäftigte eine Win-win-Situation.
Die Macht der Entspannung
Dass diese Strategie aufgeht, hat einen Grund. „Hirnorganisch ist die Sache klar: Wer entspannt ist, kann besser denken beziehungsweise kreativ sein“, fasst Irene Preußner-Moritz den Zusammenhang kurz und knapp zusammen. So war es auch kein Zufall, dass die Beraterin und promovierte Psychologin ausgerechnet in einer persönlichen Mußezeit, in der sie gerade einen Auftraggeber verloren hatte, ein Geistesblitz ereilte: Sie erfand ein eigenes Spiel. Es trägt den Namen Mensch denk an dich und fällt keineswegs in die Kategorie „Wettkampf“. Es soll stattdessen dazu dienen, Teams resilienter zu machen, die interne Kommunikation in Unternehmen zu fördern, auch Führungskräften dabei helfen, die Scheuklappen abzulegen. Dafür gibt es ein Spielbrett, Figuren und, angelehnt an das bekannte Brettspiel Activity, Aktionskarten. Auf denen wird zu neuen Ideen oder Austausch aufgerufen, etwa: „Tragt gemeinsam Beispiele zusammen, wie ihr während der Krisenzeit gut für euch gesorgt habt, danach klopft euch gegenseitig auf die Schulter.“ Darüber wird dann im Team gesprochen, manche Lösungen müssen auch gemalt oder pantomimisch präsentiert werden. Das Spiel dauert etwa 90 Minuten und kann in Workshops oder Seminare integriert werden – mit insgesamt bis zu zwölf Personen in vier Teams, bestenfalls quer durch alle Hierarchieebenen.
Preußner-Moritz hat inzwischen mehr als hundert Spielverläufen beigewohnt. Sie freut sich jedes Mal über die individuell entstehenden Dynamiken. In einem internationalen Konzern hat die Spieleerfinderin Mensch denk an dich einmal mit einer Gruppe aus Geschäftsführung und An- und Ungelernten gespielt, erzählt sie. Ein Format, das in üblichen Workshops erfahrungsgemäß schwierig wäre. Im Spiel war das jedoch nicht der Fall. Es wurde eine Fragekarte gezogen: „Was machst du, um die Wertschätzung aller Mitarbeitenden zu stärken?“ Eine junge Abteilungsleiterin berichtete: „Wir betreiben Schaukästen, in denen die Projekte aller ausgestellt werden mit Fotos und Zitaten der jeweiligen Beschäftigten.“ Der Geschäftsführer zeigte sich begeistert: „Das machen wir jetzt überall so, verkündete er“, erinnert sich Preußner-Moritz und fügt hinzu, dass gerade unter Führungskräften die schnelle Umsetzung nach dem Spiel nicht ungewöhnlich ist.
Natürlich gibt es auch diejenigen, die von Anfang an keine Lust haben, die das Spielen als sinnlos, als Räuber ihrer wertvollen Arbeitszeit empfinden. Oder solche, die zunächst skeptisch sind, weil es ihnen peinlich ist, vor Vorgesetzten und Teammitgliedern „herumzuhampeln“. „Niemand wird während des Spiels zu etwas gezwungen“, sagt Preußner-Moritz. „Aber in den allermeisten Fällen löst sich das Unbehagen im Laufe der Partie. Verweigert hat sich noch niemand und am Ende fanden es alle gut.“
Der Schlüssel: Kaffeepausenatmosphäre
Das Personalmanagement fremdele häufig mit dem Thema Spielen, beobachtet die Psychologin, „obwohl das doch so offensichtlich Teil unserer Natur ist“, wie sie sagt. „Es wird oft betont: Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Ich erlebe aber etwas anderes. Viele Unternehmen hängen immer noch dem Taylorismus hinterher, nach dem Prinzip: Wie passen wir den Menschen in die Wirtschaft ein?“ Doch das Hamsterrad, das Effizienzgetriebene, macht uns mürbe und unsere Arbeit schlechter. Stress sorgt für einen Tunnelblick. Er veranlasst uns zum Kämpfen, Fliehen oder Erstarren, aber ganz sicher nicht dazu, neue Ideen zu entwickeln und kreativ zu sein. In den Spiele-Runden wird laut Preußner-Moritz indessen gelacht. Und das sei der Schlüssel, um aus einer entspannten Situation heraus Lösungsstrategien zu entwickeln. Schließlich kämen die guten Einfälle doch meist eher in der Plauderei zwischendurch als im durchgetakteten Meeting. „Das Spielerische schafft eine Art Kaffeepausenatmosphäre“, sagt die Expertin.
Wir lernen also ganz im Sinne Gerald Hüthers: Man kann das Spiel nicht einfach auslagern. Eine Viertelstunde am Kickertisch bringt wenig an einem sonst vollgestopften, durch und durch ernsthaften Arbeitstag. Stattdessen sollte man Elemente freien Spiels in den Unternehmensalltag integrieren, Freiräume – Spielräume – lassen. „Raum zu geben und Druck zu nehmen, das ist wichtig“, sagt Hüther. Aber: „Allein Räume zu schaffen macht auch noch nicht kreativ, Menschen müssen kreativ sein wollen.“ Und das erreiche man eben nur dann, wenn sie in ihrem Job Sicherheit haben. Wenn sie mit anderen zusammen ein bestimmtes Anliegen verfolgen. Etwas, das sie aus intrinsischer Motivation heraus umsetzen möchten. Wie genau das gelingt, war bisher kaum Gegenstand der psychologischen Forschung. „Es ging immer eher darum, wie man Menschen dazu bringt, etwas zu tun, das sie nicht wollen“, sagt Hüther. Im damaligen Prinzip Abrichten und Dressieren war kein Platz fürs Spiel. Das ändert sich hoffentlich in unserer Arbeitswelt. „Es wäre großartig, wenn die tatsächliche Bedeutung des Spiels wieder ins Bewusstsein rücken würde“, sagt der Hirnforscher. Unternehmen und HR dürfen also kreativ werden und sich Strategien dafür überlegen. Ganz ohne Druck, versteht sich.
Weitere Beiträge zum Thema:
- Was Führungskräfte von Sokrates lernen können
- Die Kultur der Unvollkommenheit
- 7 Tipps für eine gesunde Fehlerkultur im Unternehmen
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Spielen. Das Heft können Sie hier bestellen.