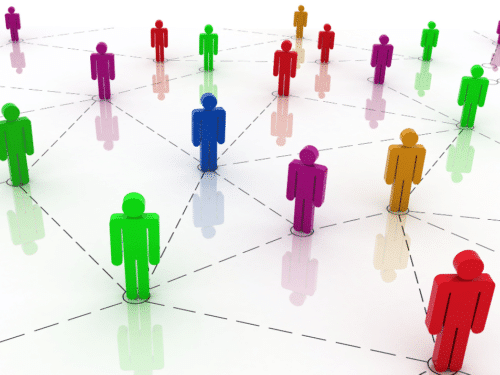KI ist für einige längst zur Kollegin geworden. Sie ist immer da, lässt nie die dreckige Kaffeetasse am Platz stehen und hat auf alles eine Antwort. Im Alltag bringen uns KI-Chatbots auf neue Ideen, formulieren lästige Mails oder fassen für uns lange Texte zusammen. Ihre blitzschnelle und rein logisch basierte Rechenleistung kann Menschenleben retten. Seit Jahren wird KI in der Radiologie eingesetzt, sie erkennt Brüche und schon kleinste Anzeichen von Krebs. Könnte doch nicht besser laufen. Was für ein Segen für die Menschheit und Wirtschaft, oder?
So einfach ist es dann doch nicht. Schließlich hat KI keine Emotionen. Es geht rein um die Verarbeitung von Daten und ihre Verknüpfungen. Alles ist logisch. Entscheidungen basieren auf Fakten, nicht auf Bauchgefühl. Positiv dabei ist: Die KI blendet persönliche Vorlieben aus, die ansonsten in einer Bewerbungsrunde zum Beispiel unberechtigterweise einige Menschen vorziehen, obwohl andere objektiv besser für den Job geeignet wären. Negativ bleibt: KI ist, auch wenn das Wort „künstlich“ darin steckt, nur so schlau wie ihr menschlicher Schöpfer oder die Daten, mit denen sie gefüttert wird. Waren zuletzt Männer am längsten auf und in den höheren Positionen, könnte die KI bei der Bewerberauswahl diese bevorzugen – und zwar ganz objektiv. Das darf natürlich nicht passieren.
„Die zugrundeliegenden Daten müssen von hoher Qualität sein und eine systembedingte Diskriminierung ausschließen“: So formuliert es der Ethikbeirat HR-Tech in seiner Richtlinie für den verantwortungsvollen Einsatz von KI in der Personalarbeit. Weiter heißt es sinngemäß: HR weiß, dass datenbasierte und automatisierte Entscheidungsprozesse nicht automatisch objektiv und fair sind.
Dessen ist sich Annika von Mutius sehr bewusst. Sie hat zusammen mit Larissa Leitner das Recruiting-Unternehmen Empion gegründet. Mithilfe von KI wollen sie für Jobsuchende die passende Stelle finden und für Unternehmen die besten Talente. „KI wird nie komplett objektiv sein, weil die Trainingsdaten es nie waren“, sagt sie. „Aber wir können gegensteuern und in die KI-Architektur eingreifen.“ Stellt von Mutius zum Beispiel fest, dass die Algorithmen Männer bevorzugen, kann sie die Komponente „Geschlecht“ einfach aus dem Entscheidungsset entfernen. Schwieriger wird es bei indirekten Ungleichheiten. Eine KI könnte auch Männer bevorzugen, weil sie im gleichen Alter und ohne Erziehungszeiten oft mehr praktische Erfahrung vorweisen können und häufiger in Vollzeit arbeiten. „Da können wir nicht einfach Kriterien aus der Architektur entfernen“, sagt die Recruiting-Expertin. Und es gibt noch einen Nachteil: Je weniger Parameter einbezogen werden, desto schlechter wird die Entscheidung.
Das gilt übrigens auch für ganz analog getroffene Entscheidungen. Es braucht keine KI, um einen unfairen Entschluss zu fassen. Wir alle sind voreingenommen, so sehr wir uns auch um Objektivität bemühen. Personalverantwortliche, Abteilungsleitungen, Vorstandsmitglieder – sie alle haben eine Persona im Kopf, die ihrer Ansicht nach am besten auf die Stelle passt.
Die KI, deine Freundin und Helferin
Bewegen wir uns nun einmal weg vom Einstellungsprozess. Denn KI greift schließlich in alle Bereiche des Unternehmens ein. Entsprechend müssen alle lernen, mit ihr umzugehen. Und das ist gar nicht so leicht, vieles verändert sich fundamental. Solche Entwicklungen kennen wir, schließlich haben wir solch eine Diskussion schon einmal geführt – und zwar mit Einzug der Robotik. Die Angst: Bald gibt es kaum noch Blue-Collar-Worker. Das stimmt jedoch nicht ganz. Ja, es gibt mittlerweile Autofabriken, in denen kaum noch Menschen eingesetzt werden. Das liegt aber auch nur daran, dass diese Branche aufgrund der immer gleichen Produkte so einfach zu automatisieren ist. In den meisten Industrien und bei Dienstleistungen geht das kaum bis gar nicht.
Roboter sind nämlich meist nur in einer ganz spezifischen repetitiven Arbeit gut und eingeschränkt anpassungsfähig, zum Beispiel weil ihr Greifer nur eine bestimmte Größe hat, weil sie nur mit einer gewissen Zahl an Werkzeugen ausgestattet oder an einem Ort fest installiert sind. Wenn Roboter eines tun, dann: entlasten. So können sie zum Beispiel in Restaurants dem Servicepersonal schwere Teller, Platten und Co zum Tisch fahren. Sie sehen aber nicht, wenn ein Gast unglücklich mit seiner Bestellung wirkt, können keine Tische abräumen und eindecken oder bei einem fast leeren Glas eine neue Runde anbieten.
Die Sorge um die Arbeitsplätze war in den meisten Fällen also unbegründet. Nun geht es ausgerechnet den anderen an den Kragen. „Ich verstehe, dass gerade White-Collar-Worker Sorge um ihre Jobs haben“, sagt Matthias Peissner, Leiter des Forschungsbereichs Mensch-Technik-Interaktion am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. In einer Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte aus dem Sommer 2023 gaben 43 Prozent an, Sorge zu haben, in den kommenden fünf Jahren aufgrund von KI ihren Job zu verlieren. „Diese Ängste müssen wir ernst nehmen. Aber KI wird nicht der gefürchtete Job-Killer sein. Gefährlicher als die KI ist die Angst vor ihr.“ Wer sich wegduckt und KI als Gegnerin sieht, setzt den Job erst recht aufs Spiel. Menschen, die KI als Kollegin, Helferlein oder Unterstützung ansehen, haben eine Chance, an dieser Herausforderung zu wachsen. Stichwort: lebenslanges Lernen. KI wird nicht wieder verschwinden und wir stehen auch erst am Anfang der rasanten Entwicklung.
Während wir vor etwa 15 Jahren noch Pixelbrei mit unseren Handykameras aufgenommen haben, können KI-Tools schon heute realistisch anmutende Filme nur mithilfe von Textbefehlen erstellen. Textbefehle, „Prompts“ genannt, sind der Kern der meisten KI-Anwendungen. Menschen, die jetzt lernen, wie sie effektiv mit KI kommunizieren können, haben heute und morgen Vorteile. Wer KI nutzt, schafft mehr in der gleichen Zeit. Laut Deloitte-Umfrage arbeiten 63 Prozent der Befragten mit KI-Einsatz effizienter. Aber bitte nicht falsch verstehen! Es geht nicht darum, sich selbst noch mehr auszupowern. Die KI soll uns die lästigen Aufgaben abnehmen, so wie die Co-Robots die eintönige und anstrengende Fließbandarbeit übernommen haben. Die gewonnene Zeit lässt sich dann mit wertvoller Arbeit füllen – also die, für die es wirklich Menschen, Kreativität, Emotionen und Abwägungen braucht.
Denn das ist es, was wir gut können. Hans Rusinek, Buchautor, Forscher und Berater zu Themen der Arbeitswelt, unterscheidet deshalb zwischen
menschlicher und künstlicher Intelligenz. „KI kann uns helfen, uns auf die Arbeit zurückzubesinnen, die wirklich menschlich ist“, sagt er. Sie übernimmt dann die Aufgaben, für die es keine oder nur wenig Kreativität braucht. Darunter fallen zum Beispiel Sortieren, Daten aufbereiten, Mailings verfassen oder auch Standardfragen im Kundenservice beantworten. In den meisten Fällen und Unternehmen lassen sich diese Aufgaben einfach automatisieren. Diese maschinellen Tätigkeiten haben groteskerweise in den vergangenen Jahrzehnten jedoch Menschen ausgeführt, sie wurden zu Tippmaschinen oder haben die gleiche Frage hundertmal am Telefon beantwortet. Oder wie Konrad Zuse, der Erfinder des Computers, es ausdrückte: „Die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch, ist nicht so groß wie die Gefahr, dass der Mensch so wird wie der Computer.“
Unsere Intelligenz verändert sich
Es wird Zeit, sich auf unsere menschliche Intelligenz zurückzubesinnen und das zu tun, worin wir gut sind. Zum Beispiel: das Wahrnehmen von Gefühlen. „Empathie ist in unserer aktuellen Arbeitswelt eindeutig ausbaufähig“, sagt Rusinek. Der KI-Boom stimmt ihn in dieser Hinsicht positiv. „KI kann uns die ganze kalte, rechnerische Arbeit abnehmen und gibt uns mehr Raum für uns selbst, unsere menschliche Intelligenz und menschlichen Gefühle.“ Und die KI könnte noch etwas Gutes an sich haben. Während sie uns alle einfache Aufgaben abnimmt, offenbart sie auch Ineffizienzen. Wenn etwa jemand bisher nur Malen nach Zahlen im Job gemacht, aber keine eigene Denkleistung eingebracht hat, dann fällt das nun auf. Leider sind das mitunter auch Positionen, für die White-Collar-Worker eingestellt werden.
„In vielen Unternehmen gibt es richtige Bullshit-Jobs und Positionen, die sich eigentlich nur mit sich selbst beschäftigen“, sagt Rusinek. Das schadet nicht nur langfristig dem Unternehmen, sondern auch der Motivation. Wir wollen gut sein in dem, was wir tun, und im Bestfall etwas damit bewirken, verlautbaren die zahlreichen Mission Statements. Purpose, Sie wissen schon. Gut also, wenn KI den Weg freiräumt auf unserer Reise zu mehr Sinn. Und auch wenn einige Positionen wegfallen werden, heißt es nicht, dass wir weniger Menschen brauchen. Rusinek hat ein Beispiel parat: „Als der Geldautomat eingeführt wurde, hatten alle Angst, dass weniger Menschen in Banken arbeiten werden.“ Mittlerweile arbeiten aber viel mehr Menschen dort und sind erfüllter, weil sie jetzt wichtige, komplizierte und strategische Fragen beantworten und ihr Fachwissen ausspielen können. Das mache glücklich, sagt der Arbeitsforscher.
Das heißt aber auch: Wir werden nicht weniger intelligent, nur weil KI uns ein paar Denkaufgaben abnimmt. Wir werden anders schlau. Unsere Großeltern zum Beispiel konnten ohne Probleme Gedichte rezitieren, kannten den genauen Butterpreis auf dem Markt und hatten, wenn sie von Hamburg nach Kassel mussten, die Landkarte spätestens nach der zweiten Fahrt im Kopf. Sie mussten all das auswendig können. Es gab keine Suchmaschinen und Smartphones in ihren Hosentaschen. Wir, die neueren Generationen, haben heute unsere smarten Helferlein und wissen häufig nicht mal die eigene Handynummer auswendig. „Wir haben stattdessen eine Kontextintelligenz entwickelt“, sagt Rusinek. Das bedeutet: Wir sind besser darin geworden, den Raum zu lesen und Informationen in ihrem Kontext zu bewerten. Diese Kompetenz wird uns im KI-Zeitalter nützlich sein und die Algorithmen werden uns immer weiter sensibilisieren.
Denn es wird so bleiben: KI ist Fluch und Segen zugleich. Es wird Kontexte geben, in denen sie uns eine große Hilfe ist und uns entlastet oder voranbringt. In anderem Kontext wird sie zur Waffe – das gilt es zu durchblicken, auch wenn das immer schwieriger wird. Denn die KI-Konstrukte werden täglich komplexer und schlauer. Wenn wir keine Grenze setzen, gehen sie vielleicht schon bald zu weit. Dem will die Europäische Union mit dem anstehenden AI-Act zuvorkommen und benennt eine No-go-Area. Das Gesetz verbietet zum Beispiel Social-Scoring-Systeme, wie sie in der Volksrepublik China angewandt werden, und KI, die die Person vor dem Bildschirm manipulieren und austricksen könnte, um etwa an Informationen zu gelangen. Doch die unmittelbare Gefahr ist viel näher als wir annehmen – und uns allen schon begegnet. Es geht um Fakes. Schon ohne KI war es leicht, Falschmeldungen zu verbreiten, die aus vermeintlich seriösen Quellen stammten. Im Februar dieses Jahres waren zum Beispiel gefälschte Audioaufnahmen der Tagesschau im Umlauf.
Darin sollen sich die Sprecher für eine einseitige Berichterstattung und bewusste Manipulation entschuldigt haben. Längst schwirren Deep Fakes von den größten politischen Persönlichkeiten im Netz umher. Erst im Februar 2024 überwies ein Konzernmitarbeiter in Hongkong 24 Millionen Euro an Kriminelle, weil er dachte, er hätte den Auftrag von seinem CFO im Videocall übertragen bekommen.
Aktion statt Reaktion
Und wie lautet nun das Fazit in dieser wirren Gemengelage? KI ist ein mächtiges, wandelbares Werkzeug. Wie ein Messer. Es kann filetieren, aber auch Furchtbares anrichten. Trotzdem verletzen wir uns mit einem stumpfen Messer eher, weil wir mehr Kraft anwenden müssen, um beispielsweise das Gemüse zu schneiden. Wer sich also vor KI verschließt und lieber mit stumpfen Programmen weiterarbeitet, verliert. Stattdessen gilt es jetzt aktiv voranzugehen, zu testen und vor allem sich weiterzubilden. Denn eines ist gewiss: Wir brauchen einen „human in the loop“, der Mensch ist immer die letzte Instanz.
Weitere Beiträge zum Thema:
- KI im Arbeitsverhältnis: Die rechtlichen Rahmenbedingungen
- Betriebsrat und KI: Gestalten statt treiben lassen
- Interview mit KI-Expertin Mina Saidze: „Ich habe mich oft wie ein Ausreißer im Datensatz gefühlt“
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Tech. Das Heft können Sie hier bestellen.