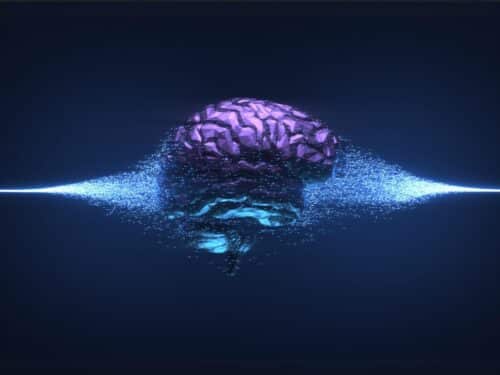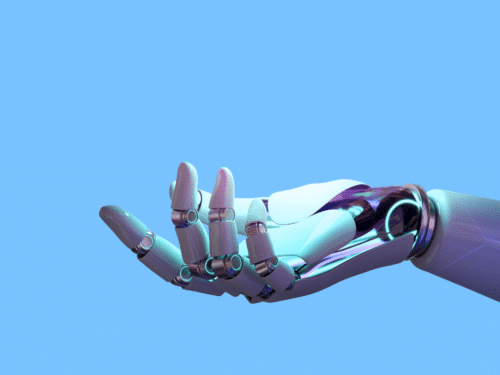Kurz vor dem Jahreswechsel hatte das Bundesverwaltungsgericht der Schweiz einen Fall (Urteil vom 16.Dezember 2019, Az.:A-6750/2018) zu beurteilen, der auch in Deutschland für Aufsehen gesorgt hat: Eine Beamtin, die an Burn-out erkrankt war, hatte von ihrem Dienstherren Schadenersatz und Schmerzensgeld gefordert. Ihre Begründung: Erst die übermäßige Belastung am Arbeitsplatz habe sie krank gemacht, ihr Dienstherr sei trotz wiederholter Hinweise untätig geblieben und habe damit die ihm obliegende Fürsorgepflicht verletzt. Auch wenn das abschließende Urteil noch aussteht, hat das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerde der Arbeitnehmerin in einem Rechtsmittelverfahren teilweise stattgegeben und den Fall zur abschließenden Prüfung an die Vorinstanz zurückverweisen.
Da das schweizerische Recht in diesem Themenkreis einige Parallelen zur deutschen Rechtslage aufweist, fragen sich daher nun auch viele Arbeitgeber hierzulande: Muss man aus kaufmännischer Vorsicht Rückstellungen für mögliche Schadensersatzansprüche bilden, sobald man als Arbeitgeber von einem Burn-out eines Arbeitnehmers erfährt? Und dürfen Arbeitnehmer, die einen arbeitsbedingt verursachten Burn-out erlitten haben, mit einer Entschädigung rechnen? Doch zunächst zum Sachverhalt.
Sachverhalt in der Schweiz
Die Beamtin – eine Juristin – war mehrere Jahre in verschiedenen Funktionen beim schweizerischen Pendant des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge beschäftigt. Zu ihren täglichen Aufgaben gehörten das Erarbeiten von Entscheidungen über Gesuche in den Bereichen Einreise und Zulassung. Zudem hatte sie kurzfristige Anfragen in den Bereichen Einreise, Wegweisung und Fernhaltung zu beantworten, wobei die meisten dieser Anfragen entweder telefonisch oder per E-Mail eintrafen. In diesen Fällen war in der Regel sofort eine Verfügung zu erlassen, da etwa die am Flughafen Zürich von einem Einreiseverbot betroffenen Personen das Land mit dem nächsten Flugzeug wieder verlassen mussten.
Der Arbeitsalltag der Beamtin war durch hohen Zeit- und Termindruck sowie durch regelmäßige Unterbrechungen geprägt. Hinzu kamen unzureichende personelle Ressourcen und fehlende Vertretungsregelungen für urlaubs- oder krankheitsbedingte Abwesenheit. Die Beamtin hatte ihren Vorgesetzten anlässlich der jährlichen Personalgespräche wiederholt darauf hingewiesen, dass sie aufgrund der hohen Arbeitsbelastung gesundheitliche Probleme habe und aus diesem Grund in ärztlicher Behandlung sei. Der Dienstherr hatte außer der eventuellen Einrichtung einer Stellvertretungsregelung – das war nach dem Sachverhalt nicht ganz klar – nichts unternommen, um die Belastung der Beamtin zu verringern. Er hatte diesbezüglich im Prozess geltend gemacht, darauf vertraut zu haben, die Beamtin habe durch die Konsultation eines Arztes bereits alle notwendigen Vorkehrungen zum Schutz ihrer Gesundheit selbstständig getroffen. Die Beamtin erlitt ein Burn-out und war mehrere Monate arbeitsunfähig. Nachdem der Versuch einer Wiedereingliederung gescheitert war, wurde die Beamtin bei der Invalidenversicherung angemeldet und entlassen.
Die Rechtslage in Deutschland
1. Grundsätzlich gelten im deutschen Recht zwischen Vertragsparteien sogenannte Rücksichtnahmepflichten gegenüber der anderen Vertragspartei, die zu beachten sind (§ 241 Abs. 2 BGB). Für einen Arbeitsvertrag leitet die Rechtsprechung daraus ab, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, auf das Wohl und die berechtigten Interessen des Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen. Er muss ihn unter anderem vor Gesundheitsgefahren schützen, auch solche psychischer Art (so ausdrücklich BAG Urteil vom 15. September 2016, Az.:8AZR351/15, Rn. 31).
Diese Rücksichtnahmepflicht des Arbeitgebers wird unter anderem im Arbeitsschutzgesetz näher konkretisiert. Dort ist geregelt, dass der Arbeitgeber die Arbeit so zu gestalten hat, dass eine Gefährdung für das Leben sowie die physische und die psychische Gesundheit möglichst vermieden wird. Verbleibt eine Gefährdung, muss diese möglichst geringgehalten werden. Sollte der Arbeitgeber seine Rücksichtnahmepflichten verletzen, kann dem Arbeitnehmer ein Schadensersatzanspruch zustehen – dieser kann auch die Zahlung von Schmerzensgeld umfassen.
2. Im Gesamtbild zeigt die deutsche Rechtsprechung der vergangenen Jahre, dass es nur selten Erfolg versprach, wenn Arbeitnehmer unter Berufung auf eine Verletzung der Rücksichtnahmepflicht Schadenersatzansprüche gegenüber dem Arbeitgeber geltend machen wollten. Denn die Rechtsprechung stellt hohe Anforderungen daran, ob ein Verhalten des Arbeitgebers die Voraussetzungen einer Verletzung der Rücksichtnahmepflicht erfüllt.
a) Vor allem ist nach der Rechtsprechung nicht jede Auseinandersetzung, Meinungsverschiedenheit oder ungerechtfertigte Maßnahme des Arbeitgebers ausreichend, um daraus eine rechtswidrige und darüber hinaus auch vorwerfbare Verletzung der Rücksichtnahmepflicht abzuleiten. Bei Arbeitsverhältnissen und der damit verbundenen Zusammenarbeit kann es typischerweise zu Konflikten und Meinungsverschiedenheiten kommen. Deshalb wird in diesem Zusammenhang anerkannt, dass viele Verhaltensweisen auftreten können, die zwar ungerechtfertigt, aber dennoch sozial- und rechtsadäquat sind. Die sozial- und rechtsadäquaten Verhaltensweisen sind nicht schadensersatzauslösend (vgl. z.B. BAG Urteil vom 15. September 2016, Az.: 8 AZR 351/15, Rn. 36 und 37).
Dass der Arbeitgeber seine Rücksichtnahmepflicht tatsächlich durch ein aktives Tun rechtswidrig und vorwerfbar verletzt hat, kann man erst dann annehmen, wenn das Verhalten des Arbeitgebers eine systematische und zielgerichtete Anfeindung gegenüber dem betroffenen Arbeitnehmer darstellt. Der Arbeitgeber muss folglich mit seinem Verhalten gerade bezwecken oder bewirken, dass der Arbeitnehmer in seiner Würde verletzt wird.
Ist der Kern des Vorwurfs gegenüber dem Arbeitgeber jedoch, dass dieser seine Rücksichtnahmepflicht durch ein Unterlassen verletzt haben soll, verlangt die Rechtsprechung, dass der Arbeitgeber trotz einer Handlungspflicht keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen hat, um die Belastung des Arbeitnehmers zu verringern.
b) Zu den eben genannten Vorrausetzungen kommt hinzu, dass der Arbeitnehmer das vorgeworfene Verhalten des Arbeitgebers beweisen können muss, er ist also darlegungs- und beweisbelastet. Oft gelingt es den Arbeitnehmern aber nicht, dies zur vollen Überzeugung des Gerichts darzubringen (vgl. etwa Urteil des LAG München vom 17. Oktober 2002, Az.: 3 Sa 78/02;Urteil des LAG Köln vom 21. April 2006, Az.: 12 (7) Sa 64/06; Urteil des LAG München vom 30. Oktober 2014, Az.: 4 Sa 159/14
c) Schließlich muss die Verletzung der Rücksichtnahmepflicht auch kausal zum Burn-out beziehungsweise den dem Arbeitnehmer aufgrund des Burn-outs entstandenen Schäden geführt haben (sogenannte haftungsbegründende Kausalität). Selbst wenn also die Verletzung der Rücksichtnahmepflicht festgestellt wird (etwa, weil der Arbeitgeber keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen hat, um die Belastung des Arbeitnehmers zu verringern), müsste zur vollen Überzeugung des Gerichts auch noch festgestellt werden, dass das Burn-out kausal auf der Verletzung der Rücksichtnahmepflicht beruht. Auch hierfür ist der Arbeitnehmer darlegungs- und beweispflichtig. Da aber für die psychische Erkrankung Burn-out kaum sicher ausgeschlossen werden kann, dass nicht doch private, soziale oder genetische Faktoren zugrunde liegen, ist dieser Nachweis in der Praxis kaum zu führen. Der gleiche Grund spricht auch dafür, psychische Erkrankungen nicht als Berufskrankheiten anzuerkennen (vgl. Urteil des Landesozialgerichts Bayern vom 27.April 2018, Az.: L 3 U 233/15).
Fazit
Die deutsche Rechtsprechung der letzten Jahre zu Schadenersatzansprüchen bei Verletzung der Rücksichtnahmepflicht durch den Arbeitgeber zeigt, dass für die erfolgreiche Durchsetzung eines Schadensersatzanspruchs aufgrund eines Burn-outs tendenziell nur geringe Erfolgsaussichten bestehen. Sowohl bei der Frage, ob eine Verletzung der Rücksichtnahmepflicht besteht, als auch bei der Frage der Kausalität legt die Rechtsprechung hohe Hürden an.
Das Urteil des schweizerischen Bundesverwaltungsgerichts lässt auf den ersten Blick vermuten, dass es für Arbeitnehmer in der Schweiz einfacher sein könnte, etwaige Schadensersatzansprüche gegen ihren Arbeitgeber durchzusetzen, wenn sie aufgrund der psychischen Belastung am Arbeitsplatz erkrankt sind. Diese Einschätzung resultiert allerdings nur aus der medialen Berichtserstattung, die zum Teil zu einer Überbewertung geführt hat. Denn auch das schweizerische Bundesverwaltungsgericht hat bisher noch nicht angenommen, dass ein Schadenersatzanspruch besteht. Für die Beamtin positiv ist bislang nur entschieden, dass ihr Dienstherr keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen hat, um ihre Belastung zu verringern.
Dabei waren vor allem die Besonderheiten des Einzelfalls maßgeblich: Das schweizerische Bundesverwaltungsgericht betonte, dass der Dienstherr jahrelang untätig blieb, obwohl die Beamtin mehrfach auf die hohe Arbeitsbelastung, ihre gesundheitlichen Probleme und die ärztliche Behandlung hingewiesen habe. Das schweizerische Bundesverwaltungsgericht sah sich bei den bisherigen Feststellungen aber nicht in der Lage, über die Kausalität zu entscheiden – und hat das Verfahren deshalb zur weiteren Feststellung der Kausalität an die Vorinstanz zurückverwiesen.