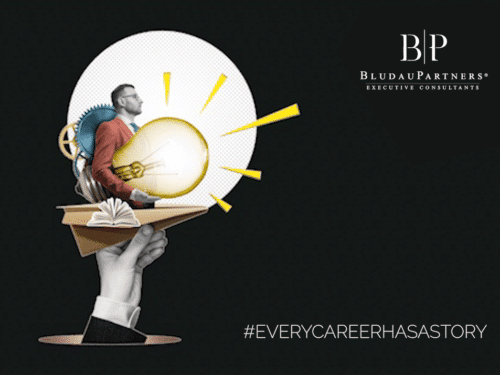Stellen Sie sich vor, Ihnen würde in diesem Augenblick ein Würfel in die Hand gedrückt. Sie haben einen einzigen Versuch: Fällt eine Eins, Zwei, Drei oder Vier, bekommen Sie ab sofort doppeltes Gehalt und dürfen zudem allen aus Ihrem Team einen Wunsch erfüllen – von der langersehnten Weiterbildung bis zum Sommerurlaub mit der ganzen Familie. Starrt Sie der Würfel hingegen mit fünf oder sechs Augen an, müssen Sie gleich morgen unwiderruflich und ohne Abschied Ihren Posten räumen. Sie haben zehn Sekunden Zeit zu entscheiden, ob Sie das Spiel spielen möchten – mit allen Konsequenzen. Und los!
Ein solches Gedankenexperiment kann helfen, sich den Charakter eines prototypischen Risikos zu vergegenwärtigen. Es besteht immer aus zwei Komponenten, die in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen. Part Nummer eins: ein drohender Schaden. Part Nummer zwei: die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Verlust eintritt. Im Würfelbeispiel lassen sich diese beiden Komponenten sogar berechnen. Die Wahrscheinlichkeit, zu verlieren, liegt bei rund 33 Prozent. Die Gewinnchance indessen – also die Inversion des Risikos – liegt doppelt so hoch, also bei gut 66 Prozent. Ob Sie sich gerade spontan dafür oder dagegen entschieden haben, hängt unter anderem von äußeren Umständen ab: Wenn Sie ohnehin mit einer anderen Stelle liebäugeln oder bequem mehrere Monate finanziell überbrücken könnten, werden Sie eher zum Zocken bereit sein. Wäre es Ihr schlimmster Albtraum, Team und Unternehmen zu verlassen, werden Sie es angesichts der recht hohen Gefahr des Scheiterns vermutlich lassen
Im echten Leben ist Risiken einzugehen nicht immer gleichbedeutend mit Zockerei. Zudem sind Stochastik und Folgen selten so klar umrissen und gut berechenbar. „Die Schadensgröße ist für Menschen in der Abwägung meistens die ausschlaggebendere Komponente, weil sie mit Wahrscheinlichkeiten oft weniger gut umgehen können“, beobachtet daher Jörg Rieskamp. Der Leiter des Center for Economic Psychology an der Universität Basel ist Experte für Risiken. Eine gemeinsame Studie mit dem Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hatte vor wenigen Jahren die These belegt, dass wir alle zudem über eine individuelle Risikobereitschaft verfügen, analog zum Konzept der Intelligenz und deren Messung durch den Intelligenzquotienten. Das heißt: Ob wir eher risikoaffin oder -avers handeln, ist nicht ausschließlich situationsabhängig. Es ist auch fest in unserer Persönlichkeit verankert. Das hat mit unserer Genetik sowie mit gewonnenen Erfahrungen, also dem Alter, und unserem kulturellen Hintergrund zu tun. So sind zum Beispiel ältere deutsche Frauen im Durchschnitt weniger bereit, Risiken einzugehen, als männliche Jugendliche aus den USA. Im Einzelfall kann das natürlich ganz anders aussehen.
Was heißt denn schon „mutig“?
Risiken lauern auch in der Unternehmenswelt allerorten und treffen HR mitten ins Herz: Wie hoch ist die Gefahr, dass Stellen nicht besetzt werden können? Oder dass die hauseigenen besten Talente abgeworben werden? Dass die Führung versagt, die Motivation der Belegschaft sinkt? Diese Szenarien klingen dramatisch, sind angesichts von Fachkräftemangel, Pandemie und Krieg in Europa jedoch nicht weit hergeholt. Den Ruf einer besonders mutigen Disziplin hat das Personalwesen dennoch nicht. Auch Angélique Thranberend, Director People Central Europe der Warner Music Group, fremdelt mit dem Begriff des Risikos. Das Wort klinge so groß und bedrohlich. Im Berufsalltag bei dem Hamburger Musikunternehmen spricht sie lieber von Handlungen und deren Konsequenzen. Thranberend meint aber auch: „Wenn wir im Personalmanagement Risiken komplett ausklammern würden, dann könnten wir keine Fortschritte machen und wären somit strategisch irrelevant.“ Jegliche Innovationen, bestätigt auch Experte Rieskamp, seien schließlich mit einem Risiko verbunden. Entscheidet sich ein Unternehmen dafür, Vertrauensarbeitszeit einzuführen, ist die Chance groß, auf dem Arbeitsmarkt und in der Belegschaft als modern zu erscheinen. Gleichzeitig besteht vielleicht ein Risiko, dass die altgediente Führungsgarde angesichts des empfundenen Kontrollverlusts querschießt.
Aber wo anfangen? „Das größte und vermeidbarste HR‑Risiko geht erst einmal die Unternehmensführung ein, wenn sie HR kleinhält, nicht im Management berücksichtigt und den Verantwortlichen keine Gestaltungsfreiheit einräumt“, sagt Personalerin Thranberend. Beherzt und innovativ kann naturgemäß nur handeln, wer über Freiheit, Einfluss und Ressourcen verfügt. Das gilt für die Abteilung genau wie für einzelne Beschäftigte im Unternehmen. Als Thranberend 2020 ihre Selbstständigkeit als HR-Interims- und Gesundheitsmanagerin aufgab, um nach Jahren zurück in eine Festanstellung zu gehen, war das Fehlen eines solchen Stellenwerts von HR im Unternehmen ihre größte Befürchtung. Sie bestätigte sich glücklicherweise nicht.
Probleme totzuschweigen ist riskant
Mit ihrem Team will sie nun an der Resilienz des Musikunternehmens mitwirken. „Die Frage ist, aus welcher Motivation heraus wir agieren“, sagt sie. Zwar gelte es, potenzielle Stolpersteine im Blick zu behalten. Als reine Gefahrenabwehr sollte sich HR aber nicht verstehen. Das enge nur ein. Zielführender sei es, Risikofaktoren nicht einzeln abzuklappern, sondern das Unternehmen als System zu betrachten, Trends in der Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt wahrzunehmen. Und eben darauf zu beharren mitzugestalten. „Jede Handlung hat Folgen, vor allem aber auch jede Unterlassung“, sagt die HRlerin. „Wenn ich mich nicht darum kümmere, dass sich Prozesse im Unternehmen modernisieren, dann erhöhe ich das Risiko, dass ich als Arbeitgeber unattraktiv werde.“
Thranberends Steckenpferd ist das Thema Gesundheit und damit verbundene Risiken. Die wurden im Personalmanagement schon vor der Pandemie sichtbar. Die Zahl der Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen ist laut aktuellem Report der DAK-Gesundheit in den vergangenen zehn Jahren um 41 Prozent gestiegen. Die Strategie vieler Unternehmen war jedoch lange: Einzellösungen finden und ansonsten verschämt über solche Fälle schweigen. Business as usual also. Kluges HR-Risikomanagement hingegen sensibilisiert vorausschauend für genau solche Themen, erkennt darin frühzeitig kritische Erfolgsfaktoren – und setzt sich auf Führungsebene dafür ein, sie anzugehen. In diesem Fall heißt das: Stressfaktoren identifizieren, mit den Menschen ins Gespräch kommen, Unterstützungsangebote erarbeiten und anbieten. Die Pandemie hat das Bewusstsein für die Verantwortung der Unternehmen nun deutlich erhöht. „Auch von uns wollen Menschen in Bewerbungsgesprächen regelmäßig wissen: Was bietet ihr zum Thema Mental Health an?“, berichtet Thranberend. „Wer hier nichts vorzuweisen hat, wird im Recruiting schlechte Karten haben.“
Nicht nur die Suche nach Personal bereitet vielen Bauchschmerzen. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass Fachkräfte heute eher dazu bereit sind, ihre Jobs zu kündigen – selbst dann, wenn sie noch keine neue Stelle haben. Stellt die Great Resignation, die vor allem in den USA um sich greift, auch in Deutschland ein neues HR-Risiko dar? Thranberend glaubt, dass aus Abgängen zuweilen falsche Schlüsse gezogen werden. „Menschen gehen ja nicht, weil es keinen Tischkicker gibt oder weil die neueste HR-Kampagne nicht fetzig genug war“. Die Risiken liegen ihrer Beobachtung nach vielmehr in einer Geringschätzung der HR-Basisarbeit: Führungsfehler, schlechte Gehaltsstrukturen, eine Kultur des Misstrauens und der Intransparenz. „Um diese Themen müssen wir uns kümmern. Wir müssen also nicht einmal detektivisch vorgehen, um Risiken aufzuspüren.“ Hilfreich sind Exit-Gespräche: Sich trauen, Menschen in die Augen zu schauen, und konkret nachzufragen, warum sie das Unternehmen verlassen – auch wenn es wehtut.
Skin in the Game
Und dann ist in den vergangenen Jahren und Monaten noch ein weiteres Risiko auf der Bildfläche erschienen: das Stimmungsrisiko. Zwei Jahre Pandemie, Isolation, jetzt der Krieg in der Ukraine. Viele Menschen sind ängstlich und erschöpft. Auch darüber sollte HR nicht schweigen. Sich unternehmensseitig darauf auszuruhen, dass das Verkraften dieser Krisen reine Privatsache sei, ist feige. Besser: Alle Führungskräfte setzen sich zusammen und beleuchten aus verschiedenen Perspektiven, was sie für ihre Teams tun können.
Auch das ist ein Weg, um Risiken für Fehlentscheidungen zu senken: Dem viel gescholtenen Silodenken den Garaus machen. „Dieser Impuls, alles Wissen der verschiedenen Disziplinen zu vereinen, den Austausch zu bestärken, sollte ebenfalls von HR kommen“, findet Thranberend. Auch in ihrem Team arbeiten alle generalistisch. Hoheitswissen zuzulassen kann nämlich riskant sein. Auch Vielfalt trägt dazu bei, Unternehmen resilienter zu machen und damit besser gegen Risiken zu wappnen. Interdisziplinär und insgesamt heterogen aufgestellte Teams haben den Vorteil, Risiken aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und abwägen zu können. „Das hilft, zu einer qualifizierteren Bewertung zu kommen“, sagt Risiko-Experte Rieskamp. Für das Unternehmen nachteilig könne es dann wiederum sein, dass sich bei einer Teamentscheidung im Schadenfall womöglich niemand wirklich verantwortlich fühlt.
Menschen gehen dann Risiken ein, wenn die Negativkonsequenzen überschaubar und akzeptabel sind“, sagt der Risikoforscher. Droht ihnen persönlich gravierendes Unheil – etwa ein Gesichtsverlust oder der finanzielle Ruin, werden sie es scheuen. Für Festangestellte sind Risiken im Arbeitsumfeld aber meist weniger existenziell. Denn sie haben in der Regel kein Skin in the Game, wie der Philosoph Nassim Nicholas Taleb in seinem Buch Das Risiko und sein Preis. Skin in the Game schreibt. Er ist der Meinung, dass nur diejenigen entscheidungsbefugt sein sollten, die auch persönlich ihre Haut riskieren, also nicht nur Früchte ernten, sondern gleichsam von den potenziellen Negativwirkungen ihrer Entscheidungen betroffen wären.
Ein Beispiel für mangelndes Skin in the Game war die Finanzkrise 2007/2008. Dass die Zuständigen in den Investmentbanken teils irrwitzige Risiken eingingen, war auch systemisch bedingt: Die Anreize und Boni waren hoch, die individuellen Risiken gleichzeitig gering. Sie waren gepolt darauf, kurzfristige Erfolge zu erzielen. In diesem Ungleichgewicht schlug die Gier häufig das Verantwortungsgefühl. Das Verhalten vieler Bankerinnen und Banker war zwar riskant – aber nicht unbedingt mutig, da die persönlichen Konsequenzen sich in Grenzen hielten. Auch das ist eine Lektion, die nicht nur die Finanzplätze lernen mussten, sondern die in jedem Unternehmen ins Risikomanagement gehört: Statt Teams und Einzelne ins Risiko zu treiben, sollten für sie Anreize geschaffen werden, verantwortungsbewusst und mit Weitblick zu handeln. Eine Aufgabe, die HR ernst nehmen sollte.
Wenn wir wissen, dass andere, uns nahestehende Menschen von den Konsequenzen unseres Handelns betroffen sind, agieren wir laut Rieskamp übrigens vorsichtiger und sind weniger zum Zocken bereit, als wenn wir Risiken nur für uns selbst abschätzen. Haben Sie sich zu Beginn dieses Beitrags eigentlich für das Würfeln entschieden? Falls nicht, probieren Sie es einmal aus. Es steht ja nichts auf dem Spiel. Diesmal zumindest nicht.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Risiko. Das Heft können Sie hier bestellen.