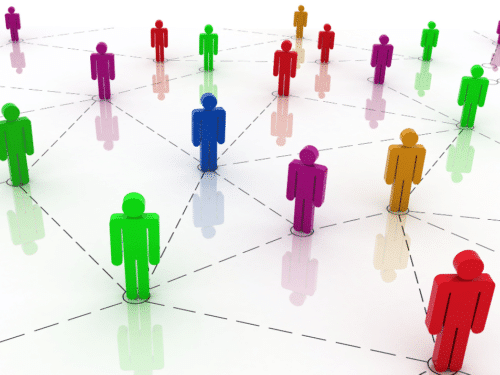Wir beobachten die digitale Transformation wie eine Naturgewalt, meint die Philosophin Lisa Herzog. Eine Rezension ihres Essays „Die Rettung der Arbeit“.
Was dräut, wenn wir Algorithmen kritiklos die Kontrolle über unser Arbeiten anvertrauen? Die Kaffeehauskette Starbucks nutzte vor wenigen Jahren eine Software, um ihr Personal besonders effizient einzusetzen. Nachdem die Aktivitäten der einzelnen Angestellten erfasst worden waren, spuckte das System Personalpläne aus, die einige Kuriositäten enthielten. Darunter die gefürchtete „Clopening“-Schicht, die einem Mitarbeiter sowohl Closing als auch Opening eines Coffeeshops zuwies – und die für dessen Alltag die Hölle bedeuteten.
Dieses Beispiel aus den USA ist eines von vielen, anhand derer Lisa Herzog illustriert, wie – wahlweise naiv oder ausbeuterisch – viele Unternehmen und Organisationen weltweit auf neue Technologien setzen. Die 1983 geborene Philosophin und Sozialwissenschaftlerin nennt Plattformen wie Uber, die sich davor drücken, Arbeitgeber zu sein, um Verpflichtungen zu entgehen, genauso wie digitale Märkte, die sich als Netzwerke gerieren und – siehe Facebook –, einmal in Monopolstellung geraten, ungebremst und beinahe willkürlich walten.
Herzog als Digital-Apokalyptikerin abzustempeln, wäre trotz dieser kritischen Töne und des pathetischen Buchtitels zu einfach. In ihrem Essay beschreibt sie den Wert des Arbeitens für den Menschen als soziales Wesen, und das gelingt ihr ganz ohne Verklärungskitsch. Ihre Stoßrichtung: Statt den Wandel nur zu antizipieren und zu akzeptieren, wird es dringend notwendig, ihn zu modellieren. Digitale Transformation lasse sich nicht auf den Homo oeconomicus anwenden, sondern müsse so gestaltet werden, dass sie der sozialen Natur des Menschen gerecht wird: „Was die Arbeit mit uns macht, hängt maßgeblich davon ab, was wir mit der Arbeit machen.“
Gewählte Unternehmer
Maschinen und künstliche Intelligenzen sollten wir uns zu Knechten machen, nicht zu Herrschern. Ob wir beispielsweise Roboter in der Pflege einsetzen sollten, ist in Herzogs durchaus schlüssiger Argumentation mehr gesellschaftlich-politische als unternehmerische Frage.
Wer an der Spitze einer Arbeitgeberhierarchie steht, hat laut Herzog die verantwortungsvolle Aufgabe „einen Mittelweg zwischen Technologiegläubigkeit und Verweigerungshaltung“ zu finden. Doch das pyramidale System hat in ihren Augen seine Grenzen.
Die digitale Transformation ermöglicht uns beispielsweise dank neuer Abstimmungstools und Debattenforen eine erleichterte gemeinsame Diskussion aller Ebenen. Darin sieht die Philosophin die Chance einer (radikalen) Demokratisierung von Unternehmen. Die Autorin nennt das Beispiel eines „bunt besetzten Gremiums“ im medizinischen Bereich. In einem solchen könnte ein Team aus Ärzten und Pflegekräften, Patienten, ITlern und Wissenschaftlern Neuerungen diskutieren, jeder von ihnen offen und fair sein Anliegen vorbringen.
Doch wer entscheidet am Ende? Das Grundproblem bleibt ungelöst. Basisdemokratisches Handeln stößt immer an Grenzen, das sieht auch Herzog so. Die Angleichung an das politische System sieht sie nicht als Ideal, aber als Verbesserung im Vergleich zum Status quo der Wirtschaftswelt. Sie beruft sich auf das Prinzip eines Zwei-Kammer-Systems: Um unternehmensrelevante Entscheidungen zu treffen, braucht es sowohl von Kapital- als auch von Arbeitsseite eine Mehrheit. Ein mögliches Zukunftsmodell ist laut Herzog die Stärkung von Genossenschaften. Die alte Idee dahinter erhielte durch den technologischen Fortschritt neue Relevanz. Taxifahrer könnten sich beispielsweise in einer solchen zusammenschließen und eine gemeinsame App betreiben, anstatt einem Nicht-Arbeitgeber wie Uber das Feld zu überlassen.
Herzog tritt vehement dafür ein, dass nicht der Kapitalismus den Fortgang der digitalen Transformation steuert, sondern die Demokratie. Auch den (nicht ganz neuen) Vorschlag einer Kapitalsteuer auf Algorithmen, Computer und Roboter bringt sie ins Spiel, geltend auf europäischer Ebene.
Die Vision bleibt vage
Bei ihrem Zukunftsentwurf handelt es sich allerdings nicht um eine konkrete Anleitung, sondern eher um einen beherzten Vorschlag, das Trial-and-Error-Prinzip anzuwenden: Wenn sich nach und nach abzeichne, dass demokratisch geführte Unternehmen wettbewerbsfähig seien und für welche Branchen sich welche Modelle eigneten, könne eine gesetzlich verpflichtende Demokratisierung angedacht werden. Die Zeit sei reif dafür, das auszuprobieren, glaubt Herzog.
„Die Rettung der Arbeit“ ist eine stimmige philosophische Komposition, von der konkreten arbeitsweltlichen Praxis aber noch weit entfernt. Der Hebel fehlt, die Vision eines Startknopfs, um die gedanklichen Anstöße Realität werden zu lassen. Dennoch ist die insgesamt kurzweilige Lektüre des Essays keine vergebene Liebesmüh. Denn er skizziert eine Denkrichtung, der es sich durchaus zu folgen lohnt – nicht sofort mit der großen Revolution, aber in kleinen Schritten und – vor allem – dem Mut, etwas zu wagen.
Die Thesen zur Zukunft lassen sich bestens als Diskussionsvorlage im eigenen Arbeitskosmos nutzen, dafür sind sie keineswegs zu abgehoben. Denn eine Vision zu entwickeln, wie wir alle Arbeit definieren und sie heute wie in Zukunft leben möchten, sollte nicht Philosophie und Soziologie vorbehalten bleiben.