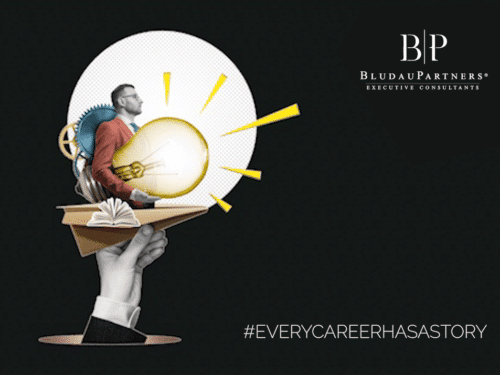Als das virtuelle Gespräch mit Raúl Aguayo-Krauthausen stattfindet, ist er gerade mitten in seiner Meet-Time – also in dem Zeitraum, in dem er sämtliche Meetings absolviert. Denn der Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit teilt seinen Arbeitstag in drei Abschnitte: Me-Time, Meet-Time und Make-Time. Zur Me-Time zählen aufwachen, frühstücken und Kaffeetrinken. Dann checkt er seine E-Mails. Die Meet-Time mit Videocalls und Team-Besprechungen geht von 11:00 bis 14:00 Uhr. Danach folgt bis 18:00 Uhr die Make-Time – die Zeit, in der er Aufgaben abarbeitet, die meist aus den vorherigen Meetings resultieren. Während der Make-Time ist Aguayo-Krauthausen in der Regel für andere weder anzutreffen noch verfügbar.
Wenn Medien über den 42-Jährigen und sein Team berichten, wollen sie oftmals vor Ort Bilder- oder Videoaufnahmen anfertigen, um die aktivistische Arbeit möglichst lebendig darzustellen. „Das Tragische ist“, setzt Raúl Aguayo-Krauthausen an: „Am Ende sind wir auch nur Leute, die am Laptop sitzen.“ Sein Engagement und den Aktivismus in Bilder zu fassen, sei kaum möglich. Durch die sozialen Medien, Blogs, Podcasts, Newsletter und Bücher gewährt Aguayo-Krauthausen Einblick in sein Leben mit einer Behinderung und setzt sich für eine inklusive Gesellschaft ein. Ein Anliegen ist der unverkrampfte Umgang mit Menschen mit Behinderung. Darüber und über persönliche Erlebnisse schreibt er in seiner Biografie Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Das Leben aus der Rollstuhlperspektive. In dem Podcast und gleichnamigen Buch Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus spricht er gemeinsam mit Politikwissenschaftler Benjamin Schwarz mit aktivistischen Persönlichkeiten.
Für Medien und deren Zusammenspiel mit der Politik hat sich Aguayo-Krauthausen schon zu Schulzeiten interessiert. Neben dem Abitur brachte er sich Webdesign bei, machte unterschiedliche Praktika und lernte so die Grundlagen von Werbearbeit kennen. Er absolvierte ein Studium der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin. Später folgte noch ein Design-Thinking-Studium an der HPI School of Design Thinking in Potsdam. Zum Berufseinstieg arbeitete er mehrere Jahre in Werbeagenturen – bis er zum Radio Berlin Brandenburg wechselte und dort als Programmmanager in der Onlineredaktion des Jugendradios It’s Fritz anfing. „Es war eine spannende Erfahrung, die Welt mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten“, sagt Aguayo-Krauthausen. Seine Tätigkeit beim Rundfunk war ähnlich wie zuvor in der Werbung – nur, dass er jetzt auf Kundenseite saß und mit Agenturen zusammenarbeitete. In einer Werbeagentur gehe es oft darum, aus wenig Inhalt etwas Großes zu machen. „Was hat eine Marke schon zu erzählen, außer ‚Kauf mich‘!?“, sagt er. Beim Radio sei das Problem genau andersrum gewesen: Es gibt den ganzen Inhalt, aber seinerzeit gab es noch keine Form, diesen im Internet zu spielen.
Ohne Ausreden zum Heldentum
Seinen Job beim Radio hat Aguayo-Krauthausen mittlerweile hinter sich gelassen. Sein soziales Engagement fand zunächst neben dem Beruf statt. Längst setzt er sich Vollzeit mit seiner Organisation Sozialheld*innen für Inklusion und Barrierefreiheit ein. Die Gründung erfolgte gemeinsam mit seinem Cousin Jan Mörsch im Jahr 2003 – damals noch als Aktionsgruppe, die sich in der Nachbarschaft engagierte. Schon als Teenager haben Aguayo-Krauthausen und sein Cousin viel Zeit zusammen verbracht. Ihnen war klar, dass sie auch im Erwachsenenalter etwas gemeinsam machen und zusammenarbeiten möchten. Ein Start-up hatten sie ausgeschlossen, seine Optionen hielt er für begrenzt. Es sollte lieber etwas Soziales sein. Zwar hätten sie sich anstelle einer eigenen Initiative auch für Greenpeace oder Amnesty International engagieren können. Aber das habe sich nicht authentisch angefühlt – ihr Wissen über Umweltschutz oder andere Völker und Kulturen war einfach zu gering. „Worüber wissen wir denn etwas?“, lautete die große Frage. Die Antwort: über das Leben mit Behinderung. „Dazu konnte ich mich äußern – und mein Cousin als Nahestehender eines Menschen mit Behinderung ebenso“, sagt Aguayo-Krauthausen. Ihnen war wichtig, zunächst vor der eigenen Haustür zu schauen, was man tun könnte und müsste – bevor sie das Thema groß angehen. „Wir nannten uns völlig größenwahnsinnig ‚Sozialhelden‘“, erinnert er sich. Das sei anfangs eher naiv und als Spaß gedacht gewesen. Die beiden Cousins fanden den Kontrast zwischen sozial und Held interessant.
Was einen Heldenstatus für Menschen genau ausmacht, dazu haben sie Menschen auf der Straße sowie im Freundes- und Bekanntenkreis befragt. Das Ergebnis: Vorrangig wurden Berufsgruppen wie Profifußball oder Bundeswehr genannt. Menschen, die sich für andere engagieren, kamen nicht vor. Sie bezogen bei der Begriffsdefinition auch die Heldenforschung mit ein – unter anderem die des Wissenschaftlers Philip George Zimbardo. Der US-amerikanische Sozialpsychologe wurde in den siebziger Jahren durch ein umstrittenes Gefängnisexperiment bekannt. Seine Forschungen befassen sich damit, wie stark soziale Kontexte die Handlungen beeinflussen. Der Theorie zufolge steckt in allen Menschen das Potenzial, böse zu sein, wenn äußere Rahmenbedingungen dies legitimieren. Der Wissenschaftler befasste sich ebenso damit, ob sich dieser Sachverhalt umkehren ließe: Können Personen durch äußere Rahmenbedingungen auch zu guten Menschen werden?
Die zentrale Erkenntnis, die Aguayo-Krauthausen daraus zieht: „Helden haben keine Ausreden.“ Gemeint ist damit, wenn sich jemand mit einer Ausrede selbst betrügt und nicht handelt, ist das zwar in Ordnung, aber es wird auch eine Chance verspielt, etwas zu bewegen. „Es ist immer leicht zu sagen: Das sollte jemand anderes machen oder ‚die da oben‘ machen sowieso, was sie wollen. Schwieriger ist es, sich selbst zu fragen, was ich tun kann“, sagt der Berliner.
Das erste Projekt der Sozialheld*innen war eine Wheelmap, eine Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte. Aguayo-Krauthausen und sein Cousin haben damit eine Art Google Maps für Menschen im Rollstuhl gebaut, die ihre Nachbarschaft hinsichtlich Zugänglichkeit bewerten können. Damit seien sie weltweit das erste Projekt zu diesem Thema gewesen. Anfangs haben Aguayo-Krauthausen und sein Cousin zusammen mit ein paar Leuten aus dem Freundeskreis an sozialen Projekten gearbeitet. Heute sind rund 30 Menschen in der Organisation tätig. Neben der Pflege und Weiterentwicklung der Wheelmap beraten sie Unternehmen in Bezug auf Diversität, Barrierefreiheit und Inklusion und betreiben das eigene Nachrichtenmagazin Die neue Norm. Bei allem geht es stets um das Thema Behinderung mit Blick auf Mobilität, Arbeit, Bildung und Medien.

Als Aktivist macht Raúl Aguayo-Krauthausen nie wirklich Feierabend, zumal ihm sein Smartphone immer Zugang zu E-Mails und Arbeit ermöglicht. Um nach Büroschluss abzuschalten, verbringt er gerne Zeit an der frischen Luft.
Außen vor beim Thema Diversity
Als das Wort „Grenzen“ fällt, zuckt Aguayo-Krauthausen zusammen. Für ihn hat der Begriff fast ausschließlich eine negative Bedeutung. Er bezieht das vor allem auf geografische Grenzen, die oft mit Flucht und der grausamen Behandlung von Menschen in Zusammenhang stehen. Gerade beim Thema Behinderung hält er das Wort „Grenzen“ häufig für euphemistisch oder inflationär benutzt. Euphemistisch, weil schnell gesagt wird: „Jede Person kann ihre Grenzen überwinden, wenn sie nur genug an sich glaubt.“ Gleichzeitig inflationär, weil Menschen mit Behinderung oft hörten: „Das geht nicht, weil …“ So werden oftmals Grenzen auferlegt, die gar keine sind. Stattdessen scheint es nur für Menschen ohne Behinderung nicht vorstellbar zu sein, dass es doch funktionieren kann.
Als Aguayo-Krauthausen beispielsweise in der neunten Klasse das Berufsinformationszentrum der Bundesagentur für Arbeit besucht, legt ihm der Berufsberater nahe, dass er doch in einer Behindertenwerkstatt arbeiten könnte. Seine Mutter sagte daraufhin zu ihm, er solle sich auf keinen Fall eine Werkstatt einreden lassen. Ohne diesen Ratschlag hätte er der Berufsempfehlung einfach geglaubt, meint Aguayo-Krauthausen heute. Der Berufsberater konnte sich offenbar nicht vorstellen, dass für Menschen mit Behinderung auch Optionen neben einer Werkstatt bestehen. Der Jugendliche fragte sich damals: Warum wird den Klassenkameradinnen und Mitschülern nicht auch die Werkstatt empfohlen? Wieso darf ich mir nicht auch Studiengänge wie alle anderen anschauen? Dass sich die Situation im Laufe der Jahre verbessert hat, kann er nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil: Seine Erfahrungen und sein Austausch mit Betroffenen zeigen, dass viele Menschen mit Behinderung schon mal den Ratschlag gehört haben, in einer Werkstatt zu arbeiten. Er wünscht sich, nicht mehr gegen solche Vorbehalte ankämpfen zu müssen. „Menschen mit Behinderung müssen für ihr Recht kämpfen, wie es Menschen ohne Behinderung nie mussten.“ Dieser Satz bezieht sich auf das Recht auf Bildung und Arbeit.
In der Arbeitswelt sieht Aguayo-Krauthausen wenig Entwicklung im Hinblick auf Inklusion. „Wenn wir über HR und Unternehmen sprechen, wo der Begriff ‚Diversity‘ inflationär verwendet wird, ist es auffällig, dass die Dimension Behinderung unter dem Vielfaltsaspekt als letzte oder gar nicht vorkommt“, sagt er. Gleichstellungsbeauftragte würden sich oft verstärkt mit Gendergerechtigkeit befassen, aber kaum mit Migration, Klassismus oder Behinderung. Dabei machen Menschen mit Behinderung knapp zehn Prozent unserer Gesellschaft aus. Er selbst habe früher viel Glück gehabt, weil er in einer Branche arbeitete, in der Arbeitsstätten meist in modernen Gebäuden mit Aufzügen waren. Dennoch war Aguayo-Krauthausen meist der erste Mensch mit Behinderung im Betrieb. Wer als Arbeitgeber sagt, dass sich niemand mit Behinderung bewirbt, hat sich dem 42-Jährigen zufolge nie richtig mit dem Thema befasst. „Viele Unternehmen machen sich nicht die Arbeit, sich zu fragen, warum sie keine Bewerbungen erhalten und zu überprüfen, wo sie eigentlich suchen“, sagt der Aktivist.
Für echte Inklusion im Betrieb gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Aguayo-Krauthausen zählt dazu unter anderem gute Formulierungen in Stellenausschreibungen. Die Floskel „Menschen mit Behinderung bei gleicher Eignung bevorzugt“ reiche inzwischen nicht mehr. Seine Begründung: Die Unternehmen sagen es nur, weil sie es müssen – leben es aber nicht. Besser sei ein authentischer Umgang mit dem Thema Behinderung im Betrieb und bei Bewerbungen. Er nennt Beispielformulierungen zur Kommunikation in Jobangeboten: „Uns ist bewusst, dass unser Bewerbungsprozess Barrieren enthalten kann. Wenn das Bewerbungsverfahren für Sie eine Barriere darstellt, können Sie sich auch auf jedem anderen Weg bei uns bewerben.“ Ihm geht es vor allem darum, dass Arbeitgeber Offenheit für neue und andere Wege im Bewerbungsverfahren zeigen. Denn viele Menschen mit Behinderungen scheitern schon am Karriereportal beim Hochladen einer PDF-Datei, weil es nicht barrierefrei ist. Als weiteren Ansatz führt er Jobcarving an. Der Ansatz dahinter: Anstatt die perfekte Person für einen Job zu finden, geht es darum, wie man eine Position um eine Person herum gestalten kann. Nach dem Motto: Sag uns mal, was Du gut kannst und was weniger – und wir schauen im Betrieb, ob sich die Aufgaben umverteilen lassen. Außerdem rät er Unternehmen, die es wirklich ernst meinen, aktiv nach Menschen mit Behinderung zu suchen – beispielsweise bei Berufsbildungswerken – und diese auch einfach mal zu besuchen.
Eine Eigenschaft von vielen
Große Barrieren erlebt der Berliner Aktivist nach wie vor im Bereich der Mobilität. Wenn Aguayo-Krauthausen mit der Bahn fahren will, muss er seine Reisen immer zwei Tage vorher anmelden beziehungsweise die Mobilitätshilfe beantragen. Die Verkehrswende und auch das Neun-Euro-Ticket lässt die Züge zunehmend voller werden. Aber es gebe nicht mehr Rollstuhlplätze in den Zügen. Er fragt sich, wessen Mobilität eigentlich gefördert werden soll und wessen eher vergessen wird. Kürzlich war es auch eine Verkehrssituation, die ihn wochenlang einschränkte. Durch einen Unfall mit einem Auto wurde sein Bein mehrfach gebrochen. Was sich viele vielleicht nicht vorstellen können: Wer zu Fuß unterwegs ist und sich ein Bein bricht, kann immer noch sitzen. Für Menschen im Rollstuhl bedeutet ein Beinbruch in erster Linie: liegen. So hütete Aguayo-Krauthausen etwa drei Wochen das Bett – eine Einschränkung, die nicht seinem lebhaften Naturell entspricht. Mit Netflix-Serien wie Stranger Things hat er die Zeit überbrückt.
Raúl Aguayo-Krauthausen ist mit seiner Behinderung aufgewachsen, habe sie nie als etwas Negatives empfunden, das nicht zu ihm gehöre. Er sieht sie als eine Eigenschaft von vielen, aber nicht als die prägende oder beherrschende. Es sind die Barrieren in einer nicht-inklusiven Gesellschaft, die er kritisiert und gegen die er ankämpft. Was tatsächlich etwas verändern kann – davon ist er überzeugt – sind Begegnungen zwischen Menschen: mit und ohne Behinderung. Denn echte Aufklärung findet meistens im direkten Miteinander statt.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Grenzen. Das Heft können Sie hier bestellen.