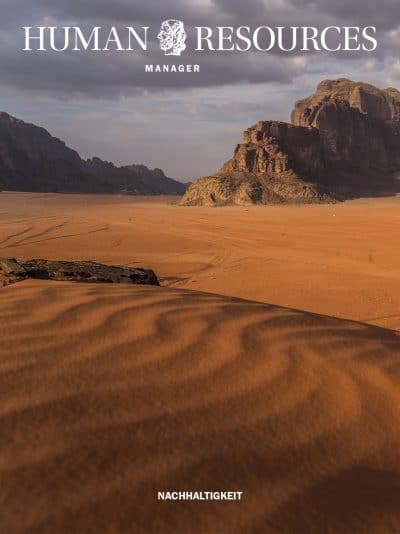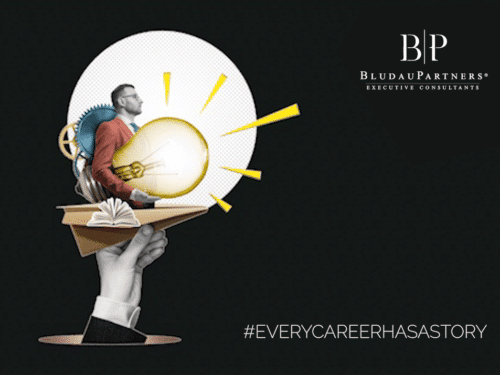Nachhaltigkeit ist en vogue. Trotzdem hält der Neurobiologe Gerald Hüther Nachhaltigkeitsmanager für überflüssig. Ein Interview.
Herr Hüther, der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist en vogue, jedoch unscharf definiert. Somit ist gewissermaßen auch der Titel „Nachhaltigkeitsmanager“ wenig konkret, oder?
Allerdings! Er bedeutet nichts weiter, als dass man dafür sorgt, dass etwas so bleiben kann, wie es ist. Einem Waffenproduzenten ist auch daran gelegen, nachhaltig zu produzieren. Es ist ein irreführender Begriff, weil er von jedem benutzt werden kann als Rechtfertigung für sein gegenwärtiges und künftiges Tun. Dem Begriff fehlt sozusagen die inhaltliche Komponente, die deutlich macht, dass es um die Nachhaltigkeit menschlicher Existenz auf diesem Planeten geht und ums Überleben und um die Fähigkeit, unsere Potenziale zu entfalten im Einklang mit der Vielfalt des Lebendigen.
Wie sollten wir Nachhaltigkeitsmanager stattdessen nennen?
Es müsste ein Wort oder eine Umschreibung sein, die auch die Herzen der Menschen berührt. Ich würde sagen, es geht dabei um einen liebevollen Umgang mit uns selbst und mit unserem Planeten. Stellen Sie sich nun einmal vor, ein Nachhaltigkeitsmanager müsste sich selbst so umschreiben! Das wäre plötzlich eine ganz andere Aufgabenstellung, als die Dinge so zu managen, dass das Geschäft so weitergehen kann wie bislang.
Wie kann die Nachhaltigkeit, die Sie meinen, Teil einer Unternehmenskultur werden?
Die Nachhaltigkeit, von der ich spreche, entsteht automatisch, wenn Menschen sich in ihrem Zusammenleben wohlfühlen. Das sind dann sogenannte Potenzialentfaltungsgemeinschaften. Sie sind immer nachhaltig, denn man kann sein Potenzial nicht auf Kosten anderer Lebewesen entfalten.
Mit dem Organisationsberater Sebastian Purps-Pardigol haben Sie sich vor Jahren auf die Suche nach solchen Unternehmenskulturen begeben. Was haben Sie bei Firmen wie dm, Weleda, Phoenix Contact oder Eckes-Granini beobachten können?
Wir konnten miterleben, wie eine Kultur des Miteinander funktioniert. Es geht dabei nicht um ein funktionales Miteinander, sondern darum, dass die Menschen anfangen, sich gegenseitig zu mögen – sie tun alles dafür, um sich zu unterstützen. Diese neue Art des Umgangs verändert die Menschen von innen. Sie fangen an, sich selbst zu mögen. Und wenn sie das tun, passen sie auch mehr auf, dass sie die Natur und die Lebensräume dieser Erde nicht weiter zerstören.
Die junge Generation scheint dafür sensibilisierter zu sein als ältere Semester.
Wir erleben im Augenblick eine heftige Transformation und die meisten Menschen sind sich nicht darüber bewusst, wie tiefgreifend sie ist. Das, was Menschen für bedeutsam halten, hat sich dramatisch verschoben. Der alten Generation, also der Nachkriegsgeneration und ihren Kindern, war es wichtig, ein Häuschen zu bauen, Geld und Besitz anzuhäufen, sich tolle Reisen zu gönnen. Geldverdienen ist ihnen sehr wichtig und sie haben alles dafür getan, um immer mehr zu verdienen. Wenn man dann aber genug angehäuft hat, realisiert man, was man währenddessen alles vernachlässigt hat. Nämlich das Wohl unseres Planeten.
Die junge Generation achtet bei der Berufswahl mittlerweile stark auf die Nachhaltigkeit des Arbeitgebers. Sie ist ihr mitunter wichtiger als das Gehalt oder ein sicherer Arbeitsplatz.
Ihnen sind Besitz, Konsum, Reisen und die Anhängerschaft in Parteien vollkommen schnuppe. Sie wollen ihrem Leben Sinn verleihen und wollen eine Welt für ihre Kinder, in der sie gut groß werden können. Deshalb wollen sie für Unternehmen arbeiten, von denen sie überzeugt sind, dass sie etwas Gutes für diese Welt tun. Sie haben eine ganz andere Vorstellung davon, was Arbeit ist. Das ist eine ganz wunderbare Entwicklung.
Und wie geht es den Unternehmen?
Sie stellen fest, dass die Arbeitsabläufe durch die Digitalisierung derart komplex sind, dass sie Mitarbeiter brauchen, die man nicht durch Belohnung oder Strafe dazu bringt, dass sie ihre Pflicht erfüllen. Es wird immer wichtiger, dass die Mitarbeiter Freude an dem haben, was sie tun, dass sie sich einbringen können. Solche Mitarbeiter bekommen Unternehmen aber nur, wenn sie eine Kultur haben, die diese Menschen anzieht.
Was genau haben die „Unternehmen des Gelingens“, wie Sie sie auf Ihrer Website nennen, getan, um so zu werden?
Dieser Wandel gestaltet sich in jedem Unternehmen anders. Sie eint jedoch, dass die Hierarchien verändert oder aufgelöst wurden. Momentan entsteht genau das, was bereits das Erfolgsmodell der Primaten war: Die Herausbildung individualisierter Gemeinschaften. Das heißt, wenn jemand eine gute Erfindung oder Entdeckung macht, können sie alle anderen nutzen – jeder Einzelne ist Kulturträger. Das geht bei Bienenschwärmen oder Herden nicht. Dazu braucht man ein etwas größeres Gehirn. Der Mensch hat diese individualisierten Gemeinschaften innerhalb der vergangenen 10.000 Jahren zunehmend ersetzt durch hierarchische Strukturen.
Warum hat der Mensch das getan?
Die Hierarchie ist ein kohärenzstiftendes Organisationsprinzip. Sie schafft eine Einheit. Kohärenz hält eine Gesellschaft so zusammen, dass nicht alles durcheinanderläuft und jeder macht, was er will, denn dabei wird Energie vergeudet. Doch unsere Welt ist zu komplex geworden, als dass diese Struktur noch für Ordnung sorgen könnte. Hierarchien lösen sich auf. Das macht aber niemand absichtlich, es geschieht einfach. Das wiederum verunsichert die Menschen, weil sie flache Hierarchien nicht kennen. Also rufen sie dann doch nach jemanden, der die Verantwortung übernehmen soll.
Start-ups haben damit bekanntermaßen weniger Probleme.
Die jüngere Generation ist leichter in der Lage, sich neu zu organisieren. An den Start-ups sieht man, wie gemeinschaftliche Unternehmungen ohne Hierarchie funktionieren. Sie bilden Gemeinschaften, in denen jeder die Führung für Dinge übernimmt, mit denen er sich am besten auskennt.
Wenn man den Mitarbeitern von Großunternehmen die Chefs wegnimmt, was passiert dann?
Wenn der Anführer weg ist, braucht man etwas, das Orientierung bietet, das einem sagt, wie das Zusammenleben gestaltet werden sollen – wie eine Art innerer Kompass. Das ist das gemeinsame Anliegen. Es muss jedem Mitarbeiter gleichermaßen am Herzen liegen, denn dann ordnet sich die Gemeinschaft in eine Potenzialentfaltungsgemeinschaft. Es geht nicht darum, alles abzuschaffen, sondern dass Führungskräfte ab jetzt ihre Hauptaufgabe darin sehen, sich selbst als Führungskraft unnötig zu machen, indem sie die Mitarbeiter inspirieren, sich selbst um das zu kümmern, was sie gemeinsam erreichen wollen.
Gibt es bereits Unternehmen jenseits der Start-ups, die es so machen?
Die Hotelkette Upstalsboom hat beispielsweise ein gemeinsames Anliegen gefunden, das im Film „Die stille Revolution“ gezeigt wird. Dort wird ein Zimmermädchen gefragt, warum sie dort arbeitet. Sie antwortet, früher habe sie wegen des Geldes die Betten gemacht, heute treibe sie an, dass mit dem Gewinn der Hotelkette eine weitere Schule in Ruanda gebaut werden könne. Das ist ein gemeinsames Anliegen. So etwas haben im Moment jedoch nur sehr wenige Unternehmen.
Es steht also schlecht um diese Idee?
Die meisten Unternehmen wollen Geld verdienen und oft verfolgt dann jede Abteilung ein anderes Anliegen. Das gilt auch für die Nachhaltigkeitsorganisationen. Jede von ihnen findet etwas anderes wichtig und sie bekämpfen einander. Nehmen wir die Klimakonferenz, zu der ständig ein paar Tausend Menschen irgendwo hingeflogen werden, um am Ende unverrichteter Dinge wieder zurückzufliegen. Da fragt man sich doch, ob die noch alle Tassen im Schrank haben?
Was halten Sie davon, wenn Unternehmen einen Nachhaltigkeitsmanager einstellen?
Die Vorstellung, man könne solche Prozesse managen, stammt aus dem vorherigen Jahrhundert. Man kann nämlich nur Rahmenbedingungen schaffen, dass sich Prozesse so ereignen, wie man das möchte. Manager ist dafür die schlechteste Bezeichnung, die man überhaupt haben kann. Sie weckt die Illusion, eine Person könne Nachhaltigkeit managen und dadurch herstellen.
Hat ein Nachhaltigkeitsmanager also gar keine Handhabe?
Das kommt darauf an, womit er ausgestattet wird. Nachhaltiges Verhalten erreicht man nicht mit Ratschlägen und Belehrungen. Das ist eine Vorstellung aus der Zeit der Aufklärung, als wir dachten, wir könnten nur mit dem Verstand die Probleme dieser Welt lösen. Investmentbanker, Kriegstreiber, Alleinherrscher – sie alle benutzen ihren Verstand. Man braucht also für eine Aufklärung des Menschen neben dem Verstand die Menschlichkeit.
Was können wir also tun?
Ich denke, mit den Managementversuchen – der Diversity-Beauftragte ist auch so ein Fall – wird nur verhindert, dass wir uns an die Dinge herantrauen, die wirklich wesentlich sind. Wir sollten uns fragen: Wie gehen wir miteinander um? Das kann man doch nicht managen. Je mehr man es versucht, umso mehr gerät man in die Mühle des Machbarkeitswahns. Dann wird noch eine Stelle geschaffen und dann noch eine – es entstehen hohe Kosten und am Ende sind die Erfolge gering. Weil die Menschen, die auf diesen Positionen sitzen, aber auch für kleine Verbesserungen sorgen, glauben alle, es sei wichtig, dass es sie gibt. Niemand kommt darauf, dass die entscheidenden Dinge gerade deshalb nicht zustande kommen, weil es diese Beauftragten gibt.
Woran liegt das?
Wenn man Menschen dabei unterstützt, irgendetwas zu erreichen, und Ihnen sagt, was sie dafür tun sollen, hindert man sie daran, selbst die Verantwortung zu übernehmen. Nehmen wir das Beispiel Mülltrennung in Unternehmen: Geht es darum, dass der Müll getrennt wird? Oder sollte es nicht vielmehr darum gehen, dass sich jeder fragt, ob er diesen Müll überhaupt in dieser Weise produzieren muss? Es wäre besser, einander zu helfen, Müll gänzlich zu vermeiden. Dafür braucht man keinen Nachhaltigkeitsmanager, sondern eine andere Art des Umgangs mit sich und mit anderen. Solange Menschen mit sich unzufrieden sind und sich am Außen orientieren, werden sie nicht nachhaltig handeln können. Das sind dann Bedürftige, die immer irgendetwas brauchen.
Was wären also die nächsten Schritte im Sinne einer Nachhaltigkeit?
Ich würde die Mitarbeiter fragen, was sie sich wünschen, wofür das Unternehmen da sein soll.
Diesen Appell haben Sie oft in Interviews formuliert. Gibt es eine Frage, Herr Hüther, die Ihnen noch nie jemand gestellt hat?
Ja, es ist eine Frage, die ich mir selbst ständig stelle: Wie ist es möglich, dass Menschen aufhören, so lieblos miteinander umzugehen?
Kennen Sie die Antwort?
Nein, ich weiß nur, dass wir so nicht auf die Welt kommen. Offenbar tun wir uns das unterwegs an. Und das ist das Anliegen meiner eigenen Arbeit: Ich versuche den Menschen zu helfen, sich davon zu befreien, Objekte von Erwartungen und Belehrungen zu sein. Nur so können sie ihr brachliegendes Potenzial wieder entfalten.
Zur Person: Gerald Hüther zählt zu den bekanntesten Hirnforschern Deutschlands. Er ist Vorstand der Akademie für Potentialentfaltung, Autor und Redner. Hüther studierte Biologie, wurde in Leipzig promoviert und habilitierte sich im Fachbereich Medizin. Der 68-Jährige ist Autor zahlreicher populärwissenschaftlicher Publikationen. Zuletzt erschien von ihm „Würde. Was uns stark macht – als Einzelne und als Gesellschaft“.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Nachhaltigkeit. Das Heft können Sie hier bestellen.