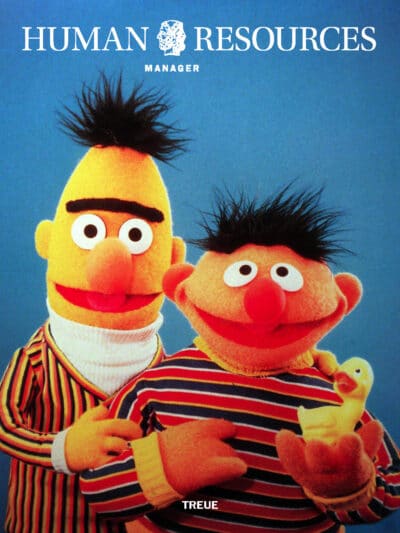Eines nachts sitzt Martin Porwoll allein in den Räumen der Alten Apotheke in Bottrop und vergleicht heimlich Zahlen in einer Excel-Tabelle. Er zählt zusammen, wie viel Milligramm eines Krebsmedikaments die Apotheke eingekauft hat. Dann geht er alle Rezepte durch und summiert die von den Ärzten verschriebene Menge auf. Und sein Verdacht bestätigt sich: Die eingekaufte Wirkstoffmenge ist viel geringer als das, was laut Rezeptlage in den Chemotherapien gelandet ist. Die Infusionen, die der Chef der Alten Apotheke, Peter Stadtmann höchstpersönlich – meist morgens allein im Labor – für seine Krebspatienten zusammengemischt hat, waren gepanscht oder gar vollkommen ohne Wirkstoff. Tausende Krebskranke in sechs Bundesländern – sie werden betrogen. Doch Martin Porwoll kann zu diesem Zeitpunkt nichts verraten, er muss schweigen und weitere Beweise sammeln.
Das war im Januar 2016. Die Rezepte sind eigentlich das Heiligtum einer Apotheke, die Währung der Pharmazie. Dass Porwoll damals überhaupt auf die sensiblen Daten zugreifen kann, hat er sich als kaufmännischer Leiter, Personaler und EDV-Beauftragter hart erarbeitet. Sein Chef scheint sich sicher zu fühlen. Dabei verbirgt sich hinter den Zahlen buchstäblich kalkulierte Grausamkeit. Eigentlich hätte der Bottroper Apotheker Peter Stadtmann, ein gefeierter Gönner der Stadt, bangen müssen, dass ihm jemand auf die Schliche kommt.
Heute sitzt er im Gefängnis, noch immer hat er sich nicht zu seinen Taten geäußert. Das Urteil: Zwölf Jahre Haft, 17 Millionen Euro Geldstrafe und lebenslanges Berufsverbot wegen eines schweren Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz in 14.500 Fällen. Die Schadenssumme der Krankenkassen durch die gefälschten Abrechnungen laut Staatsanwaltschaft: 56 Millionen Euro. Es wurde einer der größten Medizinskandale der vergangenen Jahrzehnte. Die Familien der in diesem Zusammenhang an Krebs Verstorbenen quält die Frage: Könnten ihre Angehörigen noch leben?
Das Medienecho
Als der Betrug ans Licht kam, erfuhren Peter Stadtmanns Opfer davon aus den Medien. Medikamentenlisten wurden teilweise veröffentlicht, doch die Gesundheitsbehörden informierten die Betroffenen nicht von sich aus, es herrschte Unsicherheit. Also organisierten die Menschen Protestzüge. Die Hauptforderung: mehr und bessere Kontrollen in den sogenannten Zytostatika-Apotheken. Von denen gibt es nur 200 in Deutschland. Heike Benedetti, eine Brustkrebspatientin, wird zum Gesicht der Betroffenen in den Medien. Sie gehört einer Gruppe von Frauen an, die sich durch die Chemotherapie kennengelernt haben. Sie nennen sich die Onko-Mädels, wollten alles gemeinsam durchstehen – und wunderten sich, warum bei einigen durch die Infusionen die Haare nicht ausfielen, sie keinerlei Nebenwirkungen zeigten. So erzählen sie es in den zahlreichen Dokumentationen über den Fall. Als der Skandal öffentlich wurde, war ihnen plötzlich klar: Diejenigen, die ihre Haare behielten, hatten wohl das gepanschte Mittel erhalten – wo keine Wirkung, da auch keine Nebenwirkung. Fünf der zehn Frauen sind mittlerweile gestorben. Eine Studie aus dem Jahr 2021 ergab schließlich, dass die Patientinnen und Patienten der Bottroper Apotheke ein Drittel mehr Chemo bekamen als die Kontrollgruppe einer anderen Apotheke. Die Ärzte hatten also immer mehr verschrieben, weil die Chemo nicht richtig anzuschlagen schien. Das Geld für die gefälschten Dosen floss in die Taschen von Peter Stadtmann. Er residierte damals in einer Luxusvilla für elf Millionen Euro. Vom Bad aus konnte er über eine Wasserrutsche direkt in den Pool schlittern. Es gab viel Platz für ihn und seinen Hund, ganze 700 Quadratmeter.
Seinen Hund nahm er auch gern mit in den Reinraum des Sterillabors der Apotheke, in der damals rund 80 bis 90 Menschen arbeiteten. Während die Labormitarbeiter wie Astronauten aussahen und die Medikamente unter strengsten Hygienevorschriften dosierten, ging Stadtmann in Straßenkleidung ein und aus. Teflon-Anzug, nannten die Kolleginnen und Kollegen seine Garderobe, sicherlich einigermaßen verzweifelt. „Galgenhumor ist in so einer Ohnmachtslage manchmal das Einzige, was einen über Wasser hält“, kommentiert Martin Porwoll. Er kannte die Gerüchte, hörte die zynischen Bemerkungen. Er war auch für alle Personalbelange zuständig – und die Leute vertrauten sich ihm an, vor allem jene, die kündigten. Zu diesem Zeitpunkt waren das jedoch alles noch unbewiesene Behauptungen. Gerüchte. Doch die Fluktuation, sie war schon einigermaßen hoch, als Porwoll 2014 bei Stadtmann anheuerte – zwei Jahre vor seiner nächtlichen Excel-Rechnung. Sie kannten einander bereits seit Kindheitstagen, sie hatten auf der gleichen Schule Abitur gemacht. Die Familien waren eng verbunden. Freundschaft könne man das nicht nennen, sagt Porwoll. Eher ziemlich gute Bekannte.
Das Verbrechen hat schließlich im Winter 2016 ein Ende, weil Martin Porwoll im Verborgenen gegen seinen Chef ermittelt und ihn dann angezeigt hatte. Der 51-Jährige ist ein Whistleblower, wird zum Medienstar, zum Helden. 2017 wurden er und eine Kollegin mit dem Whistleblower-Preis der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler ausgezeichnet.
Die Zeit danach
Genutzt hat ihm das bei den Bewerbungsgesprächen nach der fristlosen Kündigung nichts. Unzählige Male wurde er eingeladen, um den Job dann doch nicht zu bekommen. Es wurde nie so ausgesprochen, doch es war für Porwoll deutlich zu spüren: Einen Nestbeschmutzer, den wollten sich andere Unternehmen lieber nicht ins Haus holen. Ein Jahr lang kam er nicht so wirklich auf die Beine. Wie geht es ihm also heute? „Bestens“, sagt er und lacht auf. Er hat nämlich jemanden gefunden, der an ihn glaubt und sich mit ihm vor vier Jahren selbstständig gemacht hat. Heute erstellt er mit dem Arzt Matthias Thöns unabhängige Zweitmeinungen für die Versicherten gesetzlicher Krankenkassen. Und es läuft gut. Das bedeute nicht, dass es anderen Hinweisgebern auch so ginge, räumt er ein und wird ernst. Die meisten verlieren nicht nur ihren Job, ihre ganze Existenz ist bisweilen bedroht: oft allein schon durch die Gerichtskosten. Die Psyche ist enorm belastet durch ein Umfeld, das immer pendelt zwischen den Labeln Held oder Petze. Und dann die Drohungen. „Ich habe eng mit den Medien zusammengearbeitet, das war damals auch ein Schutzreflex“, sagt Porwoll. Wenn ihm jemand also etwas antäte, dann geschehe das nicht unbeachtet, so seine Hoffnung.
Die Psyche in Not
Martin Porwoll entwickelt in den zehn Monaten zwischen seiner Entdeckung bis zur Razzia der Apotheke heftige psychosomatische Symptome: Panikattacken prägen seinen Alltag, oft ruft seine Familie den Notarzt, weil er denkt, er stirbt. Doch er stirbt nicht, er leidet. In der zähen Zeit des Schweigens legt er sich jeden Abend in eine Badewanne mit 40 Grad heißem Wasser, er möchte am liebsten alles abkochen, die ganze Schuld, die ganze Angst. Einmal hat er zufällig eine Alte-Apotheke-Patientin am Telefon, die sagt: „Ich gebe auf, die letzte Chemo schlägt einfach nicht an, sie war meine letzte Hoffnung. Es ist vorbei.“ Doch er kann sie nicht aufklären, ihr nicht sagen, dass da womöglich nur Kochsalz in ihre Adern tröpfelt. Er hat nicht genügend Beweise. Noch nicht.
Er sammelt also weiter Zahlen, überprüft heimlich insgesamt vier Wirkstoffe – es gibt ungefähr 100 –, die in den Infusionen landen, er will sicher sein. „Ich wusste, ich habe nur einen Schuss im Revolver“, sagt er rückblickend. Er zieht einen Anwalt zurate und erstattet schließlich im August 2016 Anzeige bei der Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität. Es soll alles endlich ein Ende haben. Doch es geschieht: nichts. Wochenlang. Dann kommen die Befragungen und die Aufforderung: Wir brauchen so einen gepanschten Infusionsbeutel!
Martin Porwoll vertraut sich einer Kollegin an, der pharmazeutischen Fachangestellten Marie Klein. Er weiß, sie würde fortan die Schwere seines Leids mittragen müssen. Sie hat Zugang zu den Beuteln. Hätte er einen entwendet, wäre das viel zu auffällig gewesen. Irgendwann kommt ein Rückläufer in die Apotheke, darüber wird akribisch Buch geführt, man kann sie nicht einfach entwenden. Marie Klein tut es trotzdem. Sie behauptet später, er sei defekt gewesen. Am 29. November, einen Monat später, ist es so weit. Die Polizei schlägt zu, in der Apotheke in Bottrop, in einer weiteren in Düsseldorf, in der Villa. Peter Stadtmann wird festgenommen. Wenig später werden Martin Porwoll und Marie Klein fristlos entlassen. Porwoll muss sich zwei Stunden lang wie vor einem Tribunal wüsten Beschimpfungen stellen, erzählt er. Die Apotheker-Familie ist enttäuscht, nennt ihn „Drecksau“. Er sagt immer nur einen Satz, geimpft von seinem Anwalt: „Dazu kann ich nichts sagen.“
Die Grenzen des Hinweisgeberschutzgesetzes
Fristlos kündigen können Arbeitgeber Whistleblower dank des novellierten Hinweisgeberschutzgesetzes mittlerweile nicht mehr. Viele Unternehmen sind nun gefragt, Compliance-Management-Systeme mit einer Meldemöglichkeit umzusetzen. „Doch damit eine Organisation in der Lage ist, intern Verstöße aufzudecken, braucht es die entsprechende Kultur“, sagt Arbeitsrechtler Timo Karsten von Osborne Clarke. „Eine Kultur, die auf Integrität und Regeltreue ausgerichtet ist.“ Die kann das Gesetz allein nicht schaffen. Um den Kulturwandel in Firmen, wie ihn das Gesetz verlangt, in Gang zu setzen, müssen Führungskräfte die Sache in die Hand nehmen. Sie profitierten schließlich am meisten davon, sagt Karsten. Ein funktionierendes Meldesystem deckt Verstöße frühzeitig auf und schützt damit das Management vor juristischen Konsequenzen. Was das alles bedeutet, sollte der gesamten Belegschaft in Schulungen erklärt werden. Wer das nicht hinbekommt, riskiert, dass die Leute sich nicht intern melden, sondern externe Stellen kontaktieren. So wie Martin Porwoll.
Ihm hätte solch ein Meldesystem nichts genutzt. „Ich hätte meinen Verdacht niemals intern gemeldet“, sagt er. Im Leben nicht. Man wende sich gegen den eigenen Arbeitgeber, das sei immer brandgefährlich. Den Hinweisgeberinnen und Whistleblowern wäre laut Porwoll viel mehr geholfen, wenn sie in der Phase kurz nach der Veröffentlichung finanzielle, juristische und psychologische Hilfe bekämen. Eines hat ihm die ganze Zeit lang geholfen, das durchzustehen: die Gewissheit, das Richtige zu tun, ganz gleich wie stark die Loyalität zum Arbeitgeber, zur ganzen Apotheker-Familie einst gewesen sein mag. „Die Treue zu den jeweiligen Personen spielte für mich, seitdem der Fall klar war, überhaupt keine Rolle“, sagt Porwoll entschlossen. Es sei schließlich um Menschenleben gegangen.
Weitere inspirierende Menschen im Porträt:
- Raúl Krauthausen: Der Inklusionsaktivist
- Natalya Nepomnyashcha: Die Vorkämpferin
- Die Starthelferin: Irene Aniteye
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Treue. Das Heft können Sie hier bestellen.