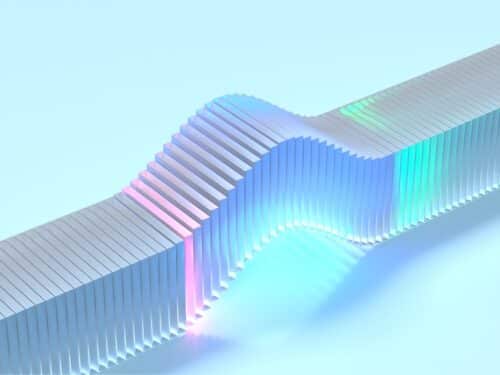Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) ist mehr als nur eine lästige Gesetzesvorgabe. Wie man es umsetzt und was Unternehmen dabei beachten sollten.
Bereits seit 2004 sind Arbeitgeber verpflichtet, länger erkrankten Beschäftigten ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anzubieten. Ein wichtiger Schritt, um die Häufigkeit und Dauer von Arbeitsunfähigkeit langfristig zu senken. Gerade Langzeitarbeitsunfähigkeit, die laut DAK-Gesundheitsreport 2018 knapp 44 Prozent des Krankenstandes ausmachte, beeinflusst schnell die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens. Dazu zählen alle Arbeitnehmer, die mehr als sechs Wochen innerhalb eines Jahres ununterbrochen oder wiederholt fehlen.
Ziel ist es, die Arbeitsunfähigkeit durch BEM zu überwinden und die Wiedereingliederung in den regulären Arbeitsprozess zu erleichtern: Die Beschäftigungsfähigkeit soll durch das Verfahren zukünftig dauerhaft erhalten und der Arbeitsplatz gesichert werden. Darüber hinaus soll BEM die Erwerbsbeteiligung durch die Vermeidung von Frühberentung sichern, eine Gefahr, die durch die stetig älter werdende Erwerbsbevölkerung weiter zunehmen wird.
Damit hat BEM einen klaren präventiven Charakter und beugt einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vor. Die Realität zeigt jedoch, dass zahlreiche Arbeitgeber noch über kein BEM verfügen oder dieses nur unzureichend durchführen. Damit verstoßen sie nicht nur gegen geltendes Recht, sondern schaden gegebenenfalls auch langfristig dem Unternehmenserfolg.
BEM reduziert Ausfallzeiten und stärkt Mitarbeiterbindung
Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert: Beschäftigte arbeiten teilweise bis zur Belastungsgrenze, Fehltage steigen. „Ein gut durchgeführtes BEM ist heutzutage ein entsprechend wichtiges strategisches Instrument der Personalarbeit“, ist Susanne Tiedemann, Regionalleiterin Nord im Fürstenberg Institut, überzeugt. Es verringert nachweislich die Krankheitsdauer, reduziert die krankheitsbedingten Ausfallzeiten und trägt zur Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung bei, so die Aussagen einer Studie der Universität zu Köln zur Umsetzung von BEM im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.
Dies sind entscheidende Kriterien auf dem sich durch Fachkräftemangel und Digitalisierung wandelnden Beschäftigungsmarkt. Die Verkürzung von Langzeiterkrankungen und der Erhalt langfristiger Leitungsfähigkeit steigern folglich die Produktivität, indem mehr Ressourcen und Arbeitskraft in der Organisation zur Verfügung stehen.
Ein verbindliches und allgemeingültiges Konzept, um BEM in einem Betrieb zu implementieren, gibt es nicht. Entsprechend gibt es verschiedene Wege, dieses zu installieren. Der Gesetzgeber hat das BEM als „organisierten Suchprozess“ vorgesehen, um es auf die jeweilige Organisation aufgrund der Größe, Branche etc. anpassen zu können.
Internes BEM: Kooperationsprozess zwischen allen Beteiligten
Sofern BEM intern implementiert wird, wird in größeren Unternehmen in der Regel ein BEM-Team gebildet. Dieses besteht meist aus dem Arbeitgeber, der grundsätzlich in der Verantwortung steht, dem Betriebs- oder Personalrat und der Schwerbehindertenvertretung. Das konkrete Fallmanagement wird oft von Personen aus diesem Kreis übernommen (zum Beispiel von HR oder Betriebs- und Personalräten). Darüber hinaus werden teilweise innerbetriebliche Akteure wie der Betriebsarzt oder auch die Fachkraft für Arbeitssicherheit hinzugezogen.
Das BEM-Team begleitet den gesamten Prozess und steuert und koordiniert die entsprechenden Maßnahmen. Dieses Team verfügt über Entscheidungsbefugnisse und kann Maßnahmen gegebenenfalls schnell und unbürokratisch im Sinne der Beschäftigten umsetzen. Grundsätzlich sollte das BEM ein Kooperationsprozess zwischen allen Beteiligten sein, die sich vorab über die Ziele und Grundsätze zur Zusammenarbeit im BEM-Prozess verständigen und sich vor der Einführung auf ein grundsätzliches Verfahren einigen.
Externes BEM: Rollenkonflikte werden vermieden
Eine weitere Möglichkeit, BEM zu implementieren, besteht darin, dieses als externes Fallmanagement auszulagern. Einer der Vorteile ist die Qualitätssicherung durch externe Berater mit in der Regel hoher psychosozialer Beratungskompetenz sowie Qualifikation im Disability- und Reha-Management. Sie gewährleisten eine schnelle und professionelle Terminvergabe, sorgen für verkürzte Arzt- und Therapeutensuche und bieten gleichzeitige Sucht- und Schuldnerberatung.
Im Gegensatz zu einem internen Fallmanagement werden durch die Auslagerung des Verfahrens belastende Rollenkonflikte der HRler vermieden. „Morgens führe ich ein Abmahnungsgespräch, nachmittags bin ich BEM-Berater“, zahlreiche Personaler fühlen sich hin- und hergerissen, sie erfahren vieles, was in keine Personalakte gehört. „Rollenklarheit durch externes BEM ermöglicht hier eine transparente Auseinandersetzung und Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen“, so Susanne Tiedemann. Durch externes Fallmanagement sind Schweigepflicht und Aktenlage klar geregelt. Es herrscht größere Vertraulichkeit und in der Regel werden bessere Lösungsmöglichkeiten durch fachliche Expertise des Beraters gewährleistet. Darüber hinaus verlaufen externe BEM-Verfahren zügig und binden keine unnötigen Kapazitäten.
Im Mittelpunkt aller Maßnahmen, ob intern oder ausgelagert, sollte immer die Rückkehr des betroffenen, vollständig genesenen Mitarbeiters ins Unternehmen stehen und eine Wiedererkrankung vermieden werden – für mehr Ressourcen und Arbeitskraft in der Organisation und damit Sicherung des Unternehmenserfolgs. „Damit kann jedes Unternehmen von einem gut umgesetzten BEM nur profitieren“, so Susanne Tiedemann abschließend.