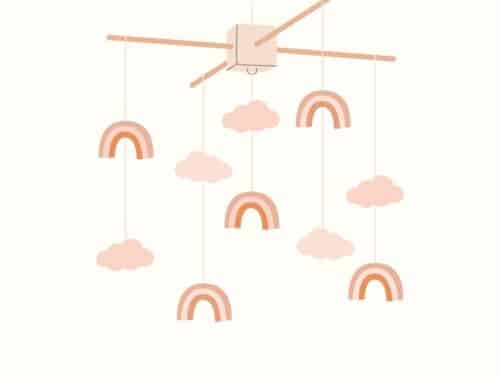Hannah Arendts Konzept der Lohnarbeit, die einzig unser Auskommen sichern soll, gilt vielfach als überholt. Heute setzt sich die Erkenntnis durch, dass derjenige besonders gute Arbeit macht, der leidenschaftlich bei der Sache ist. Warum ist das so?
Eine gute Freundin arbeitet bei einem internationalen Ölkonzern. Sie ist exzellent ausgebildet, sie verdient gut, sie beklagt sich: Der Bürojob im Großkonzern sei ein wahrer Albtraum. Sie träumt: Von sinnstiftender Arbeit, mit der sie sich identifizieren kann. Idealerweise könnte sie sich vorstellen, bei einer Stiftung anzutreten, um Gutes zu tun. Zumindest möchte sie sich nicht mehr jeden Morgen leidenschaftslos ins Büro schleppen, Meetings absitzen, Excel-Tabellen hinklatschen, um abends wieder mit dem Gefühl heimzufahren, nichts Bedeutendes bewegt zu haben.
Diese Freundin empfindet die Arbeitswelt, wie sie schon die politische Philosophin Hannah Arendt vor über 50 Jahren definierte: als Zwang, als Absicherung für das „Am-Leben-Bleiben des Individuums“, wie Arendt in ihrem Hauptwerk „Vom tätigen Leben“ schreibt. Das klingt bedrohlich. Und es erinnert mehr an das Tierreich, wo die Existenzsicherung an erster Stelle steht, als an kreativ denkende Menschen.
Dabei sollte Arbeit heutzutage eigentlich anders sein als zur Schaffenszeit Hannah Arendts Anfang der 60er Jahre. Schließlich deutet immer mehr darauf hin, dass wir das Industriezeitalter hinter uns lassen und auf dem Weg in eine Wissensgesellschaft sind: Maschinen erleichtern Arbeitern die Plackerei in Fabriken, in Minen oder beim Straßenbau. Arbeitgeber setzen sich dafür ein, Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz zu minimieren. Spitzenverdienste erzielen heute nicht nur patriarchale Unternehmer, die ihre Angestellten ausbeuten, sondern auch soziophobe Programmierer, die einzig und allein ihre Tastatur malträtieren.
Auch besagte Freundin weiß, dass sie ihren Job beim großen Konzern kündigen kann. Noch scheint die gute Bezahlung sie zu halten. Aber sie ist sich sicher: Übte sie einen sinnstiftenden Beruf aus, bei dem sie mitwirken und etwas formen kann, wäre sie weitaus leidenschaftlicher dabei. Was tun?
1. Lust auf mehr?
Um Leidenschaft bei Arbeitnehmern zu wecken, ist es wichtig, dass Manager nicht nur Aufgaben delegieren. Sonst schuften ihre Mitarbeiter ihre Arbeit von A nach B, ohne C und D überhaupt zu kennen – und erst recht nicht ABCD, also das große Ganze. Karl Marx nannte das „Entfremdung“, und schon zahlreiche psychologische Experimente haben gezeigt, dass bei von ihrer Arbeit entfremdeten Arbeitnehmern die Passion flöten geht. Das genaue Gegenteil schlagen Psychologen zur Leidenschaftsförderung vor: „Es geht darum, Selbstbestimmung der Arbeitnehmer durch mehr Gestaltungsspielräume bei der Arbeit zu fördern“, sagt Rainer Wieland, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Bergischen Universität Wuppertal. Dann könne sich ein Mensch mit seiner Arbeit besser identifizieren. Das mache Lust auf die Aufgaben und steigere die Leistungsbereitschaft. Laut Wieland kommt es dabei ganz stark auf den Führungsstil von Managern an.
Das belegen auch Beispiele aus der Praxis. So entstand etwa in den 80er Jahren ein neues Produktionsmodell beim schwedischen Autohersteller Volvo, das für Aufsehen sorgte. Anstatt Automechaniker am Fließband mit Einzelaufgaben zu betrauen, schuf der Autohersteller sogenannte „teilautonome Arbeitsgruppen“ in der Belegschaft. Fortan schraubten Arbeiter nicht mehr eigenbrötlerisch Teile an und warteten darauf, bis die nächste Karosserie per Fließband ankam. Sondern sie managten ihre Arbeitsgruppe im Kollektiv. Im Montagewerk Uddevalla waren einzelne Teams für den Bau kompletter Autos zuständig. Kein Manager verteilte die Aufgaben, die Arbeiter organisierten sich in Eigenregie und – Achtung jetzt kommt’s – waren produktiver als Kollegen, die ihre Aufgaben von oben herab diktiert bekamen.
Trotzdem setzte sich das Arbeitsmodell nicht durch, weder in Schweden noch in Deutschland, wo es im Zuge einer vom Staat geförderten Langzeitstudie erprobt wurde. „Das untere und mittlere Management war nicht bereit, Verantwortung abzugeben“, beurteilt Thomas Rigotti, Professor für Arbeitspsychologie an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, das Pionierprojekt. Delegieren ist ein Leidenschaftskiller.
2. Arbeit lieben?
Ja, unbedingt. Denn hier sind sich Arbeitspsychologen einig: Wir arbeiten schlichtweg besser, wenn wir für unsere Arbeit einstehen und einen Sinn in ihr sehen. Das haben bereits viele Experimente belegt: Etwa schickten Psychologen in Amerika zwei Gruppen von Studenten auf Passanten los. Sie sollten Spenden für eine Hilfsorganisation sammeln. Alle Teilnehmer glaubten an den guten Zweck hinter dem Spendensammeln. Doch während die Psychologen der einen Gruppe eine Provision für jeden Spender versprachen, erhielt die zweite Gruppe nichts. Das Gefühl, Gutes zu tun, wurde nicht durch einen monetären Anreiz getrübt. Studenten, die keine Provision erhielten, sammelten deutlich mehr für die Wohlfahrt.
Warum das so ist, erklären Psychologen unisono: Wenn Menschen einen Sinn in ihrer Arbeit sehen, machen sie ihre Aufgaben zu ihrer eigenen Angelegenheit. Geld kann dieses Ansinnen trüben. Sehen Mitarbeiter hingegen einen Sinn, führen sie ihre Tätigkeit nicht mehr einzig für das Wohl des Unternehmens aus. Sie tauschen also nicht mehr ausschließlich ihre freie Zeit gegen Geld ein, sondern sind emotional involviert. Sie wollen ihre Arbeit erledigen, „weil sie selbst durch die Aufgabe vorankommen wollen“, erklärt Hugo Kehr, Professor für Psychologie an der Technischen Universität München. In der Wissenschaft ist das als intrinsische Motivation bekannt, das Bestreben, etwas um seiner selbst willen zu tun.
Dem gegenüber steht die extrinsische Motivation. Das heißt, Ziele zu erreichen, um dafür belohnt zu werden. Zum Beispiel Karrieresprünge, Provisionen oder schöne Urlaube. Diese Motivationsart hat einen Nachteil: „Um extrinsisch motivierte Aufgaben zu erledigen, müssen wir uns durchbeißen“, sagt Kehr. Das strapaziert unsere Willenskraft, lässt oft ein schlechteres Gefühl zurück und ist weitaus erschöpfender, als wenn wir intrinsisch motiviert handeln.
3. New Work?
Wir arbeiten also besser, wenn wir unsere Arbeit wirklich gerne machen. Von solcher Arbeit sprechen auch die Befürworter der New-Work-Bewegung, die auf den Sozialphilosophen Frithjof Bergmann zurückgeht. Sie wollen, dass wir Arbeit verrichten, die wir „wirklich, wirklich gerne machen“. Also das genaue Gegenteil der Lohnarbeit, die wir machen, um im Sinne von Hannah Arendt unser Auskommen zu sichern. New-Work-Befürworter wollen den Weg für Arbeit ebnen, die Freiheit für Kreativität und persönliche Entwicklung schafft.
Auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, einem Land, in dem hart und viel Arbeiten zum guten Ton gehört, wird der Wunsch nach einer neuen Form der Arbeit laut: Die amerikanische Fernsehsendung CBS MoneyWatch stellte kürzlich die Frage, was Menschen bei ihrer Arbeit motiviert. Auf Platz eins des Antwort-Rankings rangierte „eine sinnvolle Tätigkeit auszuführen“, Geld und Ansehen folgten mit einigem Abstand.
Damit New Work möglich wird, müsste sich allerdings erst einmal der klassische Führungsstil von Managern ändern. Zu delegieren und über Köpfe hinweg zu bestimmen, passt eben nicht zu Arbeit, die Spaß macht. Sondern zu Arbeit, die effizient, schnell und kostengünstig erledigt werden muss. Erste Indizien, dass auch Manager diese Führung hinterfragen, gibt eine Studie im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums, über die kürzlich die Wochenzeitung Die Zeit berichtete. Von 400 befragten Managern seien 78 Prozent überzeugt, dass es in Deutschland eine grundlegend andere Führungspraxis braucht. Nur 29 Prozent halten eine auf Effizienz und Profit ausgerichtete Führung für ideal. Sie sind sich einig: „business as usual“ funktioniert nicht mehr.
4. Sinneswandel
Es muss sich also etwas ändern. Und zwar schnell. Denn Mitarbeiter verlieren das Vertrauen in das Unternehmen, für das sie arbeiten. Der Mainzer Professor Rigotti beobachtet einen Wandel, wie Angestellte ihre Arbeitgeber wahrnehmen: „Arbeitnehmer haben heutzutage eine andere Beziehung zu ihrem Arbeitgeber als früher.“ Laut dem Wissenschaftler lassen affektive Bindungen zum Unternehmen nach. So verkündeten Arbeitnehmer weitaus seltener, dass sie stolz darauf sind, für ein bestimmtes Unternehmen zu arbeiten. „Die berufliche Identität wird immer weniger nur auf einen Arbeitgeber aufgebaut”, bekräftigt Rigotti. Arbeitnehmer hätten schließlich auch gute Gründe, sich weniger auf ihren Arbeitgeber zu verlassen: Die Firma könnte sie jederzeit vor die Tür setzen. Denn die moderne Arbeit ist schnelllebiger geworden. Die Leistung des Einzelnen immer weniger entscheidend.
Laut Rigotti besinnen sich Arbeitnehmer heutzutage eher auf sich selbst als auf das Unternehmen: Wer bin ich? Was will ich? Womit kann ich mich profilieren? „Das resultiert darin, dass Angestellte neben dem Broterwerb auch anderes als sinnvolle Arbeit empfinden“, sagt Rigotti. Hobby, Familie, Ehrenamt – Millionen Menschen beweisen tagtäglich, dass es mehr als den Beruf gibt, für das sie sich leidenschaftlich engagieren können. So sieht das auch besagte Freundin: Sie macht jetzt nebenher Lokalpolitik, und liebt es.