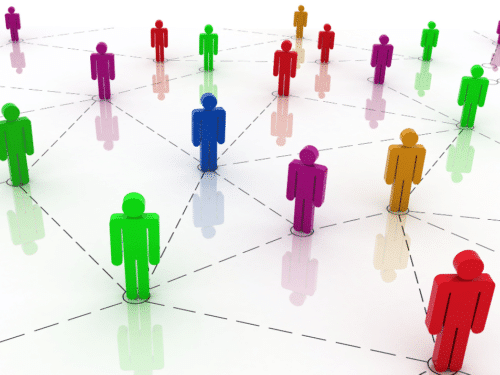Früher war mehr Lametta? Stimmt nicht, zumindest was unsere Arbeitswelt betrifft. Glich der Joballtag einst einer Zweckehe, wird er heute oft mit Sinn-Sehnsüchten aufgeladen, teils gar überfrachtet. Die Utopie im Büro birgt Gefahren – aber ein bisschen Idealismus darf es ruhig sein.
Diese Zimmerpflanzen eignen sich ideal fürs Büro“, „Wie viel Körperfett ist ideal?“ und – passend dazu – „Ideale Herbstrezepte“. Bei der News-Suche im Internet wird man zum Begriff „Ideal“ schnell fündig. Er scheint, nun ja, recht beliebig verwendbar zu sein. Gräbt man tiefer, erfährt man, dass der Begriff aus der philosophischen Ästhetik und Ethikvorstellung stammt. Ein Ideal ist der Inbegriff eines Vollkommenheitsmusters, sein Bild erstrahlt in einer Perfektion, an die unsere Realität kaum heranzureichen vermag. Wir belächeln jemanden als Idealisten, der seine hehren inneren Motive verfolgt und dabei die Wirklichkeit verklärt. Wir ermahnen die Träumerin: Sei nicht naiv, verfange dich nicht in unerreichbaren Utopien, lieber der Spatz in der Hand und so weiter.
Gleichzeitig ertappen wir uns dabei, dass unser eigener Anspruch, Idealbildern zu entsprechen, wächst. Wir rücken in den sozialen Medien unser Selbst, unser Abendessen und unseren Urlaub in ein möglichst perfektes Licht. Und auch unser Job soll sich Idealen annähern. Über Omas Rat, einen soliden Beruf zu ergreifen, der Status und Einkommen sichert, schmunzeln wir nur. Es geht doch um so viel mehr – oder etwa nicht? Der Unternehmensberater und Publizist Hans Rusinek hat sich mit der Genese dieses Strebens beschäftigt. Er vergleicht die Entwicklung mit der, die die Paarbeziehung im Verlauf des vergangenen Jahrhunderts genommen hat. Von der einstigen eher zweckgerichteten Ehe mit klarem Fokus auf gegenseitige Versorgung und Familiengründung wurde diese Idee immer weiter zum Ideal angereichert: tief empfundene Liebe, romantische Gesten, eine Innigkeit bis zum letzten Atemzug, die es immer zu erneuern und beteuern gilt. Liebe ist harte Arbeit, heißt es dann manchmal. Aber gilt das auch andersherum?
Der Sinn als Arbeitsmotor
Einen anhaltenden Glücksrausch versprechen sich von der Arbeit wahrscheinlich die wenigsten. Aber schon eine tiefe Befriedigung. Der Job soll die Gewissheit versprühen, das Richtige zu tun, etwas Sinnvolles. Das beobachtet auch Hans Rusinek, der sich mit der Transformation von Arbeitswelten beschäftigt und dazu lehrt. „Wir sprechen oft von Sinn auf der Arbeit, als sei das schon immer ein menschliches Bedürfnis gewesen“, sagt er. Dabei handele es sich eigentlich um ein jüngeres Phänomen, das vor allem durch die Hippie-Bewegung der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts geprägt worden sei. Der Kapitalismus, erklärt Rusinek, habe einen evolutionären Prozess durchlaufen: Nachdem in den siebziger Jahren die Kritik immer lauter wurde, Arbeit würde den Menschen zu sehr einengen, zu wenig das Menschsein erlauben, veränderten Arbeitgeber ihre Strategie. Immer häufiger suggerierten sie ihren Beschäftigten: Verwirklicht euch, entwickelt Leidenschaft, verfolgt eure Ideale! Und die Hoffnung, dass die Menschen dadurch produktiver werden, ging auf. „Wenn Beschäftigte motiviert sind, ist das ein riesiger Wettbewerbsvorteil und klar im Interesse der Stakeholder eines Unternehmens“, sagt Rusinek. Seien in den vergangenen Jahrzehnten Heimat, das Vereinswesen und Religion für viele als Sinnquellen versiegt, beschränkten sich immer mehr Menschen auf die Arbeit als Quelle. Doch zu oft geht der Plan nicht auf, kann die Realität dem Ideal einer erfüllenden Tätigkeit nicht standhalten. Die Selbstverwirklichung über den Job anzustreben, birgt Gefahren des Scheiterns, des sich Aufreibens.
Das betrifft Angestellte, die vorwiegend geistige Arbeit verrichten – die Wissensarbeiterinnen oder Knowledge-Worker –, besonders. Im Vergleich zum Tischler, der Sinn und Befriedigung empfindet, wenn er mit der Hand über die glatt geschliffene Oberfläche eines Möbelstücks fährt, ist Wissensarbeit oft entmaterialisiert. Kein unwichtiger Aspekt, wie Rusinek findet: „Körperliche Verausgabung, ein haptisches Erlebnis – so etwas gibt es in der Wissensarbeit kaum, oft noch nicht einmal das Gefühl, mit etwas fertig geworden zu sein, weil sich jedes Konzeptpapier noch verfeinern, jede Software noch ergänzen lässt.“ Während sich die Knowledge-Worker also am Wochenende zum Steinmetz-Workshop zusammenfinden, um mal was mit den Händen zu machen, wird die Steinmetzin auf den Excel-Kurs als Ausgleich zu ihrem Tun vermutlich dankend verzichten. Auf der Suche nach mehr Sinn im Büro, gehört Purpose inzwischen ins Grundvokabular jedes HR-Profis. Der Begriff eignet sich für das Employer Branding von Unternehmen genauso wie als Narrativ in der eigenen beruflichen Biografie. Es kommt nun darauf an, ihn nicht als einen Selbstzweck zu behandeln und auch nicht als ein über allem schwebendes Abstraktum.
Freiraum statt Purpose-Korsett
Also mal ein Blick in die Praxis. Wenn man Elke Frank nach ihren Idealen als HR-Chefin fragt, serviert sie ihr persönliches Ranking: „Das höchste Ideal in der Personalführung ist für mich Vertrauen, gleich dahinter kommen Fairness, Respekt und eine offene Kommunikation.“ Frank ist seit 2019 Personalvorständin der 1969 gegründeten Software AG in Darmstadt. Sie ist neben den HR-, IT- und Legal-Bereichen auch mit der Transformation des global tätigen Hauses mit rund 4.700 Mitarbeitenden betraut. Davor war sie unter anderem bei Daimler und der Telekom und schrieb das Buch Warum wir die Arbeit neu erfinden müssen. Schöne Schlagworte in den Raum zu werfen, damit ist es nicht getan, weiß Frank. Um die genannten Ideale im Unternehmen voranzutreiben, statt sie als utopische Blasen im luftleeren Raum schweben zu lassen, sieht sie in HR einen wichtigen Stellhebel. In puncto Vertrauen bedeute das: Die Führungskräfte zum Loslassen bewegen, Flexibilität von Arbeitszeit und -ort fest verankern – und zwar nicht nur in Zeiten der Pandemie. Beim Thema Fairness steht die studierte Juristin für eine klar geregelte Chancengleichheit der Geschlechter ein, die durch interne Quoten geregelt wurde, beim Recruiting angefangen. „Hier kann HR steuern, bei Talentprogrammen und Nachfolgeregelungen für Diversity sorgen – das ist eine enorme Chance, die Unternehmenskultur zu stärken und Idealen ein Stück näher zu kommen“, sagt sie.
Als die Corona-Krise den Alltag plötzlich unterbrach, hatten viele Beschäftigte Raum für Reflexion und stellten sich die Sinnfrage. Woran und wie arbeite ich eigentlich? Wie möchte ich arbeiten? Die Sinnsuche und auch die Debatte um Nachhaltigkeit nimmt Frank als einen generationsübergreifenden Trend wahr: „Danach wählen die Menschen ihren Arbeitgeber aus. Und danach treffen sie auch die Entscheidung: gehen oder bleiben?“ Das heißt nun aber nicht, dass die Beschäftigten der Software AG ein vorgefertigtes Rundum-Sorglos-Sinnpaket geliefert bekommen. „Sinnziele müssen aus der Mannschaft kommen, da können Sie nichts von oben diktieren“, sagt Frank. Im Unternehmen gab es eine Abstimmung darüber, welches Motiv im Fokus stehen soll – ein sogenanntes „Crowdsourced Purpose“. Es lautet sinngemäß: Wir verbinden Menschen und Technologien für eine intelligentere Zukunft. Jede einzelne Person kann daraus etwas anderes für sich und die tägliche Arbeit ableiten. Denn, auch das ist entscheidend: Unternehmen sollten zwar Sinnangebote schaffen, aber nicht in Form einer vorgefertigten Purpose-Liste zum Abhaken. Das steht dem Entwickeln individueller Ideale eher im Weg.
Es braucht Gestaltungsfreiheit, und die fordern Beschäftigte immer häufiger. Nicht nur im übertragenen Sinne, sondern im Hinblick darauf, wann und von wo aus sie arbeiten. „Eine solche Flexibilität zu ermöglichen, das ist kein fancy Nischenmodell aus der IT-Branche mehr“, sagt HRlerin Frank. Es werde zum Must-have, um bei der globalen Talentsuche erfolgreich zu sein, insbesondere im Wettbewerb um rare Fachkräfte wie aus der IT. Frank beobachtet besonders bei jungen Beschäftigten, dass sie das einstige Ideal einer Langzeit-Betriebszugehörigkeit nicht mehr unbedingt verfolgen. Stattdessen ziehen sie weiter, wenn woanders ein neuer, vermeintlich idealer Job lockt. Das macht es für HR nicht unbedingt leichter. Über den Vergleich der neuen Arbeitswelt mit einer romantischen Beziehung muss die Managerin lächeln. „Es stimmt: Wenn die Gewissheit fehlt, dass die Leute dauerhaft im Unternehmen bleiben, kommt es noch einmal mehr darauf an, als Arbeitgeber stetig bemüht und attraktiv zu bleiben“, sagt sie.
Ideale im Wandel
Attraktiv bedeutet zunehmend auch: nachhaltig. Teils findet gar ein Greenwashing des eigenen Jobs statt. Diesen Sinndruck beobachtet Hans Rusinek vor allem in der Selbstdarstellung in Online-Karrierenetzwerken. „Wenn alle einen so nachhaltigen Job hätten, wie sie ihn auf Linkedin darstellen, müssten wir uns um Klima und Weltrettung keine Sorgen machen“, sagt er lakonisch. Die Bedrohung rückt näher, daher besteht vor allem in privilegierten Kreisen ein Druck, an den überfälligen Reparaturen unseres Planeten mitzuwirken.
Ideale der Arbeitswelt sind im Wandel und der Kapitalismus passt sich stetig an. Während das Thema Nachhaltigkeit eine größere Rolle spielt, rücken viele von der Bereitschaft, für den Job alles zu geben, wieder ab. Von manchen Recruiting-Verantwortlichen heißt es sogar, die Generation Z wünsche sich die Stechuhr zurück, um eine Entgrenzung der Arbeitszeit zu vermeiden. Zu Abstrichen bereit sind die jungen Berufstätigen in ihrer Karriere eher beim Status als beim Sinn. Hans Rusinek begrüßt es, dass die Jüngeren mehr Freizeit einfordern. „Es ist wichtig, auf der Arbeit Sinnfragen zu stellen. Aber nur hier Antworten zu erwarten, wirkt überfrachtend.“ Besser sei das Spielbein-Standbein-Prinzip: der Werbetexter, der zu Hause schreinert, die Ärztin, die Gedichte schreibt. Das nimmt den Druck von der Arbeit als Sinnstifterin Nummer eins und stimmt im Zweifel versöhnlicher, wenn dort mal etwas schiefläuft. Denn in der Realität ist unser Arbeitsumfeld – wie eben auch eine Ehe oder Partnerschaft – ein Kompromiss. Zum Ideal führt nur eine Annäherungskurve. Und das ist in Ordnung, auch wenn es nicht besonders romantisch klingt.
Wer sich seiner persönlichen Ideale nicht ganz sicher ist, kann erst mal klein anfangen. Mit der Anschaffung von Azaleen und Alpenveilchen zum Beispiel. Diese Zimmerpflanzen können sich laut des eingangs erwähnten Online-Beitrags einer Lokalzeitung nämlich „in Büros ideal entfalten“. Und damit haben sie so manchen von uns etwas voraus.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Ideale. Das Heft können Sie hier bestellen.