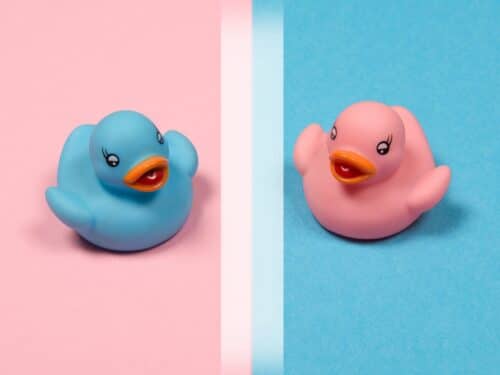Bei Siemens soll Führung horizontaler werden – und HR muss mit gutem Beispiel vorangehen. Personalchefin Janina Kugel über den Kulturwandel im Konzern, das interne soziale Netzwerk und die fehlende Chancengleichheit von Männern und Frauen.
Zuletzt hat man immer wieder von Managerinnen gehört, die sich nicht lange auf ihrem Vorstandsposten halten konnten. Bei Janina Kugel muss man wohl nicht damit rechnen. Denn sie kennt Siemens seit 2001 und stieg nach einem kurzen Intermezzo bei Osram 2013 erst einmal eine Ebene unterhalb des Vorstands in den Konzern ein. Im Gespräch wirkt sie freundlich und entspannt. Sie steht wie kaum eine andere für eine neue Kultur bei Siemens, eine Kultur, die von flacheren Hierarchien und mehr Nahbarkeit des Managements geprägt ist.
Frau Kugel, Sie unterstützen das Netzwerk Chefsache. Ein Netzwerk von Führungskräften aus Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlichem Sektor und Medien, die sich der Chancengleichheit von Frauen und Männern persönlich verpflichtet fühlen. Warum braucht es so ein Netzwerk?
Diversity – im Übrigen nicht nur Gender Diversity – kann nicht entstehen, wenn die Führungsebene in einer Organisation nicht daran glaubt. Und dementsprechend wurde der Begriff „Chefsache“ geprägt. Bereits bei der Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr hat Kanzlerin Angela Merkel als Schirmherrin der Initiative gesagt, sie hätte lange daran geglaubt, dass sich die Problematik des zu geringen Anteils von Frauen in Führungspositionen in unserer Gesellschaft von alleine erledigen würde. Um schließlich doch feststellen zu müssen, dass die Gleichberechtigung von alleine nicht passieren wird, weshalb man sie immer wieder thematisieren müsse. Das ist genau das Anliegen des Netzwerkes, dessen Mitglieder einen Querschnitt der Gesellschaft bilden. Es sind Menschen, die sagen: „Wir sind in Deutschland noch nicht da, wo wir sein sollten.“
Wo zeigt sich die mangelnde Chancengleichheit vor allem?
Zunächst stellt sich die Frage, wie man die Chancenungleichheit messen will. Relativ leicht lässt sich der Anteil der Absolventinnen bei den technologischen Studienfächern feststellen oder die Anzahl der weiblichen Führungskräfte in den Organisationen. Wenn man diese Zahlen dann in Bezug setzt zum Anteil der jungen Frauen, die die Hochschulreife erwerben, wird deutlich, dass sich was ändern muss. Wir sprechen allerdings von einem gesamtgesellschaftlichen Thema. Es geht nicht nur um die Unternehmen, sondern auch um die gesellschaftlichen Erwartungen an Männer und Frauen. Wir müssen unser Schulsystem anschauen und hinterfragen, und wir müssen uns ebenso die Frage stellen, ob das Steuersystem Gleichberechtigung unterstützt. Solange es schwierig ist, dass beide Elternteile im Berufsleben stehen, wird es immer die Auseinandersetzung um die Frage geben, wer zu Hause bleibt. In der Regel ist das die Frau. Im Übrigen auch, wenn es um die Pflege von Angehörigen geht. Und die Auswirkungen sieht man bei der beruflichen Entwicklung oder auch bei Themen wie Altersarmut.
Wie würden Sie die Situation bei Siemens bewerten? Hat sich in den vergangenen Jahren bezüglich Chancengleichheit etwas getan?
Wir haben auf jeden Fall mehr Frauen in den verschiedenen Führungsebenen. Wir werden kontinuierlich besser. Wir sind aber noch nicht da, wo wir hin möchten.
Sie wollen den Anteil der Frauen auf den beiden obersten Führungsebenen des Unternehmens in Deutschland bis Ende Juni 2017 auf zehn Prozent steigern. Warum ist der Anteil so niedrig?
Der erste Berichtszeitraum endet laut Gesetz erst im September des kommenden Jahres. Dann werden wir auch kommunizieren, wo wir in Bezug auf den Frauenanteil gelandet sind.
Das betrifft ebenfalls den Anteil der Frauen im übertariflichen Bereich in Deutschland?
Nein, es geht um die ersten beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstandes. Der übertarifliche Bereich geht wesentlich weiter und da liegen wir deutlich über zehn Prozent.
12 bis 13 Prozent habe ich gelesen.
Es sind aktuell 15 Prozent.
Aber was kann man tun, um diesen doch recht geringen Anteil noch zu erhöhen?
Wie ich bereits angedeutet habe, brauchen wir einen Wandel hinsichtlich der gesellschaftlichen Akzeptanz, beispielsweise in Bezug auf die Berufstätigkeit von Eltern. Und wir brauchen Rollenvorbilder in den Führungsetagen, die zeigen, dass man anders führen kann als im traditionellen Sinne. Was zum Beispiel wichtiger werden wird, ist das Denken in Communitys. Führung muss sich ändern, horizontaler werden. Was wir heute noch in den meisten Organisationen erleben, ist ein sehr hierarchischer Führungsstil. Viele Vertreter der Babyboomer und der Generation X sind klare Ansagen gewohnt von ihren Chefs, die scheinbar genau wissen, was zu tun ist. So kann man jedoch angesichts der zunehmenden Komplexität durch Globalisierung und Digitalisierung nicht weiter führen. Zudem haben wir mit den Generationen Y und Z deutlich mehr Menschen, die eine andere Form der Führung sehen möchten. Chef sein alleine reicht nicht mehr. Sie müssen gleichzeitig Kollege, Mentor, Coach und Mediator sein. Zudem muss die Führungskraft in der Lage sein, Mitarbeiter zu stimulieren und zu inspirieren.
Macht es diese neue Führung Frauen leichter, in höhere Positionen zu kommen?
Eine Gruppe, die in sich homogen ist, tut sich immer schwer damit, neu oder anders denkende Leute reinzuholen. Die brauchen Sie aber, wenn Sie sich in einem System bewegen, das von einer hohen Komplexität und hohen Geschwindigkeit geprägt ist. Mehr Diversity wird nötig sein, um diese Systeme zu diskutieren und zu beherrschen. Dazu gehören auch Frauen. Aber genauso sind in einem globalen Unternehmen Menschen mit unterschiedlichen Nationalitäten, Ausbildungen oder sexuellen Orientierungen in den Führungsetagen wichtig. Jeder betrachtet die Welt und die Ereignisse von einem anderen Blickwinkel aus. Diese vielfältigen Perspektiven brauchen Unternehmen, um bestmögliche Entscheidungen zu treffen.
Trotzdem gibt es Leadership-Programme für Frauen?
Ja, auch die sind notwendig. Wenn sie eine Frau fragen, ob Sie sich die nächsthöhere Position zutraut, wird sie häufig zögerlicher reagieren als ein Mann und überlegen, wen sie in den Entscheidungsprozess einbeziehen muss und wie sie die Balance zwischen privaten und beruflichen Aufgaben schaffen kann. Von den Männern bekommt man hingegen meistens eine deutlich klarere Antwort. Nicht wenige Vorgesetzte deuten das dann in die Richtung, dass der Mann sich mehr zutraut und ehrgeiziger ist. Aber was ist hier confidence und was ist competence? Diese Themen adressieren wir auch von HR-Seite aus. Es ist nicht leicht, sich von seinen Vorurteilen zu verabschieden, weil sie zum Teil stark unser Denken prägen. Wir bieten deshalb im Rahmen von Leadership-, Personalentwickler- oder Recruiting-Weiterbildungen auch Trainings zu der Thematik Unconscious Bias an.
Gibt es noch die klassischen Männer-Seilschaften in Unternehmen?
Ja, die gibt es noch.
Janina Kugel, Foto: www.siemens.com/press
Das Thema Unternehmenskultur rückt bei Siemens generell in den Vordergrund. Ihr Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine Eigentümerkultur zu schaffen. Wie kann das bei einem Konzern gelingen, der über 300.000 Mitarbeiter hat und sehr hierarchisch wirkt?
Wir haben zunächst definiert, wie sich für uns eine Eigentümerkultur zusammensetzt. Neben den kulturellen Themen Mitarbeiterorientierung, Führung, Werte und Verhalten spielt für uns ebenfalls die finanzielle Mitarbeiterbeteiligung eine wichtige Rolle. Wir haben unterschiedliche Programme weltweit, mit denen Mitarbeiter Aktien von uns erwerben können oder die sie für besondere Leistungen bekommen. Die entscheidende Frage ist: Was motiviert einen Menschen? Ich denke, es ist vor allem der Sense of Belonging. Sie gehören zu einem Team, das ein gemeinsames Ziel verfolgt. Und ihr Beitrag ist wichtig für den Erfolg. Wenn man dann noch Aktien von Siemens besitzt, dann ist man nicht nur als Mitarbeiter ein Teil des Unternehmens, sondern auch als Shareholder.
Im Übrigen ist Größe nicht immer gleichzusetzen mit Hierarchie. Wir arbeiten beispielsweise seit der Umstellung der HR-Organisation vor zwei Jahren in globalen Teams zusammen – über Hierarchien hinweg. Dass dies explizit gewünscht ist, ist für ein Unternehmen unserer Größe oft nicht üblich. Unsere Absicht ist, dass neue Guidelines und Prozesse nicht vom Headquarter vorgegeben werden, sondern globale gleichberechtigte Teams die Standards gemeinsam erarbeiten. Denn in der heutigen komplexen Welt gibt es meist keinen „One fits all“-Ansatz, sondern je nach Region und Geschäftstyp unterschiedliche Lösungen.
Können Sie hierzu einmal ein Beispiel geben?
Bei uns gibt es mittlerweile das Multi-Source-Feedback, also nicht nur das klassische Gespräch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter im Rahmen des Performance Managements. Jeder im Unternehmen erzielt die beste Wirkung in der Organisation, wenn es mit den Peers, dem Team und dem Chef gut klappt. Die Idee des Multi-Source-Feedbacks haben wir mit Repräsentanten aus unterschiedlichen Ländern gestaltet. Das heißt auch, dass der genaue Prozess, zum Beispiel hinsichtlich Häufigkeit oder Offenheit des Feedbacks je nach Region unterschiedlich aussehen kann. Im Sinne der Eigentümerkultur geben wir so vielen Mitarbeitern eine Chance, an einem globalen, neuen Thema mitzuarbeiten – unabhängig von der Hierarchieebene. Diese können dann sagen: „Ich war dabei, als wir in einer globalen Runde dieses Thema gestaltet haben.“ Und das ist doch etwas, das viele stolz macht.
Eigentümerkultur heißt, dass Mitarbeiter Verantwortung übernehmen. Das verlangt gewisse Freiheiten. Studien zeigen allerdings, dass es den meisten Führungskräften immer noch schwerfällt, loszulassen. Wie weit, würden Sie sagen, sind Sie beim Wandel der Führungskultur?
Wir sind mitten in einer Transformation zur horizontalen Führung. Und ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, alle sehen die Möglichkeiten, die sich damit auftun. Es gibt aber auch eine Menge Führungskräfte, die merken, dass ihre Wirkung ins Team oder ins Unternehmen viel größer wird, wenn sie Mitarbeiter einbinden und mitentscheiden lassen. Horizontale Führung heißt für mich übrigens ebenfalls, nicht immer den ranghöchsten Manager einer Organisationseinheit zu einem bestimmten Thema einzuladen, sondern schlicht den besten Experten. Wir hatten neulich eine Herausforderung zu einem Recruiting-Thema in China. Früher wäre jemand aus der Zentrale dort hingefahren, um sich das Problem anzuschauen. Nach unserer neuen Logik hat sich ein Team aus internationalen Experten dem Thema gestellt – Leute aus unterschiedlichen Ländern, die vor ähnlichen Herausforderungen standen. Da war eine Endzwanzigerin genauso dabei wie ein Mittfünfziger, die beide ganz wichtige Erfahrungen für die Problemlösung mitgebracht haben.
Wie unterstützt HR beim Wandel? Welche Aufgaben haben die Personaler, damit sich eine neue Führungskultur im Unternehmen etablieren kann?
In erster Linie gilt es, alle Kultur- und People-Themen zu prägen und zu gestalten. HR hat hier eine aktive Rolle und darf nicht warten, bis das Business sagt, was es möchte, um dann zu versuchen, genau das zu exekutieren. Wir treiben den Wandel voran, indem wir unter anderem die Themen rund um eine neue Führung in unsere Leadership-Trainings nehmen und in unserem Performance Management-System berücksichtigen. Wir machen auch sogenannte Learning Expeditions, bei denen Teams sich eine Reihe von anderen Unternehmen – auch mit einem komplett anderen Business-Modell – anschauen, um zu verstehen, wie zum Beispiel ein alternatives Vertriebskonzept aussehen kann. Nicht nur class-room-trainings, sondern das wirkliche Erleben führt häufig zum „Aha-Moment“.
Laut einer Studie von Hays ist eines der größten Hindernisse bei der Digitalen Transformation ein Silo- und Konkurrenzdenken in den Unternehmen. Wie stark ist das bei Siemens ausgeprägt?
Das gibt es sicherlich noch an manchen Stellen, was jedoch bei einem Konzern unserer Größe ganz normal ist. Doch der Wandel ist spürbar. Nehmen sie unsere Software-Entwicklung, unterschiedliche Vertriebsorganisationen oder zum Teil auch unsere HR-Funktionen. Dort ist klar ersichtlich, dass es vielen Führungskräften und Mitarbeitern darum geht, was wir als Siemens in Summe erreichen können. Und darum geht es uns. Um das Unternehmen als Ganzes.
In vielen Unternehmen entstehen selbstorganisierte Communitys zu unterschiedlichen Themen. Ist das etwas, das Sie begrüßen?
Absolut. Das gibt es immer mehr und wir fördern das. Die sozialen Netzwerke machen die Entstehung solcher weltweiten Gruppen noch leichter. Wir haben ein solches internes soziales Netzwerk seit 2013. Dort passiert eine ganze Menge. Es bilden sich offene und geschlossene Communitys zu einer Vielzahl an Themen. Und die muss man dann auch machen lassen und den Austausch und das Engagement nicht durch Regeln und Standards ersticken. Von solchen Mitarbeitergruppen sind schon einige Ideen hochgekommen, auch im Bereich HR, die dann von den Gruppen weiterverfolgt und gestaltet werden. Zudem holen wir uns Feedback zu bestimmten Sachen bevor wir etwas lancieren. Wir suchen im Netzwerk den Dialog, fragen die Mitarbeiter regelmäßig, wie wir etwas verbessern können. Ich persönlich schätze unser Siemens Social Network sehr, weil es mir die Chance gibt, in die Organisation reinzuhören, was vorher so nicht möglich war.
Wenn Sie nach vorne schauen: Welche Rolle sehen Sie für HR vor allem?
Zum einen müssen wir die Implikationen der Digitalisierung im Blick haben: Welche Kompetenzen sind in den verschiedenen Jobs zukünftig nötig? Wie verändert sich die Zusammenarbeit oder der Arbeitsplatz? Flexible Arbeitszeiten und Home Office sind bei uns allerdings schon lange möglich. Zum anderen sehe ich HR als einen Treiber und Gestalter von Kultur. Es gilt zwar zu verstehen, wo die Reise des Business hingeht und was wir brauchen, um wettbewerbsfähig zu sein. Aber die HR-Funktion kann nicht gut werden, wenn sie zu allem Ja und Amen sagt. Wer HR macht, um geliebt zu werden, ist am falschen Platz. Zu lange beschränkte sich das Selbstverständnis von HR auf die Abwicklung der Administration. Das ist wichtig. Aber wir müssen uns auch selbst immer wieder fragen: Was brauchen wir als Unternehmen – und zwar heute und morgen? Das heißt zum Beispiel, jemanden zu recruiten der das Potenzial mitbringt, auch zukünftige Bedürfnisse abzudecken. Oder sich im Rahmen des Employer Branding zu fragen: Was müssen wir tun, um für die junge Bewerbergeneration attraktiv zu sein und nicht nur für die bestehende Belegschaft? Neues zu wagen, kann zu Konflikten führen. Die müssen wir aushalten können.