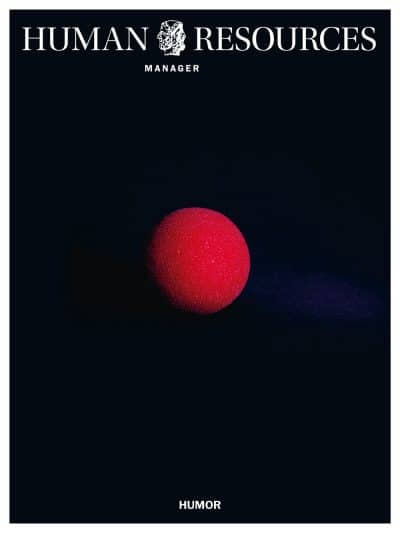Es gibt einen Witz, den Juliane Schreiber mag. Er ist vom US-amerikanischen Comedian George Carlin und geht so: „Einige sehen das Glas halb voll, andere sehen es halb leer. Ich sehe ein Glas, das doppelt so groß ist, wie es sein müsste!“ Die Politologin Juliane Schreiber arbeitet als freie Journalistin und landete mit ihrem zweiten Sachbuch Ich möchte lieber nicht. Eine Rebellion gegen den Terror des Positiven einen Bestseller. Empörung verkauft sich gut. Und Juliane Schreiber ist empört oder vielmehr genervt vom Glücksimperativ, dem wir in unserer Leistungs- und Konsumgesellschaft hörig sind.
Zurück zu George Carlins Pointe: Menschen, die so empfinden, die die falsche Größe des Glases sehen, verortet Schreiber im sogenannten depressiven Realismus. Das sind Personen, die die Welt und die eigene Lage eher düster einschätzen, ohne dabei jedoch an einer schweren Depression zu erkranken. Man könnte sie auch Melancholiker oder Pessimistinnen nennen, die aber ausdrücklich nicht zum Fatalismus neigen. Es geht eher um eine skeptische Grundhaltung, die die Gefahren der Zukunft vorauszuahnen sucht; eine Huldigung des Zweifels in einer Kultur der Kommandos: Sei glücklich! Hol alles aus dir heraus! Begreife Scheitern als Chance! „Weil wir ständig etwas wollen sollen, haben wir weder Lust noch Kraft“, schreibt die Journalistin. Glück sei zu einem Statussymbol geworden. Leute, die viel Zeit auf Linkedin oder Instagram verbringen, wissen, was Schreiber meint.
Die 32-Jährige nimmt die gesamte Glückscoachingszene und die Positive Psychologie durch die Mangel, allem voran ihren Begründer Martin Seligman. Er ist mit einer umstrittenen Glücksformel bekannt geworden: Glück sei zur Hälfte Genetik, ein Zehntel Schicksal, und den Rest hätten die Menschen selbst in der Hand. Schreiber diskutiert die aktuelle Forschung, die Seligmann kritisiert und fragt: Warum müssen wir unsere Perspektive auf die Welt ändern, wenn eher die äußeren Umstände in Angriff genommen werden sollten? Die Autorin warnt vor einer Psychologisierung von Gegebenheiten, die eigentlich politisch sind. Schließlich hätten nicht die Glücklichen die Welt verändert, sondern die Unzufriedenen, indem sie auf Missstände aufmerksam machten. Es brauche also eine Philosophie des Nein! Mit einem Zitat des italienischen Philosophen Antonio Gramsci präsentiert Schreiber die idealtypische Haltung des Homo sapiens: Dieser brauche einen „Pessimismus des Verstandes“ und einen „Optimismus des Willens“.
Nach hundert Seiten Bestandsaufnahme, aber auch viel Aufruhr um Wohlfühltees, Happiness-Shampoos und Hygge-Lifestyle, widmet sich Schreiber der Sinnhaftigkeit von Schmerz und der Wohltat des Schimpfens. Schimpfen entlastet. Und so vollzieht dieser Text selbst, was er predigt. Er ist spöttisch, keine ausgeruhte Analyse eines komplexen Themas. Manchen Fragen geht sie dabei aus dem Weg: Zum Beispiel, was denn Wirklichkeit sei, wenn sie anführt, pessimistische Menschen würden die Welt sehen, wie sie wirklich ist. Woran erkennen wir Realität?
Zudem schreibt sie ohne Beleg Sätze wie: „Wer mit einer Angststörung oder einer mittelschweren Depression in Therapie geht, bekommt von jedem, wirklich jedem Therapeuten den Ratschlag, doch mal was Hübsches, Kleines mit den Händen zu machen.“ Auch Gespräche, die sie beispielsweise in der Straßenbahn mitangehört hat, wirken konstruiert.
Schreibers Stärken liegen dafür in der spannungsvollen Wiedergabe von Studienergebnissen und den wichtigsten Thesen großer Denker und Soziologinnen wie Eva Illouz. Besonders gelungen ist das Kapitel Das Paradox der Neoromantik über besondere Momente, derer wir uns selbst berauben, weil wir sie für die sozialen Medien fotografieren. Nach und nach spitzt sich der Text zu und landet schließlich bei einem Manifest des Nein. Dies soll jedoch kein Lösungsangebot sein, Schreiber geht es eher um die Entzauberung eines Narrativs, das nach dem Motto operiert: Jeder Mensch ist seines eigenen Glückes Schmied. (Nein, manchmal hat man einfach nur Pech.) Erheiternd sind auch die Schimpfwörter, die sie den Lesenden wie im Vorbeigehen mit an die Hand gibt: Senfgurke, Schluchtenscheißer, Schwingtitte oder Schweine-Sau-Sack. Seelische und körperliche Schmerzen lassen sich nämlich erwiesenermaßen durch anständiges Motzen lindern. Schreiber nennt dies auch eine besonders wichtige Form der vorpolitischen Artikulation. Nur wenn wir aussprechen, was uns stört, merkt unser Gegenüber, dass etwas nicht stimmt.

Juliane Marie Schreiber, Ich möchte lieber nicht. Eine Rebellion gegen den Terror des Positiven. Piper Verlag, 16 Euro, 208 Seiten. Erschienen im März 2022.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Humor. Das Heft können Sie hier bestellen.