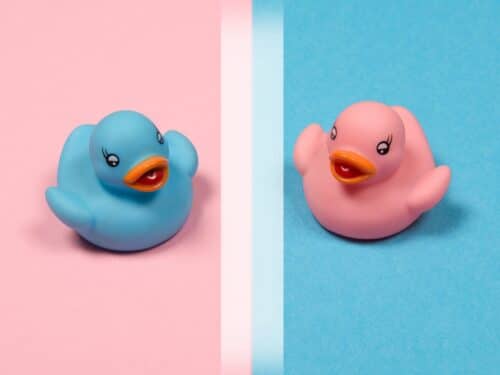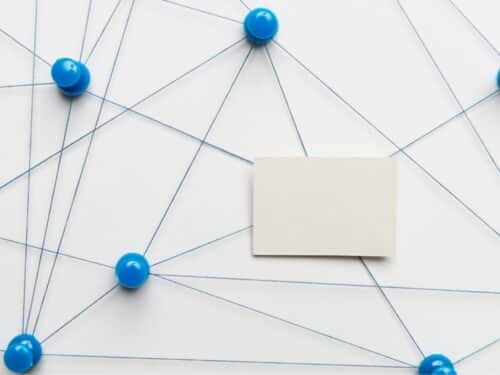Im Kampf um Talente kann kein Recruiter mehr darauf setzen, dass die richtigen Bewerber sich schon melden werden. Die Grenzen zwischen Recruiting und Headhunting verschwinden. Und ohne digitale Kompetenz geht gar nichts mehr.
Man muss das vielleicht am Anfang gleich mal klarstellen. Ja, Bewerber sind immer noch jene, die einen Job suchen – und nicht die, die ihn anbieten. Das klingt jetzt selbstverständlicher, als es einem nach Gesprächen mit Personalern und Experten zum Thema erscheinen mag. Denn diese präsentieren mittlerweile ein Bild, das man nur wenig zuspitzen muss, um oben genannte Klarstellung nachzuschieben.
Grundsätzlich scheint da was dran zu sein, wenn zum Beispiel Ralph Dannhäuser vom „Personaler 1.0“ spricht, und zwar wenig wertschätzend in Abgrenzung zum „Personaler 2.0“, der die Zeichen der Zeit erkannt habe. Dannhäuser ist Herausgeber des „Praxishandbuchs Social Media Recruiting“ und berät mit seiner Firma Unternehmen zum Thema Recruiting. Und oft frage er sich dabei, „wie manche Recruiter heute überhaupt noch Personal finden“.
„Post and pray“, so nennt nicht nur Dannhäuser das aus seiner Sicht auch heute noch in der Personalerwelt weit verbreitete Phänomen, Stellenanzeigen zu schalten und danach förmlich dafür zu beten, dass sich der richtige Bewerber schon melden werde. Der 2.0-Recruiter hingegen habe erkannt, dass er auf diese Weise zwar noch Bewerbungen bekomme, längst aber nicht die richtigen Kandidaten. „Die goldenen Zeiten, in denen es darum ging, welche der 200 eingegangenen Bewerbungen aussortiert werden sollen, sind bei den meisten Unternehmen vorbei“, sagt Dannhäuser. „Der Recruiter 1.0 war verwaltender Administrator, der Recruiter 2.0 ist Berater und Verkäufer.“
Dabei ist dieser Trend nicht unbedingt neu. Vom „war for talents“ und dem Fachkräftemangel habe man schon Ende der 1990er Jahre gesprochen, betont Dannhäuser. Nur hätten längst nicht alle Personaler bis heute verinnerlicht, dass sie diejenigen seien, die überzeugen müssten.
Dabei gibt es auch dafür ein Rollenmodell aus der alten Welt: Den Headhunter, der potenzielle Jobkandidaten umwirbt. Die Frage, was Recruiter von Headhuntern lernen könnten, hört Dannhäuser allerdings nicht gerne. „Die Unterscheidung zwischen beiden Professionen ist zutiefst künstlich“, sagt er. Heute gehe es für Recruiter vielmehr darum zu verinnerlichen, dass sie sich in einem auf dem Kopf gestellten Markt bewegten. Und sie sich damit natürlich auch als Headhunter begreifen müssten, auch wenn sie es nach klassischer Definition nicht seien. Mit seiner Beratungsfirma on-connect ist der gelernte Bankfachwirt Dannhäuser seit 2009 auf dem Markt, als externer Dienstleister übernimmt er das Recruiting vor allem für mittelständische Unternehmen, außerdem gibt er Seminare für Personaler. Dannhäuser ist spezialisiert auf das, was nahezu sämtliche Experten als Dreh- und Angelpunkt des Recruitings der Zukunft betrachten: Social Recruiting, also die Personalsuche in Netzwerken wie Xing und LinkedIn.
Dannhäuser hat eingängige Zahlen parat, will er begründen, warum Personaler in solchen Netzwerken suchen und sich von der herkömmlichen Stellenanzeige lösen sollten. Demnach sei von allen potenziellen Jobinteressierten, schätzt er, nur jeder Zehnte aktiv auf Suche, durchforste also die Anzeigen in Zeitungen und Online-Stellenbörsen. Weitere 30 Prozent suchten latent, also schauten auf das, was ihnen ohne eigenes Zutun begegne.
Die meisten, nämlich 60 Prozent, seien zwar offen für Angebote, würden aber selbst nicht aktiv. 90 Prozent Bewerber also, die man besser selbst ansprechen sollte, um mit ihnen in Kontakt zu treten. „Die Machtverhältnisse haben sich verschoben“, sagt Dannhäuser. „Die Übermacht der Arbeitgeber gehört der Vergangenheit an.“
Manufaktur-Arbeit
Recruiting in sozialen Netzwerken sei nichts, was ein HR-Verantwortlicher nebenbei tun könne, betont Dannhäuser, und noch weniger funktioniere es ohne professionelles Management – wohl ein Hauptgrund, warum ihn vor allem mittelständische Unternehmen mit kleineren Personalabteilungen beauftragen.
Den größten Fehler, sagt Dannhäuser, begingen die meisten Recruiter bereits bei der Formulierung der Jobausschreibungen, in denen dann mit Satzbausteinen wie „interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet“ rein gar nichts gesagt werde. 80 Prozent aller Anzeigen, schätzt Dannhäuser, seien so formuliert, dass sie genau an der Zielgruppe vorbei gingen.
Aus diesem Grund gelte es zunächst herauszufinden, welche Mitarbeiter das Unternehmen genau suche, um dann im nächsten Schritt eine Ausschreibung und Ansprache zu formulieren, die diese Kandidaten auch erreiche und ihr Interesse wecke. „Da geht es um die Frage, wie das digitale Bild des Kandidaten aussieht und welche Schlagworte wir bei der Xing-Suche verwenden müssen.“
Schließlich würden geeignete Kandidaten immer mit einer individualisierten Ansprache angeschrieben. „Das ist aufwändig“, sagt Dannhäuser, werde aber erfahrungsgemäß mit einer Rücklaufquote von bis zu 70 Prozent belohnt. „Natürlich ist das Manufaktur-Arbeit, bringt den Personalern aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich die besten Kandidaten.“
Die Bewerber wollen es heute „individueller, persönlicher und wertschätzend“, fasst es Christoph Beck zusammen, Wirtschaftsprofessor an der Hochschule Koblenz und Experte für Personalmarketing und Recruiting. Kandidaten „möchten auf Augenhöhe wahrgenommen werden, und das beginnt bereits beim Recruiting-Prozess“, sagt er. Die Unternehmen müssten etwas bieten, „wenn sie einen Lebenslauf- und Datenstriptease, im schlechtesten Fall mittels 180 Feldern im Online-Formular, verlangen“. Wie Berater Dannhäuser glaubt auch Beck, dass es in Zukunft die größte Herausforderung für Recruiter sein werde, geeignete Bewerber zu finden, eine Vor- und Endauswahl zu treffen und, ganz wichtig, die eigene Arbeitgeberattraktivität im Blick zu halten. Laut Beck sind mittlerweile Online-Stellenanzeigen, Karrierewebseiten der Unternehmen und Mitarbeiterempfehlungen „die häufigsten und erfolgreichsten Recruiting-Instrumente“.
Entscheidend werde künftig aber sein, „wie schnell auch Lösungen für den Mittelstand, das sind immerhin 98 Prozent aller Unternehmen, bereitgestellt werden, die weder den Spezialisierungsgrad im Recruiting noch die erforderlichen Ressourcen besitzen“.
Die Recruiting-Beratung Dannhäusers ist demnach ein richtiger Ansatz, doch geht Beck davon aus, dass es bald um weit mehr als Xing und Co gehen werde. „Die Welt des Recruiting wird künftig wesentlich digitaler, als sich dies manch einer heute vorstellen kann“, sagt er. Vielleicht geht es auch soweit, dass der Recruiter durch einen Computer ersetzt wird? Ja, durchaus, meint Beck, und kann auf eines seiner laufenden Forschungsprojekte verweisen.
Entwickelt werde dabei eine Methode, die mittels Datenanalyse in der Lage sei, eine halbe Million Bewerbungen innerhalb von fünf Minuten zu scannen und zu ranken, „und dies wesentlich objektiver als jeder Recruiter“. Das ist beeindruckend, lässt aber die Frage offen, wo denn die vielen Bewerbungen herkommen sollen. Semantik-Bots, antwortet Beck, könnten Stellenanzeigen optimieren und nach interessanten Profilen suchen. „Und ja, auch das Vorstellungsgespräch kann und wird gegebenenfalls teils digitalisiert werden.“
Man erzählt Personalern sicher nichts Neues über die Folgen der Digitalisierung für viele Bürojobs – trotzdem ist der Gedanke bisweilen beängstigend, dass auch sie ersetzt werden könnten, selbst die Progressiven unter ihnen. Schließlich ist das, was Beck gerade digitalisieren will, ziemlich genau das, was Ralph Dannhäuser als „Manufaktur“ bezeichnet. Nur effektiver.
Schön zurücklehnen kann man sich da bei Netzwerken wie Xing oder LinkedIn, schließlich fußen die aktuellen Strategien und entworfenen Zukunftsszenarien weitgehend auf der Annahme, dass Bewerber sich in den Netzwerken auch weiterhin präsentieren werden. David Vitrano ist einer der Geschäftsführer der Xing E-Recruiting GmbH und unter anderem zuständig für den B2B-Neukundenvertrieb. Xing ist inzwischen das Standardnetzwerk für Geschäftskontakte im deutschsprachigen Raum. Zum Zeitpunkt des Interviews fieberte Vitrano gerade der 12-Millionen-Nutzer-Marke entgegen. Als Vitrano vor fünf Jahren kam, lief das noch über den herkömmlichen Weg einer Stellenausschreibung.
„Die aktive Kandidatenansprache war damals vor allem im Executive-Bereich State of the Art“, sagt er, eben auf das Handwerk von Headhuntern beschränkt. Heute, kaum ein halbes Jahrzehnt später, habe sich das komplett gewandelt. „Maßgeblich durch Xing ist diese Strategie massentauglich geworden“, sagt Vitrano. Das Netzwerk gehöre damit zum Standardrepertoire der meisten Recruiter, „wenn es um die Ansprache von Fach- und Führungskräften geht“.
Zwei Drittel der Xing-Mitglieder, sagt Vitrano, seien „latent“ jobsuchend, was das Netzwerk für die aktive Kandidatensuche so attraktiv mache. Er weiß, dass es nicht für alle Recruiter ein leichter Schritt ist, selbst in die Bewerberrolle zu schlüpfen. „Es ist sicher komfortabler, einfach zu warten, bis der richtige Bewerber kommt“, sagt er. „Aber das funktioniert heute eben nicht mehr, und dadurch wird es sicher auch oft anstrengender und intensiver. Wir sehen uns da auch in der Rolle, unterstützend zur Seite zu stehen.“ Nicht wenige Xing-Mitglieder lassen sich diese Unterstützung auch was kosten: Knapp jeder Zwölfte zahlt für eine Premiummitgliedschaft beim Netzwerk.
Rollentausch
Im Kampf um die Talente läuft es auf Xing für manche Talente inzwischen zu gut, nämlich für jene aus den besonders vom Fachkräftemangel betroffenen Branchen. Nicht wenige von ihnen würden inzwischen von Recruitern mit Angeboten bombardiert, berichtet Ralph Dannhäuser, „teilweise sind das dann 50 Anfragen pro Monat“. Was dazu führe, „das viele Schlagworte aus ihrem Profil entfernen – oder gleich das ganze Profil“. Paradoxerweise würden dadurch die Netzwerke aber für Personaler noch wichtiger, sagt Dannhäuser.
„In Zukunft werden mehr Stellen über persönliche Empfehlungen vergeben werden“, sagt er. Und meint damit, dass Recruiter die Kontaktdaten von potenziellen Kandidaten von Dritten empfohlen bekämen, um sie dann persönlich ansprechen zu können. „Die hören gar nicht erst zu, wenn sie nicht über eine persönliche Empfehlung an sie herantreten“, schildert Dannhäuser seine Erfahrungen. „Dafür brauchen sie weiterhin das Netzwerk.“ Recruiter und Kandidaten – sie hätten dann endgültig die Rollen getauscht.