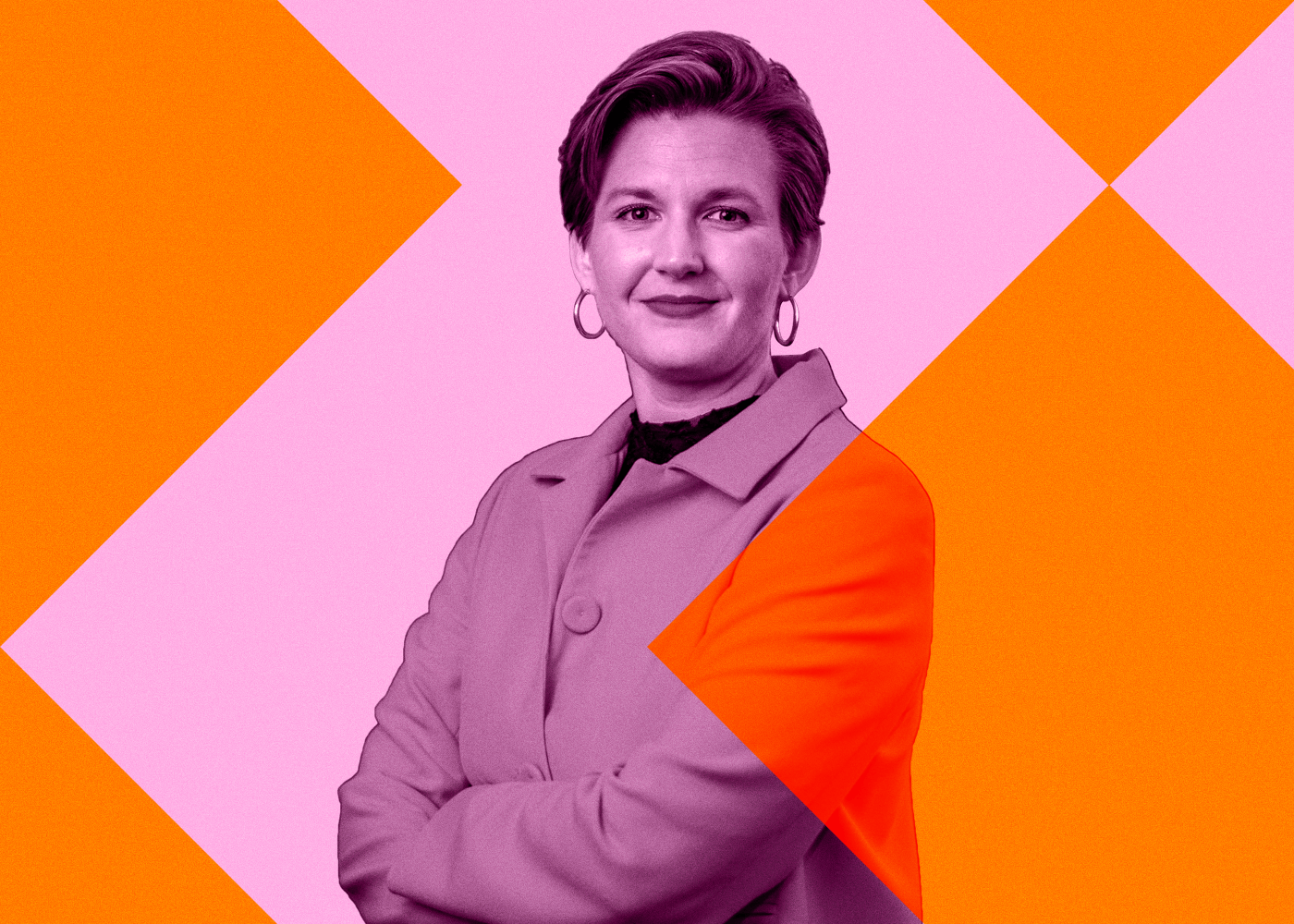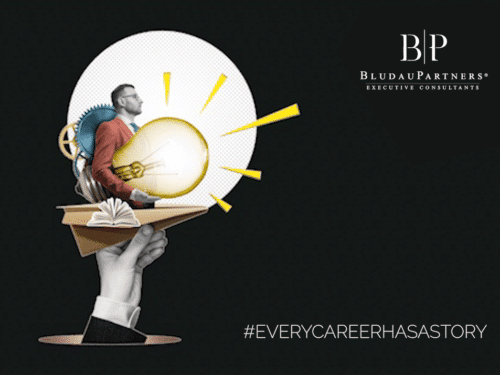Immer, wenn ich durch die Stadt laufe, sehe ich sie: Zombies, aka Smombies. Menschen, die wie versessen auf das Smartphone starren und ihre Umwelt kaum mehr wahrnehmen, während sie auf Bus, Bahn oder ihr Mittagessen warten. Manchmal gehöre ich dazu. „Du bist doch auch handysüchtig“, sage ich dann teils scherzend zu den anderen im Team, wenn mal wieder jemand alle zehn Sekunden auf das Display lugt.
Wir benutzen den Begriff „Sucht“ bisweilen umgangssprachlich und auch in humoristischer Weise, gerade in Bezug auf Elektronik, Arbeit, Süßigkeiten (Ich bin süchtig nach diesen Schokokeksen), ohne eine pathologische Sucht zu meinen. Was ist Sucht eigentlich, nach was können wir krankhaft süchtig werden und wo verläuft die Grenze zwischen noch im Rahmen oder suchtabhängig? Und: Welche Rolle spielt das für unsere Arbeitswelt?
Schauen wir uns das Gehirn und die Psychologie dahinter an: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert eine Suchterkrankung im Rahmen der ICD-10-Klassifikation als Resultat einer Fehlsteuerung des Belohnungssystems. Suchtmittel aktivieren verschiedene Botenstoffe, die zum Beispiel Wohlbefinden oder Euphorie auslösen, wodurch das Gehirn sehr schnell lernt, ein bestimmtes Suchtmittel als positiven Reiz wahrzunehmen. Eine Sucht ist also nicht einfach eine Charakter- oder Verhaltensnuance – wie zum Beispiel, dass jemand zu oft Schokokekse isst – sondern eine krankhafte Abhängigkeit von einem bestimmten Genuss- oder Rauschmittel oder Ähnliches, so der Duden. Süchte zeigen sich in verschiedenen Formen. Prototypisch denken wir beim Wort Sucht an die Abhängigkeit von illegalen Drogen beziehungsweise Substanzen, von Alkohol oder von Medikamenten. Allerdings existieren auch sogenannte nicht-stoffgebundene Arten von Sucht: Spielsucht, Kaufsucht, Arbeitssucht, Medienabhängigkeit, Hypersexualität, Zwangshorten und Essstörungen.
Die bei Erwerbstätigen am häufigsten vertretene Sucht-Art in Deutschland ist die Nikotinabhängigkeit (rund 4,4 Millionen Betroffene). Darauf folgen die Abhängigkeit von Medikamenten, die zwischen 1,5 und 1,9 Millionen Menschen betrifft, sowie die Alkoholabhängigkeit mit 1,6 Millionen Menschen.
Bei Suchtarten, die nicht stoffgebunden sind, erweist es sich als schwerer, die Daten zu erheben. Eine Bevölkerungsbefragung aus dem letzten Jahr kam zu dem Ergebnis, dass bei 2,3 Prozent der Befragten eine Glücksspielstörung vorliegt. Um das Thema Sucht, gerade im Kontext Arbeitswelt, noch besser zu verstehen, müssen wir uns die Frage stellen, wie wir Süchte erkennen und wo die Ursache von Suchtverhalten zu suchen ist, damit dies wirksam vorgebeugt oder behandelt werden kann.
Wenn das Gehirn zum Suchtgedächtnis wird
Bei einer Suchterkrankung spielen körperliche, psychische und soziale Faktoren eine wichtige Rolle. Die daraus resultierende Suchtkrankheit sehen wir als eine gelernte Reaktion an, die durch ein Suchtgedächtnis gelenkt wird. Der Transport von Botenstoffen äußert sich im limbischen System – der Teil des Gehirns, der für Schmerz, emotionales Verhalten und unser Wohlbefinden zuständig ist. An diesem positiven Zustand möchten die Betroffenen dauerhaft festhalten, und so können ehemals neutrale Reize, die mit dem Suchtmittel verbunden sind, unbewusste Reaktionen auslösen. Betroffene werden konditioniert und entwickeln ein Verlangen nach dem Suchtmittel. Dieses Verlangen ist für sie nicht kontrollierbar, da der Konsum die Glücksgefühle hervorruft und gleichzeitig Entzugssymptome lindert. Typische Suchtkriterien sind Kontrollverlust, Dosissteigerung und das Auftreten von Entzugserscheinungen.
Vom gelegentlichen Allnighter zur Arbeitssucht
Schauen wir uns nun die Arbeitssucht näher an: In vielen großen Unternehmensberatungen, Wirtschaftsprüfungen oder Kanzleien gilt von Beginn an, dass es im Team gelobt und somit implizit erwartet wird, mehr als zehn Stunden pro Tag zu arbeiten. Ist die Präsentation nicht fertig, wird Pizza bestellt und ein sogenannter Allnighter (Nachtschicht) eingeschoben. Wer in diesem System schwächelt, kommt nicht weiter. Es gilt die Regel: up or out. Zum Berufseinstieg lernen Menschen in diesen Kontexten, dass ein hohes (und nachgewiesen ungesundes) Pensum an Arbeit soziales Ansehen und Erfolg bedeutet. Hobbies, Familie und Freunde werden so weit heruntergeschraubt, dass Arbeit und Boni alleinige sinnstiftende Elemente im Leben werden. Dieses Verhalten ist vielerorts festgefahren und betroffene Personen verarmen sozial-emotional über die Jahre. Fünf-Sterne-Hotels, schicke Events und Reisen kompensieren das Gefühl, sodass diese Beschäftigten, wenn sie die Arbeit reduzieren wollen, eine innere Leere empfinden. Gelernte Belohnungen bleiben aus und schlimmstenfalls enden die Personen in der Burn-out-Klinik enden – klassische Suchtkriterien sind damit erfüllt.
Süchte betreffen nicht nur bestimmte Personengruppen, sondern Menschen in allen sozialen Schichten in ähnlichen Summen. Das ist wichtig zu betonen, denn oft wird Sucht mit Armut oder niedriger Bildung verbunden, um es aus dem eigenen Leben oder dem Arbeitskontext zu verdrängen. Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung sind rund zehn Prozent der Arbeitnehmenden in Deutschland von Arbeitssucht betroffen, insbesondere Selbstständige und Führungskräfte. Während die Geschlechtsverteilung recht ähnlich ist (10,8 Prozent Frauen, Männer neun Prozent) weisen die Altersgruppen größere Unterschiede auf: 12,6 Prozent der 15- bis 24-jährigen sind betroffen, während es bei den 55 bis 64-jährigen nur 7,9 Prozent sind. Allerdings muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass die Diagnosekriterien nicht einheitlich genug sind, um in Behandlung und Erforschung problemlos voranzukommen.
Permanente Erreichbarkeit
Dass überwiegend junge Arbeitnehmende betroffen sind, wirft die Frage auf, ob gesellschaftlicher Wandel und der Zustand der dauerhaften Erreichbarkeit daran eine Mitschuld haben. Als einer der größten arbeitssuchtfördernden Faktoren wird das Verschwimmen der Grenze zwischen Arbeit und Freizeit beschrieben. Die technologischen Fortschritte haben eine Erwartungshaltung der ständigen Verfügbarkeit erschaffen, welche durch die Corona-Pandemie und die Homeoffice-Option verstärkt wurde. Während es praktische Vorzüge wie das Einsparen des Arbeitsweges oder den Komfort des eigenen Sofas gibt, ist es eben auch schwierig, komplett abzuschalten. Dies ist häufig auch mit einem schlechten Gewissen verbunden. Richtige Pausenzeiten bleiben aus.
Smartphones können süchtig machen
Arbeitet eine Person viel mit ihrem Smartphone oder Computer, kann auch ein weiteres Suchtverhalten hinzukommen: eine Online-Abhängigkeit. Die pathologische Internetnutzung äußert sich durch eine hohe Nutzung in den Bereichen der Online-Videospiele und den sozialen Netzwerken. In diesem Bereich lässt sich das Suchtverhalten tatsächlich nach Geschlechtern differenzieren: Bei jungen Frauen überwiegt die hohe Nutzung von sozialen Medien, während Männer mehr Onlinespiele nutzen. Was allerdings einige überraschen mag, ist der Fakt, dass überwiegend Männer die bestehenden Beratungsangebote nutzen. Wenig überraschend, aber dennoch beunruhigend, ist die Anfälligkeit, die sich bei Kindern und Jugendlichen zeigt. Dies zeigt eine vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegebene Studie, die das Medienverhalten der Generation, die in einem bis dato nicht gekannten Maß mit elektronischen Medien aufwächst, untersucht. Laut dieser Studie hat mehr als jede sechste jugendliche Person Schwierigkeiten, die eigene Internetnutzung zu kontrollieren. Dazu kommen Probleme mit Hyperaktivität, Konzentrationsstörungen und Übergewicht.
Maßnahmen und Prävention
Die wichtigste Frage zum Schluss: Was kann dagegen getan werden? Aktuelle Ansätze zur Vorbeugung sind in zwei Kategorien unterteilbar: verhältnisorientiert und verhaltensorientiert.
Verhältnisorientierte Suchtprävention konzentriert sich auf die Veränderung von Umständen und Strukturen. Dies kann sich zum Beispiel darin äußern, keinen Alkohol in Kantinen auszuschenken und konsumfördernde Arbeitsbedingungen abzubauen. Kurz gesagt: das Arbeitsklima soll gesundheitsorientiert sein und alle gefährdenden Faktoren einschränken oder vermeiden. An dieser Stelle geht der Appell an die Lesenden aus Unternehmensführungen und Personalabteilungen, sich mit Unterstützung von Kranken- und Unfallkassen Pläne dieser Art zu überlegen.
Der verhaltensorientierte Ansatz setzt dagegen bei den Menschen selbst an, die durch Seminare und Aktionen in den Bereichen Fitness und Gesundheit aufgeklärt werden sollen. So sollen Mitarbeitende in die Lage versetzt werden, ihren Stress und ihre Konflikte auf einem gesunden Weg zu bewältigen und nicht den zunächst leichter scheinenden, aber ungesünderen Weg zu wählen.
Weiterführende Informationen und Hilfsangebote:
- Suchtberatungsangebote der Caritas
- Suchtberatung der DRK
- Verzeichnis der Suchtberatungsstellen
- Vorbeugung & Prävention – Sucht am Arbeitsplatz (sucht-am-arbeitsplatz.de)
- Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V.
- KiGGS – Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
Weitere Beiträge aus der Kolumne:
- Die Angst kommt in 23 Minuten
- Sprache als Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Macht Sprache krank?
- Meltdown am Main
- „Ich habe keine Depression, das war ein Burnout“
- Tinnitus – Stille kann so laut sein