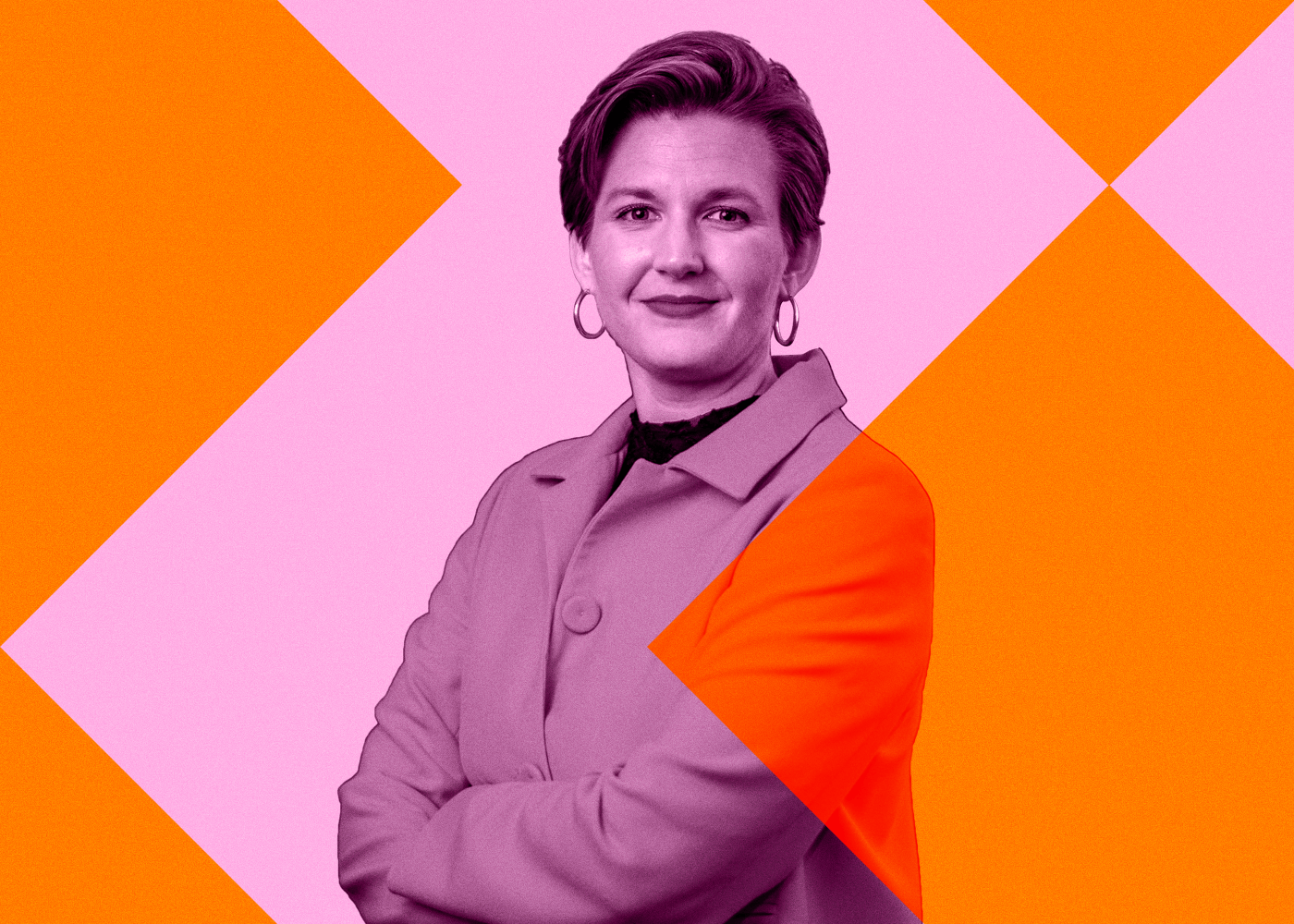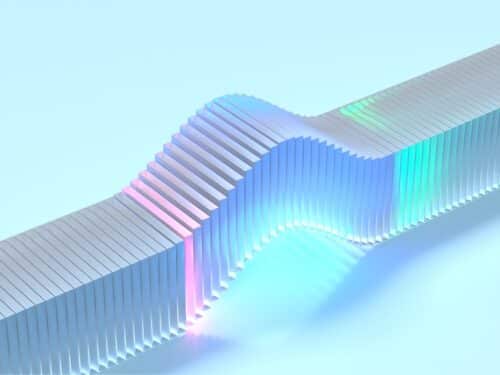Ich bin immer mal wieder down, gekränkt, traurig, antriebslos. Ich nenne das „muscheln“. Ich bin eine Kontaktmuschel, sage ich dann, fast im Scherz zu mir selbst, wenn ich mich einmal wieder extrem sozial zurückziehe und Mühe habe, morgens aufzustehen (was ich irgendwie immer schon habe). Wenn die Sonne dann auch noch scheint, empfinde ich es als Verhöhnung. Das Handy ertrage ich kaum. Auch von anderen aus meinem Team kenne ich das und wir nennen diesen Zustand fast liebevoll „depressive Episode“, das macht ihn weniger schlimm. Zum Glück bin ich jedes Mal wieder einigermaßen heil aus meiner Muschel gekrochen gekommen. Aber nicht allen geht es so.
Liegen über zwei Wochen mindestens fünf Symptome, darunter ein Hauptsymptom vor, könnte es sich um eine Depression handeln. Hauptsymptome sind beispielsweise eine gedrückte Stimmung oder Interessen- und Freudlosigkeit. Zusatzsymptome können Antriebsmangel, erhöhte Ermüdbarkeit, verminderte Konzentration, verringertes Selbstwertgefühl, Hoffnungslosigkeit, Schlafstörungen, veränderter Appetit, Unruhe oder Suizidgedanken sein (siehe auch Diagnose der Depression – Stiftung Deutsche Depressionshilfe, deutsche-depressionshilfe.de). Depressionen können sich aber auch körperlich durch Kopf- und Rückenschmerzen, Energielosigkeit, Abgeschlagenheit sowie Magen-Darm-Problemen äußern. Bei mir waren es vor allem der Kopf- und brennende Rückenschmerz (ich nannte ihn Dolchschmerz), der mich zahlreiche medizinische Praxen aufsuchen ließ.
Depressiv oder Burnout?
Burnout als Ausdruck körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung wird im Alltag oft synonym für den Begriff Depression verwendet, weil er weniger stigmatisierend wirkt und paradoxerweise immer noch mit besonders hoher Leistungsbereitschaft in Verbindung gebracht wird. In manchen Branchen gehört es fast zum guten Ton, auch mal ausgebrannt gewesen zu sein. Die Symptome sind nahezu dieselben, wenn in Manager-Biographien über das B-Wort reflektiert wird. Auch Komiker Alexander Bojcan (besser bekannt als Kurt Krömer) hatte gerade hierzu sein Coming-out mit seinem Buch Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Meine Depression.
Doch auch außerhalb (toxischer) Arbeitswelten sind Menschen von Depressionen betroffen, gerade die jungen. Laut aktuellem Unicef-Bericht zur Situation der Kinder in der Welt gibt auch zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie jede fünfte Person zwischen 15 und 24 Jahren an, deprimiert oder antriebsarm zu sein. Der aktuelle Axa-Mental-Health Report zieht ein ähnliches Resümee: 60 Prozent der 18- bis 34-Jährigen verzeichnen ein mäßiges bis hohes Depressionslevel im Vergleich zur älteren Generation (44 Prozent bei den 55- bis 64-Jährigen, 24 Prozent bei den 65- bis 75-Jährigen). Besonders brisant ist der zu beobachtende Gender Bias, denn (junge) Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Vor allem Mütter litten noch stärker als Frauen ohne Kinder, wenn sie ohne Kinderbetreuung und pandemiebedingte Auszeiten auskommen mussten.
Corona, Krise, Krieg
Nach der (Post-)Corona-Krise kam der Krieg gegen die Ukraine und trübte weiterhin kollektiv unseren Gemütszustand. Wir fühlen uns weiterhin zu nah, zu betroffen und gleichzeitig zu hilflos. Laut der Berliner Trendstudie Jugend in Deutschland – Sommer 2022 gaben 45 Prozent der Befragten an, diesbezüglich Stress zu erleben. 13 Prozent nannten Hilflosigkeit und 7 Prozent sogar Suizidgedanken.
Da ist es nicht verwunderlich, dass Psychotherapiepraxen weiterhin lange Wartelisten melden. Leider vergeht auch deswegen bis zum Beginn einer Behandlung oftmals viel Zeit. Die Gründe hierfür sind vielfältig: weil die Betroffenen niemanden finden; weil sie sich den Unterstützungsbedarf nicht eingestehen wollen; weil sie sich schämen; oder, weil sie schlichtweg nicht die Kraft aufbringen können, professionelle Hilfe aufzusuchen. Auch das ist ein neuralgischer Punkt beim Thema Depression: die Antriebslosigkeit, die selbst den Gang zur Behandlung versperrt.
Die Couch ist so weit weg
In meiner Jugend habe ich oft sogar den Weg zwischen meinem Bett und der Couch als zu lang empfunden. Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell besagt, dass eine gewisse Verletzlichkeit einer psychischen Erkrankung immer voraus geht, also auch einer Depression. Bestimmte biologische Eigenschaften und persönlich einschneidende Lebenserfahrungen können sie begünstigen. Wird zusätzlich starker Stress erlebt, kann das berühmte Fass zum Überlaufen gebracht und eine Erkrankung auslöst werden. Verletzlichkeit und Stressempfinden werden dabei individuell erlebt. Bei mir war es wohl der Tod meiner ersten Haustiere – zwei Zwergkaninchen -, für den ich mich jahrelang mitverantwortlich fühlte, und so wurde meine kognitive Maschinerie in Gang gesetzt. Aber so wirklich wissen die Experten, Wissenschaftlerinnen und ich es auch nicht. Depressionen entstehen aus einem komplexen Zusammenspiel biologischer, psychologischer, kultureller und gesellschaftlicher Faktoren.
Ich hatte jedoch schon damals den Wunsch, Dinge zu beeinflussen und zu kontrollieren – auch diejenigen, die sich meiner Kontrolle entzogen. Was blieb: Schuld und gefühlte Leere. Diese Kopplung beschreiben übrigens auch viele Menschen im Job: Sie haben ein starkes Perfektions- und Kontrollstreben, wollen eigene (Leistungs-)Grenzen nicht akzeptieren und haben das Gefühl der Unentbehrlichkeit. Schaffen sie nicht, dem zu genügen, fühlen sie sich wertlos und schuldig. Persönliche Stressverstärker mit hoher Bedeutung können auch sein, es allen recht machen zu wollen sowie krampfhaft Harmonie zu suchen. Gerade, wenn die Arbeit als sinnstiftend wahrgenommen wird, können wir daraus viel Kraft schöpfen. Eine zu hohe andauernde Arbeitsbelastung kann jedoch das Risiko, an Depressionen zu erkranken, um 50 Prozent erhöhen.
Was Arbeitgeber tun können
Heute bin ich zum Glück ein Stück weiter und kann Dinge differenzierter erkennen. Aus meiner Firma weiß ich: Eine offene Arbeitsatmosphäre und achtsame Personalverantwortliche erleichtern erkrankten Mitarbeitenden den Weg – egal wo sie stehen. Ein wesentliches Element zur Sicherstellung der betrieblichen Gesundheit ist hierbei die psychische Gefährdungsbeurteilung. Darüber hinaus können Arbeitgeber freiwillig gesundheitsfördernde Maßnahmen anbieten, welche nachweislich zu höherer Motivation und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten beitragen. Wir haben hierzu nicht nur ein vierteljährliches Team-Event eingeführt, in dem sich alle auskotzen dürfen, sondern auch einmal pro Woche angeleitetes Yoga im Büro. Unsere zwei Bürohunde tun unseren Seelen auch gut. Am Ende bleibt mal wieder die Sprache: Nachfragen, wenn es jemanden nicht gut geht, die Person länger als üblich krank ist oder sich anders als sonst verhält. Auch mit einfachen sprachlichen Mitteln können wir Stigmatisierungen entgegenwirken. Der Ansatz der People-First-Language stellt eine Person vor die Diagnose und beschreibt somit, was eine Person „hat“ anstelle, was diese Person vermeintlich „ist“. Zum Beispiel: eine Person wird mit Depression diagnostiziert, eine Person hat Depressionen oder eine Person hat eine depressive Episode. Durch die Verwendung einer solchen Satzstruktur wird die Diagnose zum sekundären Attribut und nicht zum primären Merkmal der Identität einer Person (in: die Person ist depressiv, depressive Menschen ).Apropos „depressive Episode“: Episode bezeichnet auch, dass es zeitlich begrenzt ist. Das gibt Hoffnung.
Quellen zum Weiterlesen:
Diagnose der Depression – Stiftung Deutsche Depressionshilfe (deutsche-depressionshilfe.de)
praxishilfe-psychisch-krank-im-job.pdf (deutsche-depressionshilfe.de)
Depression und Arbeit – Stiftung Deutsche Depressionshilfe (deutsche-depressionshilfe.de)
Depressionen im Berufsleben – Morgenmagazin – ARD | Das Erste
Depression und Angstzustände: Alle elf Minuten nimmt sich ein junger Mensch das Leben | MDR.DE
Axa Mental Health Report 2022 / AXA
Weitere Beiträge aus der Kolumne: