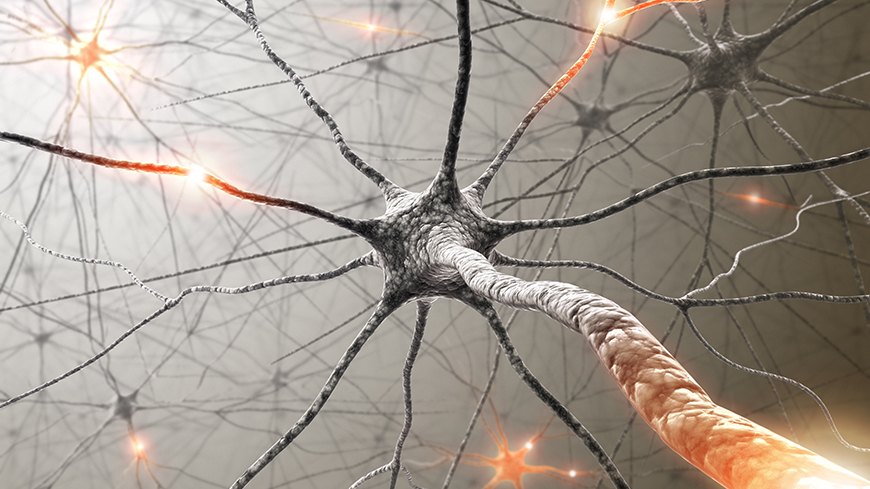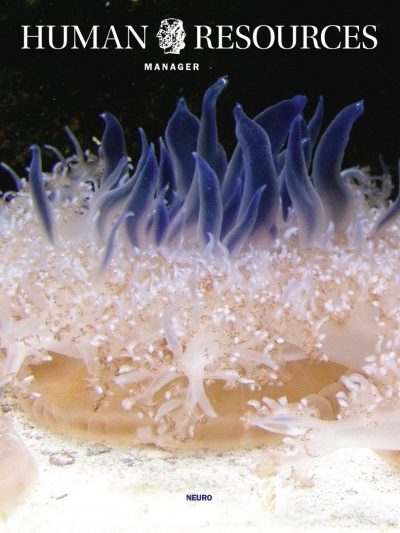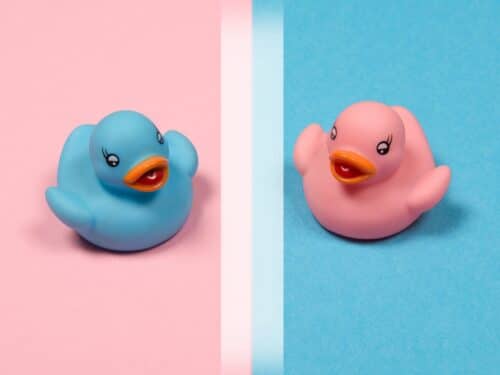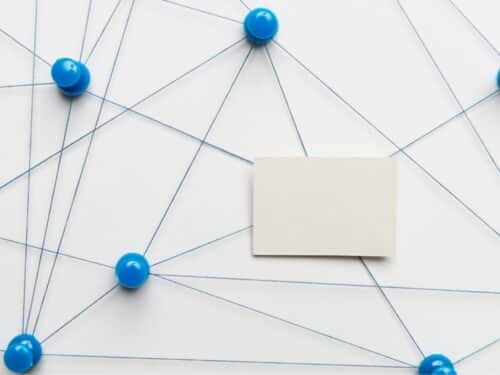Künstliche neuronale Netze können die Mimik von Bewerbern lesen und deren Anschreiben analysieren. Doch ihr Einsatz ist noch wenig verbreitet. Der menschenfreie Recruiting-Prozess liegt in weiter Ferne.
Kaum eine Woche vergeht, in der keine Meldung zu künstlicher Intelligenz (KI) in der Personalarbeit erscheint. Die einen preisen sie an als die Zukunft des Recruitings, die anderen verteufeln sie, weil Ethik und Datenschutz auf der Strecke bleiben. Schließlich könnte zukünftig ein künstlich intelligenter Computer menschliche Entscheidungen übernehmen, Bewerbern absagen oder sie einstellen – so weit die Theorie. Zwar kommen Algorithmen in der Personalauswahl bereits zum Einsatz, aber von KI mit eigener Entscheidungsmacht ist man noch weit entfernt. Zum Glück, möchte man fast sagen. Denn die heutige Qualität und Aussagekraft mancher vermeintlich intelligenter Lösungenüberzeugt noch nicht. Seien es Online-Anzeigen für ein Produkt, das man längst, natürlich online, gekauft hat, oder Jobvorschläge von Business-Netzwerken, die nicht einmal in die Nähe eigener Präferenzen kommen: Sollte eine KI das nicht besser können? Wo sind die automatisierten Stellenangebote, die perfekt zum Lebenslauf passen? Ganz zu schweigen von dem finalen Match nach einem Auswahlverfahren zwischen Mitarbeiter und Unternehmen. Um in der Personalauswahl valide Aussagen zu treffen, braucht es etwas mehr als nur große Datenmengen. Es bedarf einer Brücke zwischen Ergebnisanalyse und dem Treffen einer Entscheidung.
Im Rahmen der Vorauswahl kommen häufiger Algorithmen zum Einsatz, vor allem bei Jobprofilen mit hohem Bewerberaufkommen. Anhand definierter Kriterien übernehmen sie im ersten Schritt die Auswahl von Kandidatenprofilen.
Künstliche neuronale Netze – ein Teilbereich der KI und Unterbereich des maschinellen Lernens – könnten hingegen weitaus mehr leisten. Sie kommen unter anderem in der Sprach- und Bilderkennung zum Einsatz und können Mimik oder Mikroausdrücke ablesen und Texte analysieren.
Künstliche neuronale Netze versuchen also die Funktionsweise des menschlichen Gehirns nachzubilden und auf Basis dessen Entscheidungen zu treffen. Dabei nehmen sie mithilfe sogenannter Input-Neuronen Informationen von außen auf, nachgelagerte Ebenen an Neuronen verarbeiten diese und geben am Ende ein Ergebnis aus. Das Netzwerk kann aus großen Datenmengen Erkenntnisse ziehen und sich selbst weiterentwickeln.
Bezogen auf die Personalauswahl benötigt ein künstliches neuronales Netzwerk aber etwa 1.000 Datenpunkte pro Berufsfeld. Beim maschinellen Lernen sind es nur rund 100, sagt Katharina Zweig, Professorin am Fachbereich Informatik der Technischen Universität Kaiserslautern. Besonders kleine und mittlere Unternehmen verfügen in der Regel nicht über diese Datenmengen. Warum sollte HR überhaupt künstlich intelligente Lösungen einsetzen wollen? „Eine KI erstellt Muster auf Basis von Vergangenheitsdaten und leitet daraus Entscheidungen ab“, sagt die Wissenschaftlerin. Die Idee dahinter: Daten zu finden, die statistisch häufig vorkommen. Analysiert eine KI Bewerberdaten eines Unternehmens der letzten Jahre, erkennt sie den „erfolgreichen“ Bewerber, der sich in der Vergangenheit im Unternehmen bewährt hat, und wählt diesen unter den neu eingegangenen Bewerbungen wieder aus. Die Folge: Der Arbeitgeber stellt einen ähnlichen Typus ein. Zweig empfiehlt, sich in jedem Fall anzuschauen, welcher Typus es in den letzten Jahren ins Unternehmen geschafft hat – und das als weiteres Entscheidungskriterium aufzunehmen. Denn diesen Effekt sollte eine KI am wenigsten verstärken.
Zweig bemängelt, dass eine künstliche Intelligenz weder Ideen voranbringt, noch ist sie divers. Zwar soll sie im Recruiting Neutralität gewährleisten, schließlich ist sie vermeintlich frei von menschlichen Vorannahmen, aber KI lernt auf Basis von Daten früherer Auswahlentscheidungen. In ihrem Buch „Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl“ folgert Zweig entsprechend: Ein System kann diskriminieren, wenn es feststellt, dass manche Personen in der Vergangenheit weniger häufig eingestellt wurden.
Lücke zwischen Datenmuster und Bedeutung für den Job
„Künstliche neuronale Netze in der Personalauswahl sind eine Blackbox“, sagt Sara Lindemann, Head of Customer Success und Mitgründerin von Viasto, einem Anbieter für Video-Recruiting-Software. Um das Zukunftspotenzial von Kandidaten zu erkennen, brauche es eine gute Datenqualität und große Datenmengen, die permanent weiter angereichert werden. Es sei jedoch unklar, ob die Vorhersagen nicht auf einer Datenverzerrung beruhen. So liegen Angaben zu eingestellten Kandidaten und deren Karrierewegen vor. Aber was ist mit denen von abgelehnten Bewerbern? Wären sie vielleicht ebenso vielversprechend gewesen oder gar erfolgreicher? Diese Daten müssten Unternehmen für valide Aussagen miteinbeziehen, nur liegen sie nicht vor, meint Lindemann. Ebenso gelte es, weitere Faktoren zu berücksichtigen, wie eventuelle Firmenkrisen oder Führungswechsel. Und so viele Daten stünden vermutlich niemandem zur Verfügung. Lindemann sieht zudem ein methodisches Problem bei der Nutzung von KI in der Personalauswahl: Nur weil jemand durch eine KI-Anwendung Daten zur Intelligenz oder Persönlichkeit eines Kandidaten generiert, kann er trotzdem nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, was das nun für die Leistungsfähigkeit des Kandidaten auf der Stelle bedeutet, für die er rekrutiert wurde. Bei allen KI-Anwendungen fehle derzeit das Validierungskriterium, also Daten darüber, welche Kandidaten später „on the Job“ wirklich erfolgreich waren. Das größte Potenzial liege also darin, die Datenmuster dahingehend zu überprüfen, was sie für die Performance eines Kandidaten in der konkreten späteren Aufgabe bedeuten.
Dieser Sachverhalt ist nicht neu. So versprechen Verfahren der Eignungsdiagnostik seit Jahrzehnten, eine Aussage über die Persönlichkeit eines Bewerbers treffen zu können. Aber welche Bedeutung dieses Ergebnis für die Berufseignung hat, bleibt häufig unbeantwortet. „Persönlichkeitstests gibt es bereits, KI ändert aktuell lediglich die Art der Datenerfassung“, sagt Lindemann. Das methodische Problem, diese identifizierten Muster zu validieren und eine Entscheidung abzuleiten, bleibe bestehen. Die Entwicklung eines zuverlässigen Systems stelle eine große Herausforderung dar. Bevor die Validierungsfrage nicht geklärt ist, sieht sie momentan noch keine zuverlässige Möglichkeit, den tatsächlichen Erfolg eines Kandidaten durch KI-Anwendungen besser vorherzusagen, als es bereits vorhandene Tests und Methoden können.
Produktivitätsgewinn und Business-Nutzen
„Menschen ermüden, Maschinen nicht“, sagt Markus Dahm, Manager Digital Change & Transformation bei IBM und Professor an der FOM Hochschule. Das sei auch der Grund für das Interesse an KI auf Unternehmensseite. Schließlich hat HR große Datenmengen zu bewältigen. Im Recruiting trifft das vor allem auf Arbeitgeber mit einer hohen Anzahl an Bewerbern zu. Dahm zufolge ist der Einsatz von KI insbesondere bei der Vorauswahl aus zwei Gründen nützlich: Einerseits verzeichnet das Unternehmen einen Produktivitätsgewinn. Tools als Hilfsmittel ermöglichen einen höheren Durchlauf an Bewerbern und steigern die Effizienz. Andererseits erreicht HR eine Standardisierung der Personalauswahl, was zu einer höheren Qualität führen kann. Eine eigenständig entscheidende KI sieht Dahm jedoch nicht. Sie könne den Personaler lediglich dabei unterstützen, bessere Entscheidungen zu treffen. Gerade in Deutschland sei der Personalbereich durch Menschen und ihre empathische Komponente geprägt. Und der Einsatz künstlicher Intelligenz löse nicht selten Diskussionen hinsichtlich Datenschutz und Ethik aus.
Inwiefern in der Personalauswahl eine KI zum Einsatz kommt oder nicht, hängt für Dahm immer mit einem Punkt zusammen: dem Business Need. Nur weil Firma A einen Chatbot nutzt, braucht Firma B noch lange keinen. Die Einführung solcher Lösungen setzt eine Prüfung des betriebswirtschaftlichen Bedarfs voraus. Es muss also ein konkreter Nutzen für das Unternehmen ersichtlich sein. Die KI muss dann spezifisch auf das Unternehmen trainiert sein. Sonst kommt weder die Unternehmens- noch die Weiterentwicklungskultur zum Tragen. Der Experte weiß: Kleinere Unternehmen tun sich mit individuellen Lösungen schwer. Das sei auch eine Kostenfrage. Doch über welche Aussagekraft Standardlösungen verfügen, wenn sie keine individuellen Daten einbeziehen, bleibt fraglich. Dahm prognostiziert, dass sich auf dem HR-Software-Markt manche Anwendungen weiterentwickeln und durchsetzen, andere wiederum verschwinden werden. Ganz ohne menschlichen Einfluss wird HR auch in Zukunft nicht auskommen. Bei allen Fortschritten, die Systeme machen, ist seine Beobachtung, dass sie immer etwas mit Menschen zu tun haben.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Neuro. Das Heft können Sie hier bestellen.