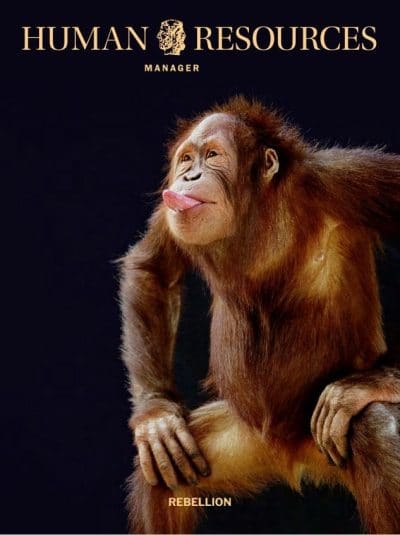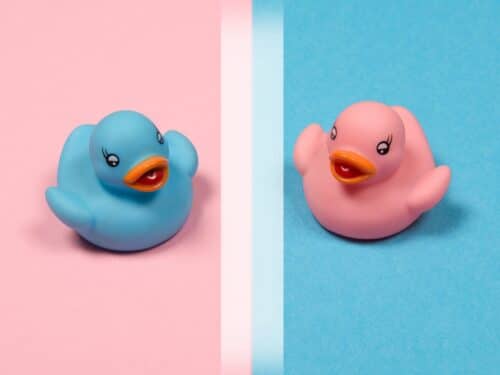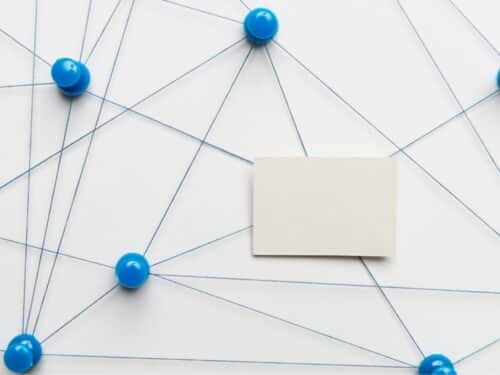Wenn Alter, Geschlecht und Herkunft in der Bewerbung nicht ersichtlich sind, liegt der Fokus auf den Kompetenzen der Person und sie wird weder bewusst noch unbewusst diskriminiert. So lautet die Idee von anonymen Bewerbungen. Können sie Unternehmen tatsächlich dabei helfen, mehr Diversität in die Belegschaft zu bringen?
Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass vielfältig aufgestellte Teams besser performen. Bereits 2015 zeigte eine Studie von McKinsey, dass Unternehmen mit hohem Frauenanteil im Topmanagement höhere Umsätze erzielen als ihre männlich geprägte Konkurrenz. Auch unterschiedliche Altersgruppen sowie kulturelle und soziale Hintergründe eröffnen neue Perspektiven und können so zu besseren Ergebnissen führen. Zudem trägt Inklusion, also die gleichberechtigte Teilhabe aller, zu einem positiven Image als Arbeitgeber bei. Die Mehrheit der Unternehmen ist deshalb bemüht, sich so vielfältig wie möglich aufzustellen. Wäre da nicht das, was die Kognitionspsychologie Unconscious Bias nennt – eine unbewusste Voreingenommenheit aufgrund der eigenen sozialen Prägung, die jeder Mensch in sich trägt. Sie führt zum Beispiel dazu, dass Recruitingverantwortliche und Hiring Managerinnen Bewerbungen von Menschen mit ausländisch klingendem Namen gleich auf den Ablagestapel legen oder wegklicken, auch wenn sie gar nicht bewusst fremdenfeindlich eingestellt sind. So wurde in einem Experiment des IZA Institute of Labor Economics eine Bewerberin mit dem gleichen Lebenslauf wesentlich seltener zum Jobinterview eingeladen, wenn ein türkischer statt ein deutscher Name darüber stand – und noch seltener, wenn sie auf dem Bewerbungsfoto ein Kopftuch trug.
Dieser Denkfehler kann zumindest im ersten Schritt ausgeschaltet werden, indem Bewerbungen anonymisiert werden, indem auf das Foto und auf persönliche Angaben wie Name oder Geburtstagdatum verzichtet wird. Das kann beispielsweise mittels anonymisierter Online-Fragebögen umgesetzt werden. Alternativ können auch einfach die persönlichen Angaben im Lebenslauf geschwärzt werden – oder das Unternehmen fordert potenzielle Arbeitskräfte dazu auf, eine Bewerbung ohne Namen, Foto und Geburtsdatum von einer neutralen E-Mail-Adresse aus zu schicken.
Vor ungefähr zehn Jahren testeten in einem Pilotprojekt drei öffentliche Arbeitgeber und fünf Unternehmen ein Jahr lang anonymisierte Bewerbungsverfahren. Obwohl sich in dem Projekt für Frauen und Menschen mit Wurzeln im Ausland die Chance auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erhöhte, blieb kaum ein Unternehmen bei der Methode. Auf unsere Anfrage nannten sie unter anderem als Gründe, dass die Diversität nicht gestiegen sei, dass die Individualität der Bewerbungen dabei verloren ginge oder auch ein unverhältnismäßiger Mehraufwand zutage trat. Sind diese Argumente immer noch valide oder lohnt es sich, anonymen Bewerbungen eine zweite Chance zu geben?
Niemand ist frei von Zuschreibungsmustern
Das Kultur- und Medienunternehmen Kooperative Berlin verlangt seit etwa anderthalb Jahren anonyme Bewerbungen ohne Namen, Foto und persönliche Angaben. Dann folgt für die engere Auswahl erst einmal ein Telefoninterview. „Die Personen sehen wir im persönlichen Gespräch zum ersten Mal“, sagt Gründer Oliver Baumann-Gibbon. „Wir haben gemerkt, dass da ganz andere Menschen kommen, wenn man gewisse Rahmendaten ausschaltet und nur auf die Kompetenzen und den Berufsweg schaut. Es ist schließlich niemand frei von sozialisierten Zuschreibungsmustern.“ Dadurch hätte beispielsweise eine Kandidatin eine Chance bekommen, die man sonst vermutlich für zu jung gehalten und gleich aussortiert hätte. „Unser Team ist auf jeden Fall diverser geworden.“
Anonyme Bewerbungen reichen aber auf keinen Fall als einzige Maßnahme für mehr Diversität. „Vielleicht schaffen es so mehr Personen durch das erste Raster. Der erste Schritt ist im Bewerbungsprozess sehr wichtig,“ sagt Eva Voß, Head of Diversity, Inclusion and People Care Germany and Austria bei der Großbank BNP Paribas. „Spätestens im persönlichen Gespräch setzt aber wieder der Unconscious Bias ein.“ Wichtig sei es deshalb, dass die Menschen, die die Entscheidungen treffen, sich ihre Vorurteile bewusst machen und regelmäßig entsprechend geschult werden.
Allerdings können anonyme Bewerbungen laut Voß auch ein Hindernis für mehr Diversität sein. Nicht nur, weil hier die Möglichkeit wegfällt, sich bewusst für bestimmte Zielgruppen zu öffnen oder etwa nach einer Geschlechterquote vorzugehen. Auch Menschen mit lückenhaftem oder mosaikartigem Lebenslauf könnten hier bereits im Vorfeld aussortiert werden und nie die Chance bekommen, ihre Stationen zu begründen. „Eine Lücke wegen der Pflege eines Angehörigen würde ich zum Beispiel nicht als Manko, sondern als Kompetenz sehen“, sagt Voß. Gleiches gelte für Personen, die länger für ihr Studium gebraucht haben, weil sie nebenher für ihren Lebensunterhalt arbeiten mussten. Anonyme Bewerbungen könnten sich deshalb beispielsweise für Menschen aus sozial schwachen Verhältnissen oder Menschen mit einer chronischen Erkrankung nachteilig auswirken, eben weil der Kontext fehlt. Es kommt hierbei aber auch auf die Einstellung der Hiring Manager und Recruiterinnen an. „Wir können auch aus anonymen Lebensläufen ganz gut herauslesen, ob wir die Menschen dahinter spannend finden“, sagt Oliver Baumann-Gibbon von der Kooperative Berlin. Lücken und Brüche machen Bewerberinnen und Kandidaten seiner Meinung nach viel interessanter als ein glatt gebügelter Lebenslauf.
Es stellt sich außerdem die Frage, wie anonym eine Bewerbung überhaupt sein kann. Aus den Sprachkenntnissen oder dem Namen der Schule können Rückschlüsse auf die Herkunft der Person gezogen werden. Doch auch darin sieht Baumann-Gibbon kein Problem: „Selbst wenn ich Rückschlüsse ziehe, beschäftige ich mich in dem Moment bereits aktiv mit der Person. Schon allein das führt zu ganz anderen Ergebnissen, als es ein nichtanonymer Lebenslauf mit Foto getan hätte.“
Das setzt voraus, dass Entscheiderinnen und Recruiter sich für jeden Lebenslauf Zeit nehmen können, was schwierig ist, wenn sehr viele Stellen auf einmal besetzt werden sollen. Diversity-Managerin Voß schlägt hier vorgelagerte Tests oder auch Assessmentcenter als neutrale und aussagekräftige Tools vor. Außerdem könne sie sich vorstellen, dass gerade große Unternehmen in Zukunft mehr mit künstlicher Intelligenz arbeiten würden.
Diversität dank Automatisierung
Diesen technikgetriebenen Ansatz verfolgt Morten Babakhani, CEO der Managementberatung Brandmonks. Mit dem Ziel, Unternehmen durch vorurteilsfreies Recruiting vielfältiger zu machen, hat er zusammen mit seinem Team das Recruiting-Tool Flynne entwickelt. Eine künstliche Intelligenz trifft eine Vorauswahl geeigneter Kandidatinnen und Anwärter und fragt dabei weder demografische Daten noch den Lebenslauf ab. „Wir sind davon überzeugt, dass weder Abschlussnoten noch Lücken im Lebenslauf oder vergangene Misserfolge entscheidend dafür sind, ob eine Person für einen Job geeignet ist“, sagt Babakhani. Auch Alter, Geschlecht oder Herkunft fallen als potenzielle Diskriminierungsfallen weg.
In einer interaktiven Kompetenzreise erfragt Flynne die Hard Skills, wie zum Beispiel im IT-Bereich Programmiersprachen, analysiert aber auch soziale Kompetenzen wie Teamorientierung, Motivation oder Durchhaltevermögen. Dazu fragt das Tool zum Beispiel eine Situation ab, in der die Person ein Projekt gestartet und zu Ende geführt hat oder Hindernisse überwunden hat. Diese Situation muss auch nicht unbedingt aus dem Berufsleben sein. „Es geht darum, herauszufinden, wie die Person tickt, also zum Beispiel: Sucht sie Probleme oder sucht sie Lösungen?“ Dieser erste Schritt kostet die Kandidaten und Bewerberinnen nur wenige Minuten. Die KI trifft dann eine Vorauswahl, basierend auf den Eigenschaften von den Besten der Besten. Die Daten, auf denen das Programm basiert, wurden innerhalb von drei Jahren im Rahmen diverser Pilotprojekte gesammelt. Unternehmen können dann die ausgewählten Personen kontaktieren und sie zum Interview einladen. Bis zum ersten persönlichen Gespräch bleiben sie anonym. Da dem Tool keine demografischen Daten der Personen bekannt sind, verringert sich das Risiko, dass die KI den menschlichen Bias imitiert und beispielsweise basierend auf den Daten aus der Vergangenheit nur Männer für Führungspositionen vorschlägt. „Eine KI ist nur so intelligent wie die Menschen, die sie programmiert haben“, sagt Babakhani. Es sei wichtig, die Algorithmen regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls weiter zu trainieren.
Die künstliche Intelligenz könne die menschliche Intuition aber auf keinen Fall ersetzen. Sie unterstützt den Menschen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Am Ende entscheidet immer ein Mensch, wer eingestellt wird. Bereits in dem ersten Pilotprojekt von Flynne für Consulting-Berufe bei SAP war fast die Hälfte der Teilnehmenden weiblich, was für die sonst männerdominierte IT-Branche beachtlich ist. Morten Babakhani weist allerdings darauf hin, dass Unternehmen nicht erst in der Personalauswahl an Diversity denken sollten. Man müsse die gesamte Kommunikation so gestalten, dass sich eine diverse Zielgruppe angesprochen fühlt – in Stellenbeschreibungen, in der Erstkontaktaufnahme und in der Interviewführung.
Nur ein Baustein für mehr Vielfalt
Auch Eva Voß rät, sich anzusehen, an welchem Punkt im Bewerbungsprozess die Vielfalt verloren geht. Das fange häufig schon mit Formulierungen in Stellenausschreibungen an. „Wenn ich ‚Geschäftsführer (m/w/d)‘ lese, habe ich definitiv eher einen Mann im Kopf und bewerbe mich als Frau vielleicht nicht.“ Besser sei es, den Titel zu gendern. Auch könne es problematisch sein, wenn zu viele Anforderungen in der Jobbeschreibung stünden – Frauen tendierten im Gegensatz zu Männern dazu, sich nur dann zu bewerben, wenn sie allen Anforderungen entsprechen. Wichtig sei es vor allem, dass Unternehmen sich fragen, wen sie suchen und wie man diesen Personen gezielt vermitteln könne, dass sie im Unternehmen willkommen sind.
Auch bei der Kooperative Berlin sind anonyme Bewerbungen nur ein Baustein für mehr Diversität. Es gibt auch andere Maßnahmen wie verpflichtende Bias-Schulungen. Doch das Beispiel zeigt: Anonyme Bewerbungen fördern den bewussten Umgang mit Vielfalt. Sie sind für Unternehmen, die die zeitliche Kapazität haben, deshalb durchaus einen Versuch wert. Welche Methode sie dabei wählen, kommt auf die Unternehmensgröße und die individuellen Ziele an. Dennoch bleibt die Notwendigkeit, dass jeder einzelne Mensch sich permanent die eigenen Vorurteile bewusst macht und revidiert. Führungskräfte und HR sollten hier als gutes Beispiel vorangehen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Rebellion. Das Heft können Sie hier bestellen.