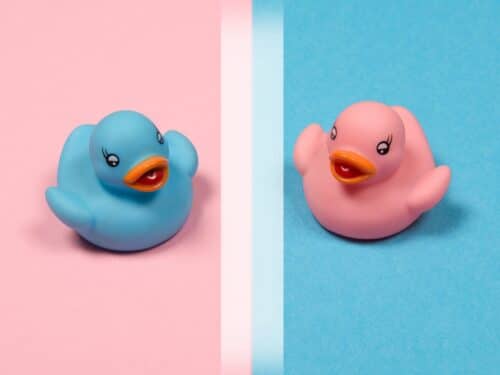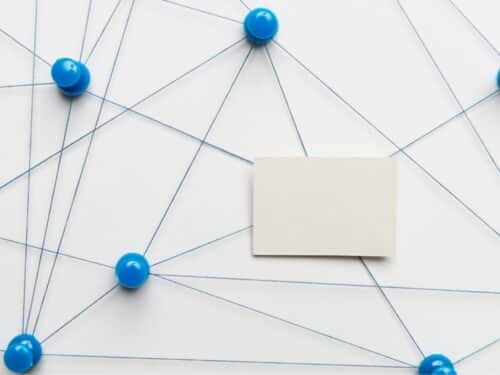Nicht jeder eignet sich für einen risikoreichen Job. Eignungsdiagnostik kann helfen, geeignete Mitarbeiter zu finden. Doch damit ist es nicht getan.
Ob Polizisten, Rettungskräfte oder Höhenarbeiter: Sie alle üben einen Job aus, der einen hohen Einsatz abverlangt. Nahezu alltäglich sind sie mit Situationen konfrontiert, die eine Gefahr für das eigene Leben darstellen können. Fest steht: Im Ernstfall kommt es auf das richtige Verhalten an. Vieles davon ist zu trainieren, anderes eine Sache der Persönlichkeit. Via Eignungsdiagnostik lässt sich erfassen, welche Persönlichkeiten Stresssituationen besser handhaben können als andere. Doch unabhängig vom Risikoempfinden des Einzelnen kommt es auf eines ganz besonders an – den Arbeitgeber. Denn in seiner Verantwortung liegen die Sicherheit und die Unterstützung der Mitarbeiter.
Wer ist besonders gefährdet?
Gefahren im Beruf sind an unterschiedlichen Faktoren auszumachen – an erkennbaren und persönlich empfundenen Risiken sowie an der statistischen Unfallhäufigkeit. Die Liste der Jobs mit erhöhtem Risiko ist lang. Liegt bei einigen Berufsgruppen das Gefahrenpotenzial auf der Hand, zeigt es sich bei anderen erst auf den zweiten Blick. Hohe Unfallzahlen verzeichnet vor allem das Baugewerbe – seien es Stürze bei Arbeiten in der Höhe oder Verletzungen durch Maschinen und Werkzeuge. Risiko besteht oftmals im Polizei- und Rettungsdienst – insbesondere dann, wenn Beschäftigte für Vollzug oder Schutz zuständig sind. „Das Berufsbild des Polizisten genießt nach wie vor in der Öffentlichkeit ein hohes Ansehen“, sagt eine Sprecherin der Bundespolizei. „Jedoch ist nach allgemeiner Wahrnehmung der Respekt gegenüber Vollstreckungsbeamten sowie Rettungskräften gesunken.“ Dies führe dazu, dass die Gefahren für Polizeivollzugsbeamte im Allgemeinen bei der Berufsausübung gestiegen seien und die Qualität von Angriffen gegen sie zugenommen habe.
Mit aggressivem Verhalten von Personen sind auch Beschäftigte anderer Berufe konfrontiert. So kommen laut Arbeitsunfallgeschehen 2017 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) Vorfälle durch menschliche Gewalt, Angriffe oder Bedrohung am häufigsten in Bahnbetrieben, Krankenhäusern und städtischen Verwaltungen vor. Gemeint sind damit Übergriffe auf Fahrausweisprüfer, Pflegekräfte und Angestellte im öffentlichen Sektor. „Bei Verwaltungsmitarbeitern stellen oftmals amtliche Befugnisse einen Risikofaktor dar – beispielsweise wenn sie einer Aufforderung nicht nachkommen“, sagt Anne Gehrke, Referentin am Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV. Ebenso bedeuten Arbeitsplätze mit Zugang zu Bargeld oder Rauschmitteln ein gewisses Gefahrenpotenzial. Grundsätzlich könne es aber immer dort Konflikte geben, wo Beschäftigte viel Kontakt zu Menschen haben.
Umgang mit der Angst
Angst dürfe jemand in solchen Jobs nicht haben, heißt es häufig. Doch eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Psychologin Gehrke bezeichnet Angst erst einmal als gesund. Das Gefühl vermittelt, dass eine Situation nicht stimmt oder ein erhöhtes Risiko besteht. Ohne Angst nehmen Personen eine Gefahr kaum wahr. Schwierig wird es laut Gehrke erst, wenn jemand nicht mit der Angst umzugehen weiß. Sie verstärke sich häufig bei Kontrollverlust oder wenn es keine innere Strategie gebe, mit der Situation umzugehen.
Solche Strategien lassen sich für den jeweiligen Job lernen. Gerade in Bereichen mit hohem Risiko erhalten Mitarbeiter oftmals Schulungen, wie sie in gewissen Momenten reagieren können. Als Beispiel nennt Gehrke die Tätigkeit des Kassierers. Ist dieser im Falle eines Raubüberfalls dazu angehalten, den Anweisungen des Gegenübers Folge zu leisten und alles Geld rauszugeben, erlebt der Betroffene die Situation weniger schlimm. Der Grund: Er selbst bleibt handlungsfähig. Das mache es später leichter, das Erlebnis zu verarbeiten, sagt Gehrke.
Ein guter psychologischer Test kann das Angstniveau, spezifische Ängste oder auch die Risikobereitschaft ermitteln.
Den Umgang mit Gefahren nur auf persönlicher Ebene zu trainieren, reicht allerdings nicht aus. Im Vorfeld muss es technische und organisatorische Maßnahmen geben. Dazu zählt unter anderem die persönliche Schutzausrüstung bei Höhenarbeitern durch Seilsicherungen, bauliche Trennungen von Personal und Kunden in Bargeldbereichen oder Kameraausstattung bei Polizisten. In der Pflicht bei alledem ist der Arbeitgeber. Er hat die Gefährdungen zu beurteilen und dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter keinen unnötigen Gefahren ausgesetzt sind. Das Einrichten entsprechender Schutzmaßnahmen verantwortet er ebenso. Gerade Einzelarbeitsplätze bedürfen einer intensiven Betrachtung, da lautGehrke dort das Risiko häufig größer ist.
Das können Arbeitgeber tun
Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) ist unter anderem in den Bereichen Pflege sowie Rettungsdienst und Katastrophenschutz aktiv. Das Gefahrenpotenzial für Mitarbeiter reicht weit. Für Pflegekräfte besteht neben der hohen Arbeitsbelastung das Risiko, sich mit Infektionskrankheiten wie HIV oder Hepatitis anzustecken. Hinzu kommen körperliche Faktoren wie Rückenschäden oder Gelenkverschleiß. Die Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation setzt unter anderem auf ein betriebliches Gesundheitsmanagement und detaillierte Risikoanalysen.
Hinsichtlich Gewalt und Übergriffen schult der ASB seine Rettungskräfte in Deeskalation. Darüber hinaus sind Beschäftigte vor allem auch psychischen Belastungen ausgesetzt. Präventive Maßnahmen und Trainings sollen sie in Sachen Resilienz stärken. Dabei lernen Beschäftigte, wie mit stressbildenden Faktoren bei besonderen Einsatzlagen umzugehen ist. Beim Umgang mit dem Tod, mit verletzten Kindern oder Suiziden braucht es besondere Unterstützung. Zur Stressbewältigung nach belastenden Rettungseinsätzen ist im ASB ein bundesweites Nachsorgesystem implementiert. Zudem gibt es regelmäßig qualifizierte Nachbesprechungen und Supervisionen. Beschäftigte im ASB-Rettungsdienst können außerdem Coachings in Anspruch nehmen – entweder in kleinen Gruppen oder allein. Vorrangig geht es dabei um die Nachsorge nach belastenden Einsätzen. Bei all diesen Coachings verzeichne der ASB eine rege Teilnahme und erhalte nur positives Feedback.
Die Bundespolizei setzt auf Aus- und Fortbildung, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren. Ebenso sollen Beschäftigte dadurch Einzelsituationen sicher einschätzen und richtig handeln können. Spezielle Fortbildungsschulungen – wie Trainings zum Umgang mit lebensbedrohlichen Einsatzlagen – bereiten Polizisten auf besondere Gefahren vor. Dies geschieht in mentaler Hinsicht als auch unter Nutzung aller verfügbaren Führungs- und Einsatzmittel. Für die Betreuung und Nachsorge nach außergewöhnlichen und stressbelastenden Ereignissen gibt es für Beschäftigte der Bundespolizei ein eigenes Konzept zur psychosozialen Notfallversorgung. Darüber stehen weitere Unterstützungssysteme wie Seelsorge oder ärztliche Dienste zur Verfügung.
Eignungsdiagnostik als Indikator
Ob die Persönlichkeit für risikoreiche Berufe gemacht ist oder nicht, darüber entscheiden oftmals eignungsdiagnostische Verfahren im Recruiting. Schließlich möchten Verantwortliche sicherstellen, dass zukünftige Mitarbeiter der Aufgabe gewachsen sind und mit Gefahrensituationen umgehen können. „Sind bei Berufsgruppen erhöhte Risiken von vornherein erkennbar, findet eine Selbstselektion auf Bewerberseite statt“, sagt Heinz Schuler, emeritierter Professor der Universität Hohenheim und spezialisiert auf berufliche Eignungsdiagnostik. So schließen beispielsweise Menschen mit Höhenangst Berufe wie Bergführer oder Fensterputzer an Hochhäusern ganz automatisch für sich aus. Anders hingegen stelle sich die Situation bei Jobs dar, deren Gefahren weniger vorhersehbar seien oder unterschätzt würden. Damit sind unter anderem Tätigkeiten von Gerüstbauern oder Pflegekräften gemeint. Das verpflichtet Arbeitgeber zu gründlichen Vorabinformationen für Interessenten und ebenso zu einer angemessenen Personalauswahl, so Schuler.
Der Wissenschaftler nennt als spezielle Fälle für eine gründliche Selektion Polizei und Feuerwehr. Er selbst hat in der Auswahl von Polizeianwärtern Erfahrung. Neben der körperlichen Fitness, die am einfachsten festzustellen sei, gebe es eine Vielzahl an weiteren Anforderungsaspekten. Dazu gehörten Intelligenz, Integrität, Normorientierung, psychische Stabilität, Selbstständigkeit, Dominanz, Verträglichkeit sowie Mut und Selbstkontrolle. Psychologische Tests seien dafür geeignet, Persönlichkeitsmerkmale und Eigenschaften zu messen – sofern diese psychometrischen Standards genügen. Ein guter Test kann laut Schuler das Angstniveau, spezifische Ängste oder auch die Risikobereitschaft ermitteln. Für ihn haben sich in diesem Zusammenhang anforderungsbezogene, hochstrukturierte Interviews – wie das von ihm entwickelte Multimodale Einstellungsinterview – bewährt. Darin ermitteln Fragen mit biografischem Bezug wie jemand in früheren Situationen gehandelt hat. Ebenso müssen Bewerber anhand situativer Fragestellungen in einer beispielhaften Dilemmasituation eine Entscheidung treffen. Bei Polizeibewerbern könnte eine solche Frage lauten: „Stellen Sie sich vor, Sie werden in Ihrem Streifenwagen zu einem Verkehrsunfall gerufen. Auf dem Weg sehen Sie, dass Jugendliche vor einer Gaststätte zwei Frauen bedrängen. Wie verhalten Sie sich?“. Das Dilemma besteht Schuler zufolge darin, dass man nicht gleichzeitig beiden situativen Erfordernissen gerecht werden kann und im Abwägungsprozess die bestmögliche Ersatzlösung finden muss.
„In allen gefährlichen und belastenden Berufen ist eine kompetente Personalauswahl wichtig“, sagt Schuler. Dafür sei es jedoch nicht erforderlich, Bewerber Stresstests oder Schockmomenten zu unterziehen. Gleiches gilt für Assessment-Center. Sie hält der Eignungsdiagnostiker nicht mehr für die Methode der Wahl: Über die vergangenen Jahrzehnte haben sie in ihrer Validität – also Aussagekraft – abgenommen und beziehen sich nicht auf die spezifischen Anforderungen dieser Berufe. Vielmehr geht es ihm darum, diejenigen Persönlichkeitsmerkmale, Verhaltensbereitschaften, Interessen und Fähigkeiten zu messen, die sich als anforderungs- und berufserfolgsrelevant erwiesen haben. Damit meint Schuler nicht nur Leistungsaspekte, sondern ebenso Zufriedenheit, Gesundheit und das Sicheinfügen in eine Organisation. Neben psychologischen Tests hält er Arbeitsproben, insbesondere Praktika, für besonders aussagekräftig. Sie geben Bewerbern Informationen darüber, was sie erwartet und welche Anforderungen der Job an sie stellt. Das ermögliche ihnen eine Selbstselektion.