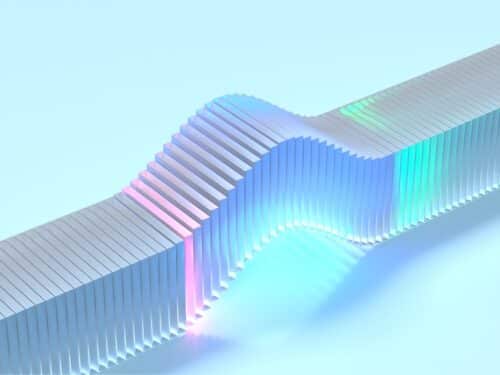Um hartnäckige Erkrankungen wie Stress zu verhindern, müssen Mitarbeiter und Vorgesetzte Frühwarnzeichen erkennen. Der Stressforscher Mazda Adli darüber, warum immer mehr jüngere Menschen von psychischen Erkrankungen betroffen sind, was Führungskräfte dagegen tun können und weshalb die Arbeitsbedingungen entscheidender sind als die Arbeitsmenge.
Herr Dr. Adli, wann haben Sie sich selbst das letzte Mal gestresst gefühlt?
Gestern Abend, als ich nicht wusste, ob ich es noch rechtzeitig ins Theater schaffe.
Wie sind Sie mit dieser Situation umgegangen?
Ich habe überlegt, was schlimmstenfalls passieren könnte. Es ist schon mal gut, kein Katastrophenszenario aufzubauen. Das Beispiel zeigt aber auch nur einen punktuellen Stress. Der ist zwar unschön, macht uns aber noch lange nicht krank. Problematisch sind vielmehr chronischer Stress und Stressursachen, die wir nicht beeinflussen können.
Sie als Fachmann können ja auch unterscheiden zwischen einer punktuellen und einer über Monate hin belastenden Situation.
Akuten und chronischen Stress zu unterscheiden ist in der Tat nicht immer ganz leicht. Was vielen besonders schwerfällt: Frühwarnzeichen für chronischen Stress zu erkennen und diese dann richtig zu deuten. Kurse zum Stressmanagement können helfen für Warnzeichen zu sensibilisieren.
Welche Warnzeichen gibt es denn?
Das können Gereiztheit und erhöhte Ablenkbarkeit sein oder auch das Gefühl einer inneren Unruhe. Wenn man so etwas vermehrt an sich bemerkt, dann sollte man dagegen etwas unternehmen. Wenn man erkennen kann, wie sehr einen bestimmte Stresssituationen, zum Beispiel ein Konflikt mit einem Kollegen oder Mitarbeiter, belasten, dann ist man ihnen schon viel weniger ausgeliefert. Das ist der erste Schritt, um wieder Kontrolle über eine Situation zu erlangen und dem Stress entgegenzusteuern.
Der Kontrollverlust ist der Kern des Problems?
Wir empfinden Stress immer dann als besonders belastend, wenn wir das Gefühl haben, ihn nicht beeinflussen zu können, wenn wir glauben, der Stressursache hilflos ausgeliefert zu sein. Das kann an die psychische und körperliche Gesundheit gehen.
Ist die Unterscheidung in positiven und negativen Stress wissenschaftlich eigentlich noch haltbar?
Ich unterscheide lieber zwischen akutem Stress und chronischem Stress. Akuter Stress ist in der Regel nicht gesundheitsschädlich. Er entsteht, wenn wir eine Hürde vor uns sehen, über die wir springen müssen: öffentliches
Singen, ein Vortrag, ein Sportwettbewerb oder eine Klausur sind Beispiele für akute Stressoren. Diese Belastungen sind aber zeitlich begrenzt. Man weiß das und eine Entlastung ist in Sicht. So eine Situation kann sogar anregend sein und unser Stresssystem in einer sinnvollen Weise stimulieren. Bei chronischem Stress ist das anders.
Was geschieht bei chronischem Stress?
Hier gibt es eine Dauerbelastung ohne adäquate Entlastung. Eine Regeneration kann nicht stattfinden. Das führt letztlich zur Regenerationsunfähigkeit des Organismus, zu dem ich auch die Psyche zähle. Daraus können Stressfolgeerkrankungen entstehen. Das bekannteste Beispiel ist die Depression.
Sind die hormonellen Wirkmechanismen andere als bei akutem Stress?
Bei chronischem Stress spielt das Stresshormon Cortisol eine große Rolle. Wird es dauerhaft und in zu hohem Maße ausgeschüttet, kann es schädlich auf die Nervenzellen wirken und im übrigen Körper zu Stoffwechselveränderungen führen. Eine diabetische Stoffwechsellage oder auch eine erhöhte Infektanfälligkeit können die Folge sein.
Kann ich als Betroffener selbst abschätzen, wenn aus akutem Stress ein chronischer wird?
Ja. Wenn ich beispielsweise merke, dass ich mich nicht mehr gut erholen, nicht abschalten kann, dass ich ständig gedanklich bei der Arbeit bin und Unerledigtes mit nach Hause nehme, wenn sich der Schlaf oder der Appetit verändern. Das können Zeichen für einen chronischen Stress oder sogar Frühwarnzeichen für eine Depression sein.
Das Gesundheitsministerium hat einen deutlichen Anstieg der Fehltage festgestellt und das als Folge gestiegener Arbeitsbelastung interpretiert.Nehmen Erkrankungen zu?
Sie nehmen in ihrer relativen Bedeutung zu, insbesondere depressive Erkrankungen. Das hat weniger etwas mit einer „Depressionsepidemie“ zu tun als viel mehr damit, dass solche Erkrankungen besser erkannt werden. Auch ist es heute nicht mehr so stigmatisiert wie noch vor 20 Jahren, sich jemanden anzuvertrauen. Darüber hinaus scheinen Erkrankungen auch zunehmend jüngere Menschen zu treffen.
Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ich glaube, dass Depressionen insgesamt eine größere Bedeutung in der Wahrnehmung der Menschen spielen. Dass Stress und seine Folgen eine immer größere Rolle spielen, liegt daran, dass unsere Lebensumwelt eine andere geworden ist. Sie hat sich innerhalb einer Generation sehr verändert. Wir arbeiten heute digital. Das bedeutet einen fast hundertprozentigen Umbau unserer Arbeitsplätze. Wir sind alle fast überall erreichbar. Die Grenzen zwischen Privatleben und Arbeit verschwimmen. Digitalisiertes Arbeiten bedeutet Arbeiten unter viel stärkerer Ablenkung und unter Multitasking-Bedingungen. Wir arbeiten zeitlich und örtlich flexibler, aber diese Individualisierung erhöht auch die Verantwortung des Einzelnen für immer komplexere Prozesse.
Historisch betrachtet, leben wir in einer Arbeitssituation, die selten besser war. Noch vor hundert Jahren starben viele Menschen bei der Ausübung ihrer Arbeit. Müssen wir erst lernen uns in dieser neuen Welt sicher zu bewegen?
Davon bin ich überzeugt. Wir durchlaufen eine Anpassungsperiode. Und das verlangt uns viel ab. Als Mobilität und Elektrizität aufkamen, gab es schon einmal eine Welle von psychischen Belastungsphänomenen. Zur Jahrhundertwende und bis in die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts kannte man das als Neurasthenie. Man hat diese Nervenschwäche, unter der plötzlich viele Menschen litten, dem Fahren in den neuen schnellen Eisenbahnen zugeschoben. Heute ist das vielleicht ähnlich.
Und wie können wir uns schützen?
Wir brauchen eine Art Kodex im Umgang mit digitalisierten Arbeitsplätzen – eine Handlungsanleitung sowohl für Personalverantwortliche als auch für Beschäftigte, wie man mit dem Paradigma der ständigen Erreichbarkeit und größeren Informationsdichte einen gesunden Umgang erreicht.
Wen sehen Sie da in der Pflicht?
Es ist einerseits ein politisches Thema, andererseits sehe ich da auch sehr die Unternehmen in der Verantwortung. Es gab ja schon einmal von politischer Seite den Versuch, eine Art Antistress-Verordnung zu gestalten. Eine solche Verordnung allein macht das Arbeiten aber nicht besser. Diese Dinge müssen betriebsintern entwickelt werden.
Wie müssen aus Ihrer Sicht Unternehmen ihre Mitarbeiter schützen?
Indem sie Stressmanagement zu einem sichtbaren Teil ihrer Unternehmenskultur machen. Stress muss dabei gar nicht als etwas angesehen werden, das es unbedingt zu vermeiden gilt. Wir sollten erst einmal akzeptieren, dass Stress zu unserem Arbeitsleben dazugehört, aber der richtige Umgang damit, der geht uns alle an. Dafür müssen wir gemeinsam Wege finden. Es hilft aber, wenn Vorgesetzte zeigen, wie sie selbst mit Stress umgehen. Ein positives Vorbild ist entscheidend. Es hilft, dem Mitarbeiter oder Kollegen deutlich zu machen, dass er nicht alleine dasteht, wenn er sich belastet fühlt. Soziale Unterstützungsstrukturen im Unternehmen sind wichtig. Dazu gehört letztlich auch die Atmosphäre.
Wie kann ein Manager sensibel sein für die Stresssituation seiner Mitarbeiter, wenn er selbst auch seine Zielvorgaben hat und abliefern muss? Frei nach dem Motto: Die sollen sich mal nicht so haben, ich kann es doch auch.
Das wäre genau der falsche Zugang. Der Führungsfigur muss klar sein, dass sie selbst ebenso stressexponiert ist, wie es die Mitarbeiter sind. Es hat noch nie etwas gebracht, Stressquellen nach unten weiterzudelegieren.
Sollte man Führungskräfte gezielt schulen, damit sie solche Belastungssituationen erkennen können?
Absolut. Eine Führungsperson muss Belastungssituationen für sich und andere erkennen können. Man sollte einen offeneren Umgang mit psychischer Belastung pflegen, damit man sich auch um andere kümmern kann. Stress muss im Unternehmen ein besprechbares Thema sein. Es ist wichtig, dass wir unsere Führungskräfte im Umgang mit Stress fit machen.
Resilienz wird gerne als Synonym dafür benutzt, dass Mitarbeiter großem Druck standhalten können. Aber wäre es nicht sinnvoller, stattdessen für eine ausgeglichene Belastungssituation zu sorgen? Es kann ja nicht darum gehen, den harten Hund einzustellen, der alles wegsteckt.
Nein, denn auch von dem wird man nicht lange etwas haben. Der harte Hund wird irgendwann zu einem bissigen. In einem Unternehmen, in dem eine gute Kultur in Bezug auf den Umgang mit Stress gepflegt wird, sind die Mitarbeiter an sich schon widerstandsfähig. Dazu gehört auch, dass man das Selbstwirksamkeitserleben von Beschäftigten stärkt und für ausreichend Anerkennung sorgt. Entscheidend sind übrigens vielmehr die Bedingungen von Arbeit als die Menge von Arbeit.
Was muss man sich unter Selbstwirksamkeit vorstellen?
Der Einzelne braucht die Gewissheit, dass sein Tun einen Effekt hat, dass er gesehen wird und Einfluss auf die Prozesse hat, an denen er beteiligt ist.
Lassen sich diese zum Teil ja auch organisch gesteuerten Prozesse überlisten?
„Überlisten“ wäre nicht das richtige Wort. Das hieße ja, jemandem etwas vorzumachen. „Gegenwirken“ wäre besser. Sport ist ein wichtiges Mittel. Gerade Ausdauersport führt dazu, dass unser Stresshormonsystem reguliert wird und Nervenzellen und Blutgefäße neu entstehen. Auf individueller
Ebene ist ein gutes regeneratives Verhalten wichtig, also zu wissen, was
Erholung verschafft. Dazu gehört ausreichend Schlaf und dass man möglichst seinem biologischen Rhythmus entsprechend arbeitet.
Wie extrem können die Folgen von chronischem Stress denn werden? Gibt es Fälle, in denen die Rückkehr ins Berufsleben unmöglich wird?
Natürlich. Wir sehen auch Stressfolgeerkrankungen, die einen chronischen Verlauf nehmen, aus denen letztlich hartnäckige Krankheitsbilder erwachsen können – bis hin zu Störungsbildern, die den Symptomen Traumatisierter ähnlich sind.
Kommen Ihre Patienten selbstindiziert zu Ihnen oder geht da schon ein langer Leidensweg von Arzt zu Arzt voraus?
Es gibt beides. Etwa über die Hälfte der Patienten kommt aus eigenem Antrieb. Die anderen kommen auf Zuweisung ihrer niedergelassenen Ärzte.
Hat das Einfluss auf den Krankheitsverlauf?
Es hat immer einen Einfluss auf den Erfolg, wenn man behandlungsmotiviert ist und einen Veränderungswillen mitbringt. Mit der Überweisung selbst hat das nichts zu tun. Auch der überwiesene Patient ist ja letztlich motiviert.
Ist diese Motivation noch möglich, wenn man schon im chronischem Bereich ist?
Ja. Viele Menschen wissen ja gar nicht, dass sie chronisch gestresst sind. Zunehmende Erschöpfung oder eine abnehmende Leistungsfähigkeit wird dann eher durch noch mehr Arbeit kompensiert. Die Zeichen werden nicht erkannt. Daher besteht eine unserer Hauptaufgaben darin, diese Symptome erst einmal zuzuordnen und daraus ein Stressmodell zu schaffen.
Was folgt dann?
Zuvörderst ist es wichtig, eine möglichst präzise Diagnose zu stellen. Dann schauen wir auf die Faktoren, die chronischen Stress auslösen, und auf die eigenen Persönlichkeitsanteile, die vielleicht zum Stresstreiber werden und die empfundene Belastung noch verstärken. Wenn jemand zum Beispiel besonders perfektionistisch ist, kann das wie ein Brandbeschleuniger wirken. Und dann kann man anfangen, daran zu arbeiten; sowohl an der persönlichen Stressfalle, als auch an den äußeren Bedingungen.
Die Welt wird immer dynamischer, die Informationsflut dichter. Welche
Probleme kommen noch auf uns zu?
Ich rechne damit, dass die Bedeutung von psychischen Erkrankungen weiter zunimmt. Wir sind noch nicht am obersten Punkt angelangt. Dennoch sehe ich keinen Grund, ein Katastrophenszenario zu zeichnen. Dass psychische Belastungssituationen und seelische Erkrankungen zunehmend richtig erkannt werden, ist eine positive Entwicklung. Denn erst dann kann man vernünftig etwas dagegen unternehmen. Ich halte es aber für eine absolute Notwendigkeit, dass wir uns psychischer Gesundheit und der Prävention psychischer Erkrankungen gerade auch am Arbeitsplatz viel stärker widmen, als wir es jetzt tun.
Depression gilt ja auch als einer der Krankmacher überhaupt.
Sie wird im Jahr 2030 an Platz eins der diagnostizierten Krankheiten stehen. Das hat eine wirklich große Public-Health-Dimension. Hier brauchen wir Präventionsansätze. So wie es selbstverständlich ist, dass wir uns vor dem Schlafengehen die Zähne putzen, so muss es selbstverständlich sein, mit Alltagsstress einen guten Umgang zu finden. Stress lässt sich nicht immer verhindern, also muss unser Umgang damit ein anderer werden. Und da spielen Unternehmen und die Personalabteilungen eine tragende Rolle.

Mazda Adli ist Psychiater, Stressforscher, Leiter der Fliedner Klinik Berlin und des Forschungsbereichs „Affektive Störungen“ an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité. In seiner Forschung untersucht er Einflussfaktoren auf die individuelle Stressreaktion und widmet sich der Entwicklung von Strategien zur Behandlung von therapieresistenten Depressionen. Gemeinsam mit der Alfred Herrhausen Gesellschaft hat Adli ein interdisziplinäres Forum aus Neurowissenschaftlern, Architekten und Stadtplanern gegründet, um Einflussfaktoren des Stadtlebens auf Emotionen und Verhalten zu erforschen. Außerdem hat er mit Kollegen den einzigen Chor weltweit gegründet, der nur aus Psychiatern, Neurologen und Psychologen besteht.
Auf dem diesjährigen Personalmanagementkongress referiert er zudem zu diesem Thema – Dienstag, 26. Juni, 14:15 bis 15:15 Uhr.