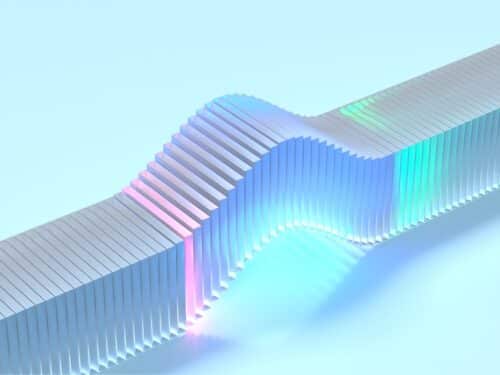Wenn Frauen nach der Elternzeit in den Berufsalltag zurückkehren, kommt das einem Neuanfang gleich: Der Job mag der alte sein, doch das Leben ist ein völlig anderes. Die Journalistin und Autorin Katrin Wilkens erklärt, wie der Wiedereinstieg gelingen kann, mit welchen kulturellen Schwierigkeiten Frauen zu kämpfen haben und warum Perfektionismus die Pest ist.
Frau Wilkens, mit dem Wiedereinstieg nach der Babypause in den Job muss das ganze Leben neu geordnet werden. Wie kann der Neuanfang gut funktionieren?
Katrin Wilkens: Mein Tipp ist, die Erwartungshaltung runterzuschrauben. Man sollte den Job erst einmal als Geldquelle sehen. 80 Prozent Leistung sind genug. Mütter neigen zum Perfektionismus, sowohl im Job als auch in der Kindererziehung.
Ist es nicht gut, wenn Eltern versuchen, so gut wie möglich das Familienleben zu bestreiten?
Nein, ich glaube, das ist die Pest unserer Zeit. Das perfekte Familienleben, der perfekte Wiedereinstieg in den Beruf, der perfekte Neuanfang… das macht krank. Perfektionismus und Burnout sind Geschwister.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass kaum jemand zugeben würde, keine Lust auf die Kindererziehung zu haben.
Ein Kind soll heute unheimlich viele Sehnsüchte erfüllen. Man darf gar nicht sagen, wenn man extrem genervt ist oder keine Lust auf das Kind hat. In unserer Kultur wird der Nachwuchs zum Projekt, er wird vergöttert. Er ist nicht einfach mehr nur ein Teil des Lebens, sondern ein Identitätsverstärker. Kinder werden zu Objekten der Inszenierung ihrer Eltern.
Sie sagen auch, dass Müttern der Job fehlt. Warum ist es so schwer, gleichzeitig zu arbeiten und ein Kind großzuziehen?
Es ist nicht nur der Perfektionismus, der bremst – es sind manchmal auch ganz banal Zeitprobleme. Frauen, die in Süddeutschland leben, sagen mir, dass sie zehn bis 15 Stunden in Teilzeit arbeiten könnten, weil Kita und Grundschule gegen 12 Uhr Mittags schließen. Wer soll da arbeiten gehen? Am schwierigsten ist die Situation in ländlichen Gegenden in Süddeutschland. Dort sind Frauen zehn bis 15 Jahre zur Untätigkeit verdammt.
Wie könnten Personaler unterstützen?
Sie können durch flexible, kreative Lösungen helfen und zum Beispiel Homeoffice anbieten. So kann man, wenn das Kind krank ist, von zu Hause arbeiten. Nachweislich arbeiten diese Mütter zu Hause mehr ab, als sie im Büro arbeiten würden. Und Väter sollten genauso selbstverständlich Krankentage nehmen können, ohne dass ihre Männlichkeit infrage gestellt wird. Es würde außerdem helfen, wenn sich Personaler eingehend mit dem Tagesablauf einer Mutter beschäftigen würden.
Wie soll das konkret aussehen?
Personaler sollten einen ganzen Tag an der Seite einer Mutter mitlaufen, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Da sehen sie ganz schnell, wie belastbar, multitaskingfähig und entscheidungsstark Frauen sind. Mütter müssen täglich unzählige Entscheidungen treffen, und zwar für ein Team. Über diesen Alltag zu reden oder zu schreiben, kratzt nur an der Oberfläche. Man muss ihn erleben.
Sollten Frauen sich in Bewerbungen auf diese Fähigkeiten berufen?
Eine Bewerberin, die schreibt, sie sei Mutter und deswegen multitaskingfähig, wird sofort aussortiert. Das sollte sie lieber später im Arbeitsalltag zeigen. Andernfalls wird sie nur noch als „Mutti“ gesehen, die bestimmt gut eintuppern kann, aber keine geeignete Arbeitnehmerin ist.
Also haben Mütter, die sich als solche in einer Bewerbung präsentieren, geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt?
Ja. Man unterstellt ihnen, sie seien zu harmlos. Niemand denkt an die Grabenkämpfe, die Mütter zwischen 18 und 20 Uhr ausstehen müssen. Niemand denkt an die Konfliktfähigkeit, die nötig ist, ein Kind zu überzeugen, jetzt sein Zimmer aufzuräumen. Wenn ein Personaler wirklich mal einen ganzen Tag lang an der Seite einer Mutter mitläuft, wird er ihre Leistungsfähigkeit danach anders beurteilen und Möglichkeiten wie Jobsharing stärker anbieten. Zwei Mütter, die sich einen Job teilen, können sich gegenseitig unterstützen – und sind geradezu unverschämt loyal dem Arbeitgeber gegenüber.
Der Titel Ihres Buchs, „Mutter schafft!“, klingt nach Aufforderung und Kritik gleichermaßen.
Finden Sie? Ich habe mich gefragt, warum es für eine Frau hierzulande so problematisch ist, eine gute Balance zwischen Mutterschaft und Selbstverwirklichung im Job zu finden.
Das Stichwort Selbstverwirklichung klingt bisweilen nach hohler Phrase.
Ich rede auch nicht von einer Dawanda-Selbstverwirklichung (Dawanda war ein deutsches Onlineportal, auf dem selbst gemachte Produkte vertrieben werden konnten, Anm. der Red.), sondern von der Realität des Geldverdienens. Bei uns ist die große Masse der Mütter bei den Cupcakes hängengeblieben. Die sozialen Netzwerke verstärken den Druck, ein perfektes Hausmütterchen zu sein. Das nimmt immer groteskere Züge an. Der neueste Trend heißt: Sunday prepare. Da bereiten Mütter die Lunchbox der Kinder für die gesamte Woche vor. Frauen sind emanzipiert, Mütter sind es leider nicht immer.
Sie haben mal von einem wieder aufkeimenden Biedermeier-Trend gesprochen. Was meinen Sie damit?
In Deutschland wurde die Rolle der Mutter historisch oft überhöht: Durch Martin Luther galt sie ab dem 16. Jahrhundert als heilig. Das ist auch heute wieder zu beobachten. Unter Verweis auf den französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau wurde das Stillen immer mehr propagiert. Interessanterweise sind die französischen Frauen darauf nicht besonders eingegangen, aber die deutschen. Auf den exzessiv ausgelebten Biedermeier im 19. Jahrhundert, in dem man sich ins Familiäre zurückzog, folgte die furchterregende Nazizeit. Weil man Menschen für den Krieg benötigte, stand auch das Gebären an erster Stelle.
Wie ist das zu erklären?
Frankreich hat eine lange Ammentradition. Die Mütter kehren dort schneller an den Arbeitsplatz zurück. Deswegen haben sich französische Frauen nicht sonderlich von dem Still-Postulat beeindrucken lassen. Für die Deutschen passte das Stillen hingegen sehr gut ins Bild.
Französische Mütter gelten als Ideal der Emanzipation.
Ich würde sie allerdings nicht ausschließlich als Vorbild anführen. Studien belegen, dass sich durch die frühe staatliche Betreuung der Säuglinge, zum Teil schon wenige Wochen nach der Geburt, Eltern von ihren Kindern häufig entfremdet fühlen. Auch die Kinder selbst bezeichnen die Beziehung und Bindung zu ihren Eltern als schwach. Die Rolle der modernen emanzipierten Französin und des französischen Mannes, der kaum eine Rolle bei der Kinderbetreuung spielt, hat ihren Preis.
Wie hat sich das Mutterbild nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland verändert?
Es war zweigeteilt: In der BRD war man stolz, wenn es die Frau gar nicht nötig hatte zu arbeiten. Mit dem Wirtschaftswunder in den Fünfziger- und Sechzigerjahren blühte der Wohlstand, und Frauen brauchten tatsächlich nicht zu arbeiten. In Ostdeutschland war das anders. Da wurde automatisch angenommen, dass Mütter berufstätig sind. Das hat sich auch im Liedgut der DDR gespiegelt: „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“ ist da nur ein Beispiel.
Lag das auch an der schwach ausgeprägten Religionsausübung in der DDR?
Das könnte ein Faktor sein. Hinzu kommt, dass Russland einen starken Einfluss hatte und russische Frauen immer gearbeitet haben. Ein anderer Faktor ist schlichtweg die wirtschaftliche Not gewesen.
Die Arbeitslosigkeit von Müttern und Ehefrauen war demgegenüber ein Statussymbol in der BRD?
Absolut! Das liegt auch an dem Einfluss aus den USA. Allerdings wurde genau das zum Problem: Eine innere Leere machte sich unter den sogenannten Vorstadtfrauen breit. Manche stellten sich die Frage: Ist das alles?
Das war auch die Zeit, in der Antidepressiva als Mother’s Little Helpers in Mode kamen.
Genau. Das traf auch in Deutschland zu, denn wir sind kulturell stark von Amerika geprägt. Nachdem sich Mütter ab den Siebzigerjahren vom Hausfrauendasein emanzipiert hatten, igeln sie sich heute wieder ein, posten auf Pinterest und Instagram die neuesten Cupcake-Kreationen oder schreiben einen Mami-Blog.
Dann sind sie doch aktiv.
Das ist natürlich produktiv, emsig oder kreativ, aber nicht im wirtschaftlichen Sinne. Der Kampf darum, welche Mutter die besten Dinkelkekse backt, führt in die Altersarmut. Frauen verzichten im Laufe ihres Lebens mehrmals auf das Einkommen: erst, wenn sie beim Kind zu Hause bleiben und danach noch einmal, wenn sie in Teilzeit wieder in den Beruf einsteigen. Die Auswirkungen auf die Rente sind eklatant. Wenn man alle Faktoren zusammenzählt und hinzuaddiert, wie viel ein Kind kostet, kommt man auf eine halbe bis ganze Million Euro, die eine Frau im Laufe ihres Lebens nicht zur Verfügung hat.
Warum ist vielen die drohende Altersarmut so wenig bewusst?
Mit der Altersarmut verhält es sich wie mit Gebissreiniger: Man will sich damit einfach nicht beschäftigen. Ich würde behaupten, dass über 90 Prozent der Frauen nichts für die Altersvorsorge tun. Sie haben oft nicht einmal 1.000 Euro zurückgelegt. Vor 30 Jahren lebten die Menschen im Durchschnitt etwa elf Jahre im Ruhestand. Heute sind es bereits über 20 Jahre. Wir werden alle älter und müssen länger mit der Rente auskommen.
In einem Interview mit der FAZ sagte die damalige Familienministerin Manuela Schwesig einmal, eine Frau könne nur scheitern: Geht sie nach der Geburt ihres Kindes nach kurzer Zeit wieder arbeiten, wird sie als Rabenmutter verschrien. Bleibt sie zu Hause, droht ihr die Altersarmut.
Ich sage ja nicht, dass alle Frauen mit Kindern acht Stunden täglich arbeiten müssen. Aber sie sollten es können, ohne dass sie gleich als schlechte Mutter gebrandmarkt werden. Ein Beruf ist aber auch ein Identitätsfaktor. Eine Tätigkeit, in der man außerhalb der Familie Bestätigung bekommt, kann sehr befriedigend sein. Das muss nicht immer mit Geld verdienen einhergehen. Es kann sich dabei auch um ein Ehrenamt oder Ähnliches handeln, solange es einen Partner gibt, der für beide vorsorgt.
Welche Vorkehrungen wären denn sinnvoll, damit Frauen nicht in die Altersarmut abrutschen?
Ich würde Paaren empfehlen, sich vor der Hochzeit oder bevor ein Kind unterwegs ist, die Finanzen anzuschauen. Vor einer OP muss ich auch genau lesen, was alles passieren kann, und dann den Aufklärungsbogen unterschreiben, sonst wird nicht operiert. Punkt. Da ist jeder Chirurg eisern. Man sollte sich der Risiken möglichst bewusst sein. Etwas Ähnliches müsste es zum Wiedereinstieg geben: Natürlich kann man fünf bis zehn Jahre nach der Geburt eines Kindes zu Hause bleiben, aber man sollte die Konsequenzen kennen und sie durch Vorsorgeregelungen verhindern.
Bleiben denn überhaupt noch so viele Frauen der jüngeren Generation zu Hause? Ist das Modell nicht schon längst überholt?
Es gibt ein Gefälle zwischen Stadt und Land sowie zwischen Ost und West. Es ist etwas anderes, ob wir über ein Paar in Berlin reden, das vielleicht noch in der ehemaligen DDR sozialisiert worden ist. Oder ob wir über ein Paar aus einer süddeutschen Kleinstadt sprechen. Eine in Ostdeutschland sozialisierte Frau gibt vielleicht gerade noch leise zu, dass sie gerne in Teilzeit arbeiten würde, und meint damit eine 35-Stunden-Woche. Eine Frau aus Süddeutschland meint mit Teilzeit eher eine 10- bis 15-Stunden-Woche.
Süddeutschland ist eher wohlhabend. Gilt es vielleicht auch als Statussymbol, wenn die Frau zu Hause bleibt, während der Mann das Geld verdient?
Ja, und deswegen gehen die Frauen deutlich seltener auf die Barrikaden. Ein wirtschaftlicher Druck, der beide Partner dazu veranlasst, arbeiten zu gehen, muss nicht verkehrt sein. Ein Leben ohne Probleme ist auch nicht leicht.
In Ihrem Buch schreiben Sie: Mütter, wehrt euch! Wogegen denn?
Zum Beispiel gegen die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern. Anfang des 19. Jahrhunderts haben Frauen für ihr Wahlrecht gekämpft. Später kämpften sie dafür, arbeiten gehen zu dürfen. In den Sechzigerjahren haben sie in der BRD dafür gekämpft, sich gegen den Willen des Mannes scheiden lassen zu dürfen. In den Siebzigerjahren gab es die sexuelle Revolution und die Antibabypille kam auf den Markt. Immer gingen Frauen für wichtige Themen auf die Straße. Heute gilt diese Form der Emanzipation nicht mehr als sexy.
Aber es gibt doch zum Beispiel die Me-Too-Bewegung.
Na ja, Me Too ist zwar wichtig, geht aber auch am Thema vorbei: Es ist irrelevant, ob sich alle Frauen bei einer Oscarverleihung schwarz kleiden. Das ist der Frau von nebenan egal, die sich mit der Bewältigung des Alltags abmüht.
Was sollten Frauen beziehungsweise Mütter stattdessen tun?
Stärker für ihre Rechte kämpfen! In Island sind schon vor Jahrzehnten Tausende Frauen auf die Straße gegangen und haben für Gleichberechtigung, bessere Bezahlung und Kinderbetreuung demonstriert. 90 Prozent der arbeitenden Frauen haben damals gestreikt und die gesamte Arbeitswelt war lahmgelegt. Die Hot-Dog-Dosen waren an diesem Tag in den Märkten ausverkauft, weil die Männer sich ums Essen kümmern mussten. Diese Demonstrationen haben eine Menge bewirkt, und Island steht heute beim Thema Gleichberechtigung weltweit an erster Stelle.
Wir haben über die Rolle der Mütter gesprochen. Wie steht es denn um die Väter?
Es gibt zu Recht immer mehr Männer, die sagen, dass ihre Partnerin endlich auch mal wieder arbeiten gehen könnte. Mir mangelt es an Verständnis, wenn Mütter ab einem bestimmten Punkt sagen: Ich kann nicht arbeiten, ich habe ja die Kinder. Es ist ungerecht, wenn Männer allein das ganze Geld verdienen müssen, und nebenbei gesagt auch fahrlässig.
Inwiefern?
Da muss ich biografisch werden: Mein Ehemann ist Nephrologe, also Facharzt für Nierenerkrankungen. Er verdiente sehr gut und sein Job war sicher. Vor einem Jahr wurde bei ihm eine gravierende Krankheit diagnostiziert: Er konnte seinen Beruf von heute auf morgen nicht mehr ausüben. Wenn ich keinen Job gehabt hätte, wäre ich vermutlich durchgedreht. Es muss also nicht einmal eine Scheidung sein oder die Kündigung. Auch eine schwere Erkrankung kann die Familienexistenz bedrohen, besonders wenn nur einer arbeitet.

Katrin Wilkens ist freie Journalistin. Gemeinsam mit Miriam Collée gründete sie die Agentur I Do, die Mütter nach der Babypause dabei unterstützt, einen Job zu finden. Wilkens lebt mit Mann und drei Kindern in Hamburg.
Katrin Wilkens neues Buch „Mutter schafft! Es ist nicht das Kind, das nervt, es ist der Job, der fehlt“ ist im März erschienen.