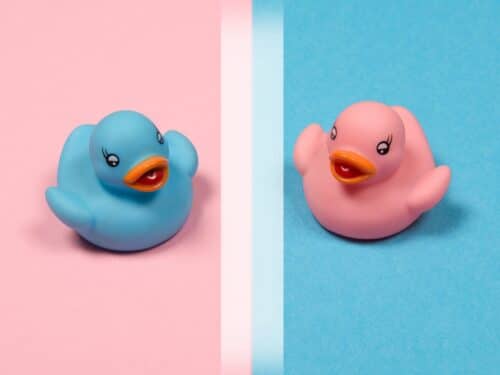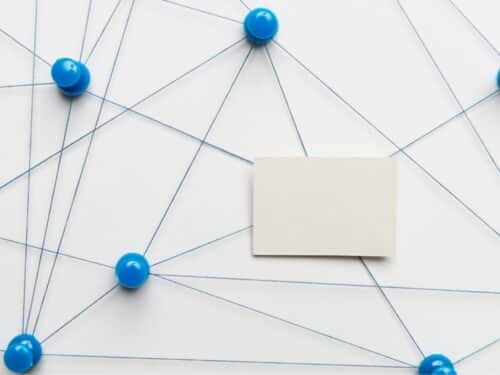Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll es qualifizierten Arbeitnehmern von außerhalb der EU erleichtern, nach Deutschland zu kommen. Aber wie wirkungsvoll ist dieses Instrument tatsächlich, um personellen Engpässen in Unternehmen entgegenzuwirken?Arbeitsmarktexperte Holger Bonin erklärt, was sich dadurch ändert.
Herr Professor Bonin, das ab März 2020 geltende Gesetz soll helfen, unser Demografieproblem auf dem Arbeitsmarkt zu lösen. Während sich die Regierungsparteien dafür feiern, sind Experten skeptisch. Machen wir einen großen Schritt voran?
Nein. Was vielen nicht bewusst ist: Im internationalen Vergleich waren die deutschen Regelungen für die Fachkräftezuwanderung zuletzt schon ziemlich liberal. Mit dem neuen Gesetz werden die bestehenden Regelungen punktuell noch etwas weiter gelockert. Das ist durchaus sinnvoll. Demografisch bedingte Engpässe kann man allerdings nur schwer durch Migration ausgleichen, dazu ist die Alterungsdynamik einfach zu stark. Damit die Erwerbsbevölkerung nicht kleiner wird, müssten auf mittlere Sicht jedes Jahr per Saldo rund 300.000 Menschen kommen, um dauerhaft in Deutschland zu arbeiten.
Laut Bundesregierung lassen sich dank des Gesetzes künftig 25.000 Fachkräfte pro Jahr aus dem nichteuropäischen Ausland rekrutieren.
Das ist nicht viel, da erfahrungsgemäß viele von ihnen nicht einwandern möchten, sondern Deutschland nach einiger Zeit wieder verlassen werden. Dass es sich um einen kleinen Schritt handelt, zeigt sich auch, wenn man die Zuwanderung aus dem europäischen Ausland dagegen hält. Deutschland hat von der Umsetzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU seit 2011 enorm profitiert. 2016 etwa kamen aus Ländern der EU 850.000 Menschen nach Deutschland, in andere EU-Länder gingen im selben Jahr nur 630.000 Menschen. Diese Nettozuwanderung von Arbeitskräften ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir momentan Rekorde bei den Beschäftigtenzahlen erreichen.
Sie reicht allerdings nicht aus, der Fachkräftebedarf ist ja nicht wegzureden.
Arbeitskräfteengpässe bleiben ein strukturelles Problem. Wir haben sie aber teils in Bereichen, die für Zuwanderer schwer zu erreichen sind.
Zum Beispiel?
Seit langem als Mangelberuf gelistet sind Pflegefachkräfte. Um in diesem Feld tätig zu sein, müssen Sie sehr gutes Deutsch mitbringen. Hinzu kommt: Deutschland geht mit der schulischen Pflegeausbildung einen speziellen Weg. In vielen anderen Ländern ist sie akademisch organisiert. Daher sind ausländische Pflegefachkräfte hierzulande oft überqualifiziert. Sie dürfen schlichtweg vieles nicht tun, was sie aus ihrer Heimat gewohnt sind, zum Beispiel Spritzen setzen. Im Zweifel werden Pfleger also lieber nach Schweden gehen, wo sie mehr Verantwortung haben und die Arbeitsbedingungen günstiger sind. Generell gilt: Jobs, die für deutsche Arbeitskräfte nicht attraktiv sind, werden es für gut ausgebildete und mobile Fachkräfte aus dem Ausland auch nicht unbedingt sein.
Worin besteht dann die maßgebliche Verbesserung durch das neue Gesetz?
Ein zentraler Punkt ist, dass die bislang zersplitterte Sammlung von Verordnungen und Regelungen nun zusammengezogen wird, was für etwas mehr Transparenz sorgt. Allerdings sind Zuwanderungsgesetze nie simpel – auch in anderen Ländern nicht. Es gibt nun einmal verschiedenste Kategorien. So braucht man eigene Regeln für Unternehmer und Investoren, für Wissenschaftler, für Familienangehörige, für Asylsuchende. Anders geht es nicht.
Im Umgang mit Fachkräftemigration wird immer wieder Kanada als Vorbild genannt. Zurecht?
Kanada hat lange Zeit Merkmale der Zuwanderer, die für die Integration in den Arbeitsmarkt förderlich sind, mit Punkten versehen. Wer eine bestimmte Summe erreichte, durfte einwandern. Ein Punktesystem bringt aber nicht unbedingt die gewünschten Resultate. Kanada musste es sogar lange Zeit praktisch aussetzen – die Behörden sind in einer Masse von Anträgen untergegangen. Vor allem aber gab es viele Zuwanderer, die trotz guter Voraussetzungen nur schlecht im Arbeitsmarkt Fuß fassen konnten, weil passende Stellen fehlten. Das Ergebnis war, dass zum Beispiel junge, qualifizierte Ingenieure nach Kanada kamen, dort aber teils als Taxifahrer gearbeitet haben.
Wie wurde das Problem gelöst?
Kanada hat das System radikal umgestellt. Inzwischen ist die Zuwanderungserlaubnis daran gekoppelt, dass man vorab einen angemessenen Arbeitsplatz nachweist. Damit hat man sich de facto dem genähert, was in Deutschland seit langem praktiziert wird, etwa mit der seit 2012 vergebenen Blue Card EU.
Deutschland hat also bei der Fachkräftezuwanderung keinen Nachteil gegenüber Kanada?
Nicht so sehr wegen den Zuwanderungsregeln. Deutschland ist aber im globalen Wettbewerb um mobile Fachkräfte erheblich schlechter aufgestellt, weil hier keine Weltsprache gesprochen wird. Arbeitgeber in klassischen Einwanderungsländern wie den USA oder Australien haben natürlich viel bessere Chancen, jemanden zu finden, der die Landessprache gleich sehr gut beherrscht.
Das neue Gesetz ermöglicht Drittstaatlern, die Deutsch sprechen und über eine berufliche Qualifikation verfügen, auch ohne Jobzusage für ein halbes Jahr herzukommen, um sich vor Ort zu bewerben. Ein Fortschritt?
Das bleibt abzuwarten. Die Forschung weiß noch wenig darüber, wie viel es bringt, vor Ort nach einer Stelle suchenzu können, anstatt Kontakte über digitale Kanäle anzubahnen. Gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen könnte aber die Möglichkeit, Bewerber aus Drittstaaten leichter persönlich in Augenschein zu nehmen, wichtig sein. Andererseits könnte es passieren, dass die neue Option Menschen anzieht, die zwar Deutsch können, aber von der Qualifikation her kaum Aussicht auf einen guten Job bei uns haben. Hier gilt es aufzupassen, dass sie nach Ablauf der Frist das Land auch tatsächlich wieder verlassen. In jedem Fall sendet Deutschland künftig ein Signal nach außen, dass das Land nun dezidiert für Zuwanderung geöffnet ist: „You can make it in Germany“.
Der größte Knackpunkt, da sind sich Experten und die Oppositionsparteien weitgehend einig, ist die Anerkennung und Gleichwertigkeit von Berufsabschlüssen.
Die Politik hat schon einiges versucht, die Anerkennung ausländischer Qualifikationen zu entbürokratisieren und es leichter zu machen, eine Gleichwertigkeit von Abschlüssen festzustellen. In der Praxis läuft das bisher aber alles andere als reibungslos. Ein wesentlicher Grund dafür ist das deutsche Ausbildungssystem, das in den meisten anderen Ländern kein Gegenstück hat. Das polarisiert: Einerseits gibt es viele Akademiker, die nach unseren Standards eher als beruflich qualifiziert zählen müssten. Andererseits stehen viele Zuwanderer – man denke nur an die jüngst angekommenen Geflüchteten – formal ohne jeglichen Abschluss da, obwohl sie durchaus einiges an berufspraktischen Kenntnissen mitbringen. Hier müssen wir umdenken.
Was sollte man denn tun?
In Deutschland ist der Zugang zu vielen Berufen reguliert. Der Gesetzgeber sollte die Zugangshürden kritisch prüfen. Die Probleme mit der Anerkennung beschränken sich in der Praxis aber auch auf Berufe, für die es keine formalen Vorgaben gibt. Somit sind auch die Arbeitgeber gefragt: Sie sollten mehr Wert auf tatsächliche Fähigkeiten und Kompetenzen legen als auf formale Zertifikate. Ob jemand einen Job ausführen kann oder nicht, kann man oft anhand von Arbeitsproben feststellen. Diese Form von Assessment wird wichtiger werden, wenn mehr Stellen der mittleren Qualifikationsebene mit internationalen Bewerbern besetzt werden sollen.
Mit dem neuen Gesetz fallen die Vorrangprüfung, also die bevorzugte Behandlung geeigneter EU-Bewerber auf eine Stelle, und die Begrenzung auf Mangelberufe weg. Damit wird die Anwerbung erst einmal unspezifischer. Ist das klug?
Das ist ein richtiger Schritt. Es ist nämlich schwierig, Engpässe und Mangelberufe anhand der verfügbaren Arbeitsmarktdaten verlässlich einzugrenzen. Und was die Vorrangprüfung angeht: Arbeitgeber werden auf einem funktionierenden Arbeitsmarkt normalerweise ohnehin geeignete lokale Bewerber gegenüber solchen von außerhalb der EU vorziehen – weil die Rekrutierung weniger aufwändig, die Einarbeitung leichter ist und Sprachhürden wegfallen.
Experten sind teils besorgt, es könnte ohne Vorrangprüfung zu Lohndumping kommen.
Diese Sorge ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Zuwanderer, die sozial kaum abgesichert sind, werden Arbeit zu schlechteren Bedingungen eher annehmen als Einheimische. Das beobachten wir derzeit in extremem Ausmaß in den USA, wo sich viele Migranten aus Mittel- und Südamerika mit illegalem Status aufhalten und irregulär beschäftigt sind. Solche Zustände sind mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz aber nicht zu erwarten. Zuwanderer aus Drittstaaten müssen nämlich zu denselben Konditionen angestellt werden wie vergleichbare einheimische Beschäftigte. Dafür müssen sich die Behörden zunächst die Arbeitsverträge ansehen und später dann deren praktischen Vollzug überprüfen. In Deutschland haben wir mit der Kontrolle von Lohndumping einige Erfahrung. Deshalb sollte die Überwachung auch bei Beschäftigten von Drittstaatlern klappen.
Gerade für KMU ist es aufwändig, Fachkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland anzuwerben. Der DIHK fordert hier mehr Unterstützung. Wie könnte diese aussehen?
Viele Arbeitgeber klagen über rechtliche Hürden, die faktisch längst abgeschafft sind. Das hat eine Studie zur internationalen Rekrutierung in der Pflegebranche ergeben, an der ich beteiligt war. Gute Beratung und Information sind also enorm wertvoll. Mein wichtigster Tipp ist aber: Arbeitgeber sollten realistisch sein. Für viele kleine und mittelständische Unternehmen wird die Anwerbung aus Drittstaaten auch künftig nicht der beste Weg sein, Schwierigkeiten bei der Besetzung von Stellen zu überwinden. Unternehmen sollten sich fragen, wie wahrscheinlich es ist, nun auf einmal in Drittstaaten auf Arbeitskräfte zu stoßen, die sie derzeit – trotz Arbeitnehmerfreizügigkeit – im europäischen Ausland nicht finden konnten. Und sie müssen wissen, dass sie eine Rekrutierung auf dem globalen Arbeitsmarkt meist nicht allein stemmen können. Dafür ist der Aufwand einfach zu hoch.
Und was raten Sie einem Mittelständler, der das plant – sollte er auf Vermittlungsinstitute setzen, die im kommenden Jahr vermutlich überall eröffnen, um die neue Beratungsnische zu besetzen?
Er sollte sich mit anderen Unternehmen vernetzen, die in einer ähnlichen Situation sind, um gemeinsam Konzepte für die Rekrutierung zu entwickeln. Sich in Arbeitgeberverbänden zu organisieren und Erfahrungen zu teilen, ist eine gute erste Maßnahme. Es ist nicht damit getan, eine Stellenanzeige auf einem internationalen Jobportal zu schalten. Sollte es sich um eine relevante Größenordnung zu besetzender Stellen handeln, gibt es Intermediäre, die zum Beispiel an bestimmten ausländischen Standorten gezielt für Aufmerksamkeit sorgen und dort gesammelt persönliche Bewerbungsgespräche organisieren können.
Ihr abschließendes Urteil: Welche Schulnote würden Sie dem Gesetz insgesamt geben?
Eine Zwei. Lange Zeit hat die Bundesregierung nämlich nicht klar genug gesagt, dass Deutschland mehr Zuwanderung aus ökonomischen Gründen anstrebt. Die Politik ist der unbequemen Debatte über die vermehrte Rekrutierung ausländischer Fachkräfte ausgewichen, indem sie auf dem Verordnungsweg – damit von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt – viele Erleichterungen durchgesetzt hat. Jetzt gibt es endlich ein klares Bekenntnis: Wir wollen Arbeitsmigration, und wir möchten sie steuern. Entscheidend wird nun sein, dass das Gesetz mit Leben gefüllt wird.
Das heißt?
Mutig sein und etwa die ausländischen Abschlüsse leichter anerkennen. Die Möglichkeiten der Zuwanderung weltweit vermarkten, Sprachkurse und berufliche Ausbildungen nach deutschem Standard im Ausland fördern. Und nicht zuletzt: die Zuwanderungspolitik der eigenen Bevölkerung viel besser erklären. Es gilt, alte Ängste zu nehmen, Migranten würden Einheimischen die Arbeit wegnehmen. Das gesellschaftliche Klima ist am Ende entscheidend: In eine Region, deren Bevölkerung zu 35 Prozent AfD wählt, wird die ausländische Fachkraft nicht ziehen wollen. Wenn sie damit rechnen muss, auf der Straße angepöbelt zu werden, spricht sich das in der jeweiligen Community herum – auch über soziale Netzwerke. Diese schwer zu beeinflussenden Faktoren sind für den Erfolg von Zuwanderungspolitik wichtiger als jedes Gesetz.
Holger Bonin ist seit Juli 2016 Forschungsdirektor am IZA Institute of Labor Economics. Er ist zudem Professor für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik an der Universität Kassel. Bonin befasst sich empirisch unter anderem mit den Folgen des demografischen und technologischen Wandels, der Fachkräftesicherung und Migration.
Das sind die wichtigsten Neuerungen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes:
- Ein einheitlicher Fachkräftebegriff, der Hochschulabsolventen
und Beschäftigte mit qualifizierter Berufsausbildung umfasst, - der Verzicht auf eine Vorrangprüfung bei anerkannter Qualifikation und Arbeitsvertrag,
- der Wegfall der Begrenzung auf Mangelberufe bei qualifizierter Berufsausbildung,
- die Möglichkeit für Fachkräfte mit qualifizierter Berufsausbildung entsprechend der bestehenden Regelung für Hochschulabsolventen, für eine befristete Zeit zur Arbeitsplatzsuche nach Deutschland zu kommen (Voraussetzung: deutsche Sprachkenntnisse und Lebensunterhaltssicherung),
- bei Vorliegen eines geprüften ausländischen Abschlusses verbesserte Möglichkeiten zum Aufenthalt für Qualifizierungsmaßnahmen im Inland mit dem Ziel der Anerkennung von beruflichen Qualifikationen.