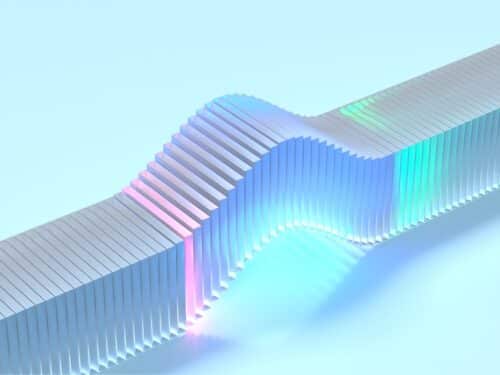Wenn man die Errungenschaften der modernen Gesellschaft in einem einzigen Satz zusammenfassen würde, wäre „Das ist nicht persönlich gemeint“ eine exzellente Wahl. Denn: In der modernen Gesellschaft können wir in unserem Handeln zwischen uns als ganzem Menschen, als Person mit einer Vielzahl von Interessen, Verpflichtungen, Wünschen und Abneigungen und unserer spezifischen Rolle, die wir in einer Organisation einnehmen, unterscheiden.
Wenn wir etwas nicht persönlich meinen, aber dennoch handeln, weisen wir darauf hin, dass wir uns im Rahmen von sozialen Normen bewegen, die nichts mit dem Menschen zu tun haben, sondern mit seiner Funktion. Der Mensch am Steuer des Linienbusses kann uns nicht nach Hause fahren – es sei denn, wir wohnen an seiner Linie. Wer mit einem kleinen Schnitt im Finger in die Notaufnahme fährt, wird vermutlich nicht direkt untersucht, selbst wenn einen alle Anwesenden beim Vornamen kennen. Das Personal arbeitet die Fälle nach Dringlichkeit ab.
Die machtvollsten Optionen, persönliche Interessen zur sekundären Ordnung zu erklären, liegen in der Hand von Organisationen. Diese haben die Möglichkeit, Mitgliedschaft an Bedingungen zu knüpfen. Wem die Bedingungen nicht passen, kann ja gehen. Das macht es Organisationen möglich, Erwartungen zu formulieren, die ihre Mitglieder erfüllen müssen, wenn sie nicht signalisiert bekommen wollen, dass sie sich bald einen anderen Arbeitgeber suchen müssen, wenn sich nicht erwartungsgemäß verhalten.
Was Organisationen im Verhältnis zu anderen sozialen Systemen wie Familien, Freundschaften oder beispielsweise Religionsgemeinschaften so besonders macht ist, dass diese Regeln und Erwartungen nur Bereiche berühren können, die auch mit der Organisation zu tun haben. Man weiß – zumindest auf dem Papier –, worauf man sich einlässt, wenn man den Arbeitsvertrag unterschreibt, die Tochter im Fußballklub anmeldet oder dem Umweltschutzverein beitritt. Deswegen ist man nur als Mitglied dabei, „partiell engagiert“, wie der Soziologe Niklas Luhmann es nennt, und nicht mit seinem gesamten Leben der Organisation verschrieben.
Menschen in Organisationen dürfen erwarten, dass ihnen auch ein Leben außerhalb zugestanden wird, dass also innerhalb der Organisation ihre eine Rolle zählt und ihre übrige Zeit und Aufmerksamkeit die Organisation formal nichts angeht. Dass man sich im Team erzählt, wie das Wochenende war, ist kein Bruch mit dieser Regel. Wenn eine Teamleitung sagt, dass man statt Serien gucken auch sonntags mal in seine E-Mails gucken darf, sehr wohl.
Hier deutet sich bereits die Differenz zwischen dem theoretischen Modell und der Realität an. Wer Organisationen von innen erlebt hat, kennt auch das Spiel mit den Grauzonen, in denen zwischen legitimen und illegitimen Erwartungen nicht mehr so genau unterschieden wird. Es gibt weit mehr Anforderungen an Mitglieder, als im Prozesshandbuch und Arbeitsvertrag festgelegt sind. Und in jeder Organisation kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz, die Probleme der Organisation zu persönlichen Problemen ihrer Mitglieder machen. Als einzelne Person ist es schwer, sich dagegen zu wehren und zu schützen. Aber wie üblich hilft es, seinen Gegner zu kennen.
Drei Mechanismen sind in Organisationen dabei besonders häufig im Einsatz:
- Psychologisierung: Wenn strukturelle Probleme als persönliche Probleme beschrieben werden.
- Moralisierung: Wenn der Beruf auf jeden Fall auch Berufung sein muss.
- Überdehnung formaler Pflichten: Wenn der Arbeitgeber nicht die angemessenen oder passenden Ressourcen zur Aufgabenerfüllung bereitstellt, sie aber dennoch verlangt.
1. Psychologisierung: Es liegt am Menschen, nicht am Unternehmen
Wer in Organisationen arbeitet, kennt das Muster: Wo etwas schiefgeht, muss jemand schuld sein. Natürlich auch dann, wenn sich an mangelnder Produktqualität, nicht eingehaltenen Fristen, Umsatzeinbußen oder Unfallhäufigkeit durch den Austausch von Personen nichts ändert.
Wir konnten dieses Muster bei einem britischen Lebensmittelhersteller beobachten. Das Unternehmen suchte eine neue Marketingleitung, es wäre die achte in zehn Jahren gewesen. Die Vorgänger hatten allesamt ausgewiesene Expertise für ihr Fach vorweisen können. Doch konnte sich niemand lange auf der Stelle halten. Offenbar lag das Problem also nicht nur bei den jeweiligen Personen. Es gab im Vorstand keine klare Vorstellung darüber, welche Zielgruppen man erreichen und wie man das Produktportfolio weiterentwickeln will. Die Verantwortlichen für Vertrieb, Finanzen und Produktion belauerten sich in einem ausgesprochenen Konkurrenzverhältnis. Jeder von ihnen hatte andere Erwartungen an das Marketing und andere Vorstellungen von der Positionierung der Marken des Unternehmens. Statt diese Widersprüche zu lösen, suchten Vorstand und Aufsichtsrat die Schuld reflexartig bei den jeweiligen Marketingverantwortlichen. Sie wurden durchgängig als schlecht, unfähig, nicht engagiert diskreditiert.
Die Zuschreibung der Probleme auf die Person funktionierte wie ein Strukturschutz. Solange Personen die Verantwortung gegeben werden konnte, musste man nicht die inneren Widersprüche bearbeiten. Doch ein Problem dieser Leistung war: Weil der schnelle Mitarbeiterverschleiß irgendwann auch Außenstehenden auffiel, wurde es schwierig, qualifizierte Leute für die Position zu gewinnen.
2. Moralisierung: Wenn der Beruf auch Berufung sein muss
Eine andere Methode, mit der Organisationen die Bearbeitung ihrer Defizite auf Personen verlagern, sind Appelle an die Moral. Diese kommen zum Einsatz, wenn es keine Möglichkeit gibt, das Gewünschte formal einzufordern. Bereitschaft zur Extrameile oder nach mehr Begeisterung gehören etwa dazu. Gerade bei der Forderung nach Begeisterung sind Mitglieder gut beraten, misstrauisch zu werden. Dieser Zugriff auf die intrinsische Motivation bleibt Organisationen in der Regel versperrt. Sie brauchen besondere Anlässe. Irgendwas muss dringend, wenn nicht gar brenzlig sein, was nun vollen Einsatz der Beteiligten erfordert. Besonders deutlich lassen sich diese Mechanismen in Unternehmen beobachten, die sich als Purpose Driven Organizations verstehen. Hier entkoppelt die Organisation die besondere Motivation von der Dringlichkeit. Da das Warum über allem steht, werden alle Handlungen gleichermaßen dringend – und erfordern besonderen, auch persönlichen Einsatz. „Partiell engagiert“ sein ist in dieser Umgebung nichts Gutes, sondern ein Vorwurf. Mitglieder müssen zeigen, dass sie ihre Arbeit als Selbstzweck erleben und nicht etwa vorrangig erledigen, weil sie dafür bezahlt werden.
Man sollte sich in der Sache nichts vormachen: Wenn eine Organisation eine Kultur unterstützt oder ermöglicht, die erhöhte Leidenschaft und Arbeitsmoral einfordert, ist dies ein deutliches Krisensymptom. Es wird deutlich, dass sie nicht in der Lage ist, aus eigener Kraft ihre Probleme und Aufgaben zu stemmen, und auf persönliches Engagement der Mitglieder angewiesen ist. Das heißt nicht, dass es verboten sein soll, Leidenschaft und Arbeitsmoral zu zeigen. Eine gut aufgestellte Organisation macht es ihren Mitgliedern möglich, engagiert zu sein. Aber sie zwingt sie nicht dazu.
3. Ergebnisoffenheit: Die Überdehnung formaler Pflichten
Der Zugriff zu diesem Mechanismus läuft über ergebnisorientierte Aufgaben. Diese sind grundsätzlich sehr beliebt, bei Mitgliedern und bei Organisationen. Mitarbeitende bekommen ein bestimmtes Ziel genannt und können die Mittel selbst wählen. Das soll unter anderem Kreativität und Eigeninitiative freisetzen, zu überraschenden Problemlösungen führen, Lernprozesse und Kompetenzaufbau befördern und die Effizienz erhöhen. Viel davon kann zutreffen. Doch können solche Zweckprogramme auch zur Zumutung werden. Das geschieht, wenn die von der Organisation zur Verfügung gestellten Ressourcen (wie Zeit, Personal, Informationen, Budget, Maschinen, Räume, Rechnerkapazitäten oder Führungsmittel) nicht genügen, um den gesetzten Zweck zu erfüllen. Dann wird der Appell zur Eigenverantwortung zur mehr oder weniger elegant kaschierten Aufforderung, sich über die Grenzen zum Beispiel der eigenen Arbeitszeitressourcen, der Sicherheitsvorschriften oder der Befugnisse gegenüber Untergebenen hinwegzusetzen.
Typisch für überdehnte Zweckprogramme ist ein Satz wie: „Mir ist egal, wie es passiert, nur soll es fertig werden“. Die Führungskraft als Vertreterin der Formalstruktur will gar nicht so genau wissen, auf welchen Wegen das gewünschte Ziel erreicht wird. So lassen sich implizit Leistungen einfordern, die formal nicht verlangt werden können. Ein Beispiel dafür wäre eine Agenturchefin, die ihr Grafikteam bittet, die Entwürfe für die Präsentation am nächsten Morgen bereitzuhaben. Sie kann nicht offiziell Nachtarbeit anordnen, weiß aber, dass die Präsentation nur mit massiven Überstunden zu schaffen ist. Wer nicht explizit widerspricht, war nun freiwillig bereit, seine persönliche Zeit der Organisation zur Verfügung zu stellen.
Die schlechte Nachricht ist: Als einzelne Person hat man wenig Chancen, sich den Mechanismen zu entziehen. Wer sich im Alleingang dem System entgegenstellt, ändert nicht die Norm, sondern wird für den Normbruch sanktioniert. Natürlich nicht formal und offen, sondern latent: mit weniger spannenden Projekten, weniger gemeinsamen Mittagessen, mehr spitzen Bemerkungen im Büro. Organisationskulturen kennen überraschend effektive Wege, sich stabil zu halten. Hier hat man im Grunde drei Möglichkeiten: mitschwimmen, zynisch werden oder die Mitgliedschaftsfrage erneut stellen: Hätte ich mich auf diese Organisation eingelassen, wenn mir die Verhältnisse vorher bekannt gewesen wären?
Die Verantwortung liegt bei jenen, die über die Verhältnisse entscheiden. Sie müssen Strukturen schaffen, die auch funktionieren, wenn Mitglieder ihre Arbeit machen, ohne stets persönlich involviert zu sein. Dann wird es zwar immer noch dazu kommen, dass Leidenschaft gefordert und persönliche Zeit investiert wird. Doch kann kluges Organisieren dafür sorgen, dass die Regeln zur Ausnahme werden.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Intelligenz. Das Heft können Sie hier bestellen.

Kai Matthiesen